Überarbeitete Rede zur Eröffnung der Spoerri-Retrospektive in der Galerie Krinzinger, Innsbruck, 2. März 1981, in Daniel Spoerri. Retrospektive (Katalog) Innsbruck 1981
Daniel Spoerri als Kulturheros - das scheint zunächst einmal nur auf eine leichte Umformulierung des üblichen Themas »Daniel Spoerri als Künstler« hinauszulaufen. Es gibt ja keine Geschichte der Künste der vergangenen zwanzig Jahre, in welcher Spoerri als Künstler nicht ausdrücklich gewürdigt würde; und es gibt keine programmatischen Sammlungen, in denen er nicht mit einigen seiner Arbeiten vertreten wäre.
Daniel Spoerri als Künstler zu würdigen, hieße ja wohl, in erster Linie von der immanenten Entwicklung der Kunst der vergangenen zwanzig Jahre zu sprechen. Also von formalen Problemlösungen, vom Wechselspiel der Einflußnahmen unter Künstlern und den Einflüssen von Kulturlandschaften und kulturellen Umfeldern auf den Künstler.
Genau das möchte ich aber hier nicht tun - sondern eben von Spoerri als Kulturheros sprechen. Was heißt das? Den Topos des Kulturheros kennt man in allen Kulturen; bei uns ist er wohl am geläufigsten in der Gestalt des Prometheus, des »vorbedacht Handelnden« (wörtl.) Unter den vielen überlieferten Ausformulierungen des Wesens von Prometheus ist wohl die eingängigste jene, welche Prometheus als den Feuerbringer für die Menschheit kennzeichnet. Aber nicht nur das Feuer brachte er, sondern eine ganze Reihe von Kulturtechniken wie die Schrift, die Heil- und Baukunst, die Metallurgie und die Navigation.
Nicht die unwesentlichste seiner Taten war es, den Menschen klar zu machen, daß man nur die ungenießbaren Teile eines Opfertieres - Knochen und Fett - den Göttern darbieten solle.
Zeus fühlte sich durch das Vorgehen des Prometheus getäuscht. Da Zeus aber die Täuschung durchschaute, konnte er sich damit zufrieden geben, Knochen und Fett des Tieres als Opfer anzunehmen.
Dennoch strafte er die Tat des Prometheus, indem er den Menschen das Feuer entzog. Prometheus raubte das Feuer vom Himmel und gab es den Menschen zurück. Damit hatte er sich endgültig den Zorn des Göttervaters zugezogen, nachdem er zuvor schon in seiner Funktion als Menschenbildner durch Künstlereigensinn straffällig geworden war.
Auf Anweisung von Zeus hatte er alle Lebewesen in Ton zu modellieren, verausgabte aber sein Material bereits bei der Modellierung der Tierwelt. Deshalb mußte er, um die Menschen zu modellieren, einige Tiergestalten umformen, wodurch die Menschen leider Lebewesen mit tierischen Seelen geworden sind. Seine Künstler-Eigenmächtigkeit büßte Prometheus angeschmiedet an einen Felsen, gemartert von einem Adler, der ihm täglich ein winziges Stück aus seiner Leber riß.
Prometheus hatte also gegen seine namentliche Verpflichtung zweifach verstoßen: Er hat mit Vorbedacht das Falsche getan - nämlich Zeus zu täuschen - und er hat den vorgefaßten Plan der Modellierung aller Lebewesen während der Realisierung vergessen, weshalb das Gestaltungsunternehmen nicht mehr planmäßig verlaufen konnte.
Die antiken Erzähler wußten natürlich, daß die Realisierung von Plänen nur der eine Teil der für die Schaffung von Kultur wichtigen Technik ist. Den anderen Teil vergegenständlichten sie im Zwillingsbruder des Prometheus, in der Gestalt des Epimetheus, des erst nachträglich - das heißt: nach einer vollbrachten Tat - Denkenden. Epimetheus ist die Entwicklung von Plänen und Vorstellungen, die es zu verwirklichen gilt, verwehrt. Er läßt sich zunächst seinen spontanen Wünschen und Emotionen entsprechend auf die Welt ein. Er produziert nur in spontanen Setzungshandlungen, um dann, wenn das Füllhorn der vielfältigen Erscheinungen ausgeleert ist, zum Nachdenken über das so Produzierte zu kommen, wozu er angetrieben wird durch die unangenehmen Folgen, die dieses willkürliche und spontane Tun zeitigt.
Die ungleichen Brüder Prometheus und Epimetheus enthüllen erst den ganzen Umfang kultureller Tätigkeiten: Das vorbedachte Handeln, das aber sehr häufig zu einer Vergewaltigung des ursprünglichen Planes führt, und das den Taten nachfolgende Bedenken des eigenen Tuns, durch das aber die unangenehmen Seiten spontan willkürlichen Schaffens nicht mehr aus der Welt gebracht werden können - sondern das nur noch dazu taugt, die selbst hervorgerufenen Übel auszuhalten.
Es sei an dieser Stelle gleich penetrant darauf hingewiesen, daß das künstlerische Schaffen Spoerris - wie das jedes Kulturschaffenden - pro- und epimetheisch ist:
Es kommt aber sehr entscheidend darauf an, in welcher Weise das Vorausbedenken und das nachträgliche Analysieren bzw. Systematisieren miteinander in Beziehung gesetzt werden, und zwar im Hinblick auf ihren Nutzen für den Menschen.
Welche nützlichen Angebote unterbreitet der Kulturheros Spoerri den Menschen seit zwanzig Jahren? Zunächst einmal operiert Spoerri - wie die meisten Künstler - vornehmlich aus dem spontanen, willkürlichen Setzen von gestaltetem Material.
Als solches ist es uns, dem Publikum, ganz fremd, unbekannt, undurchschaubar. Anstatt aber nun das neu Geschaffene nachträglich durch allerlei Begründungen als so und nicht anders Mögliches zu rationalisieren - also rechtfertigend zu erklären - sollten wir uns gerade die Neuartigkeit und Fremdheit dieses Neugeschaffenen zunutze machen.
Etwa auf folgende Weise: Vom Neuen, Unbekannten, läßt sich ja wohl sinnvoll nur mit Bezug auf das Alte und Bekannte reden (nur mit Bezug auf die kulturellen Hervorbringungen, die uns im Unterschied zu diesem Neuen vertraut, durchschaut, erkannt vorkommen). Normalerweise bezeichnen wir die kulturellen Bestände, die für uns vertraut und erkannt zu sein scheinen, als Traditionen, um sie von den nichts als neuen Hervorbringungen der zeitgenössischen Avantgarde abzusetzen. Aber - von dem nichts als Neuen kann man eben nur mit Bezug auf das Alte, von den Avantgarden nur mit Bezug auf die Traditionen (und umgekehrt, natürlich) sprechen. Die Unterscheidung von Avantgarden und Traditionen kann also nicht auf eine prinzipielle Abtrennung der Avantgarden von den Traditionen hinauslaufen, also nicht auf eine prinzipielle Zerschlagung jeglicher Tradition abzielen, und umgekehrt dürfen die Traditionen nicht als ein- für allemal feststehende Kennzeichnungen historischer Kulturgüter die mögliche Hervorbringung von etwas Neuem außer Betracht lassen.
Die Traditionen aus sich heraus - ohne Bezug auf das ganz andere und unverständlich Neue - bestimmen zu wollen, hieße, kulturelle Produktion nur prometheisch zu betreiben als eine fortgesetzte, kalkulierbare, planmäßige Entwicklung des einen aus dem anderen. Und - das avantgardistisch Neue bloß aus sich heraus bestimmen zu wollen, hieße, die kulturelle Produktion ausschließlich epimetheisch zu verstehen, wobei dann »Verstehen« nur ein nachträgliches, rechtfertigendes Rationalisieren bedeuten würde. Wenn also die nichts als neuen Avantgarde-Werke zu den traditionellen in Bezug gesetzt werden müssen, um sowohl die prometheische wie die epimetheische Seite der kulturellen Produktion zu berücksichtigen, dann wird man zu beobachten haben, wie durch das unbekannt Neue, das uns - wie der unvermutbare Inhalt der Büchse der Pandora - Angst bereitet, die traditionellen Bestände oder vielmehr unsere Wahrnehmung dieser Bestände: sich verändert; so weit verändert, daß die vermeintlich vertrauten und bekannten traditionellen Bestände wieder ganz neu - und damit ihrerseits befremdlich fordernd - erscheinen.
Die Funktion der durch Setzungshandlungen Neues schaffenden Avantgarden besteht darin, die durch ihre Vertrautheit und vermeintlich gesicherte Erkenntnis schon ganz wirkungslos gewordenen historischen Kulturgüter wieder als gegenwärtig wirksame zu erschließen; oder - um es formelhaft zu wiederholen - leistungsfähige Avantgarde ist nur das, was uns zwingt, neue Traditionen zu bilden. Denn: die notwendige, wechselseitige Ergänzung im prometheischen und epimetheischen Tun von Avantgarde vorausgesetzt, verstehen wir, daß Traditionen als planmäßige, rational kalkulierbare Entwicklungslinien kultureller Produktion nicht ein für allemal gesichert, als Ursache-Folge-Verhältnisse festgeschrieben werden können, so, als wirkten sie aus der Vergangenheit bis in unsere Gegenwart und darüberhinaus in eine vorhersehbare Zukunft fort.
Selbst, wenn es solche Konzepte der kulturellen Entwicklung gäbe, dann - so lehrt uns das Künstlerschicksal des Prometheus - ist immer damit zu rechnen, daß der Plan nicht bruchlos ins tatsächliche Tun der Menschen übersetzt werden kann. Wegen dieser unbeabsichtigten Abweichungen und Entwicklungsbrüche sind wir immer auch gehalten, von jedem gerade erreichten Entwicklungspunkt her die gesamte bisherige Geschichte neu zu schreiben, also nach rückwärts gewandt, das heißt epimetheisch.
Das würde uns aber nichts einbringen, wenn wir die jeweils unter dem Druck des zeitgenössisch Neuen nach rückwärts zu schreibende Geschichte - das heißt den Aufbau von neuen Traditionen - so auslegen wollten, als hätten die willkürlich, spontan oder aus unbekannten Gründen hervorgetretenen Einbrüche des Nichtgeplanten doch wieder eine innere Logik, aus der wir nunmehr einen neuen Plan aller Entwicklungen so rekonstruierten, als hätte dieser Plan am Anfang der Entwicklung vorgelegen, wir hätten ihn nur bisher nicht gekannt.
Unter dem Druck des jeweils Neuen die traditionellen Bestände wieder so zu erleben, als hätten wir sie bisher noch gar nicht recht zur Kenntnis genommen, heißt eben, neue Traditionen aus den jeweiligen Gegenwarten nach rückwärts zu entwickeln. Und das geschieht ja auch fortwährend; wie man sagt, hat jede Generation unter dem Druck des für sie gerade zeitgenössisch Neuen ihre eigene Geschichte der historischen Bestände zu schreiben. Selbst im Laufe eines Einzellebens werden die Sicht auf und das Verständnis für immer denselben historischen Bestand - sagen wir zum Beispiel die Werke Rembrandts - verändert werden.
Veränderungen vorgegebener Orientierungen vorzunehmen bedeutet, Risiken einzugehen, Unsicherheiten zu ertragen. Das wollen wir alle nach Möglichkeit vermeiden. Deswegen entziehen wir uns dem Druck des nichts als Neuen und Unbekannten in der Avantgarde -indem wir entweder behaupten, das Neue sei gar nicht neu, sondern »olle Kamelle«; oder indem wir die neuen Werke zerstören.
Spoerris Werken gegenüber hat man bisher vornehmlich so reagiert, als seien sie gar keine Werke, sondern die Wiederkehr dadaistischer Kunstlosigkeit. »NeoDada«, riefen die zur Reaktion provozierten Traditionalisten, wobei insbesondere auffällig ist, daß dieselben Leute den ursprünglichen Dada ebenso wenig zu nutzen verstanden; aber um die Spoerri'schen Werke sich vom Hals zu schaffen, war man selbst bereit, den für »Schwachsinn« gehaltenen Dada gegenüber Spoerri auszuspielen. Ein bekanntes Muster des Umgangs mit Avantgardewerken allgemein. Spoerri teilte in einem Interview mit, daß »Duchamp es uns zu verdanken hat, daß er wurde, wofür er jetzt gilt. Um unsere Arbeit zu diskriminieren, verwiesen unsere Kritiker stets auf Duchamp, der angeblich alles schon viel früher geleistet habe. Klar ist, daß diese Kritiker zuvor von Duchamp gar nichts wußten, ihn also nur als Drohfigur gegen uns aufbauten.« Andererseits gab es natürlich hinreichende Versuche aggressiver Leugnung des Spoerri'schen Werkanspruches. Am unangenehmsten, weil bloß nachträglich rationalisierend, ist jene Rezeption der Spoerri'schen Werke, die sie glaubt, aus der inneren Logik der Entwicklung der Moderne ableiten zu können, um sie so als künstlerisch nicht hinreichende Erfüllung eines notwendigen Entwicklungsschrittes der zeitgenössischen Kunst klassifizieren zu können.
Auch den Einwand unaufhörlicher Wiederholung des immer gleichen, schmalen Werkgedankens hat man im Hinblick auf Spoerri vorgebracht. So, als vollzöge er prometheische Taten am Fließband, in Serie.
Insgesamt läßt sich die unangemessene Kritik an Spoerri bisher mit dem sattsam bekannten Mechanismus kennzeichnen, der dazu führt, daß man Künstlern vorwirft, ihnen falle nichts Neues mehr ein, weil sie ihren Werkgedanken in erkennbarer Weise nur wiederholten, um ihnen aber zugleich den Vorwurf eklektizistischer Unterwerfung unter Moden anzulasten, wenn sie daran gehen, immer neue Ansätze zu entwickeln.
Also - versuchen wir an der Hand der ungleichen antiken Zwillingsbrüder in einer sinnvollen Weise die Angebote zu nutzen, die Spoerri macht.
Programmatisch wählen wir jenes Spoerrische Tableau »Avoir des yeux derrière la Haute« das im Halbrelief einen Hinterkopf zeigt, der zwei Augen trägt. Zunächst scheint das nur die Verbildlichung der französischen Version einer Sprichwörtlichkeit zu sein, die zu deutsch etwa hieße: seine Augen überall zu haben - oder aber: jemand habe seine Augen überall, nur nicht dort, wo sie sinnvollerweise hingehören?
Es gibt eine Arbeit von Magritte, auf welcher der Betrachter die Rückenansicht eines Mannes sieht, der vor sich in einen Spiegel blickt, im Spiegel aber seine eigene Rückenansicht genau in der gleichen Weise vor sich hat, wie der Betrachter den sich spiegelnden Mann sieht. Magritte entzieht durch einige betonte Hinweise im Bild der Überlegung des Bildbetrachters jede Möglichkeit, sich eine Spiegelungs-Konstruktion so auszudenken, daß sie einen Mann in genau der Weise spiegelt, in der der Bildbetrachter den Mann sieht. Wie bei Magritte das Spiegelmotiv zunächst die Überlegungen des Bildbetrachters in die Falle lockt - nämlich das Dargestellte als auf eine durch jedermann nachvollziehbare Weise Zustandegekommenes zu rekonstruieren - so lockt die Sprichwörtlichkeit bei Spoerri uns in die Falle, das Spoerri'sche Objekt nur als eine bildliche Entsprechung zu einer Redensart zu lesen. Aber zwischen Sprichwörtlichkeit und Denkbildlichkeit, zwischen Wort-wörtlich-nehmen, Bild-bildlich-nehmen besteht ein gravierender Unterschied. Ihn zu untersuchen, ist eine der durch sein ganzes Werk sichtbaren Aufgaben Spoerris.
Diese Untersuchungen können hingegen nicht - wie das etwa Neurophysiologen oder Wahrnehmungspsychologen täten - an empirisch sicherbaren Vorkommnissen der Alltagswelt angestellt werden. Vielmehr produziert Spoerri - wie andere Künstler - zunächst den Sachverhalt, der dann untersucht werden soll, selber. An dem so in die Welt gesetzten Objekt erweist sich dann, daß alles vorausgesetzte, in einem Schaffensplan vorauskalkulierbare Wissen nicht hinreicht, den Wirkungsanspruch des Objekts auszuschöpfen und die Aufmerksamkeit damit vom Objekt zu lösen. So kann uns das Spoerri'sche Objekt zum Beispiel unter anderem, bisher noch nicht Versuchtem dazu zwingen, die vermutete Ausgangslage seines Entstehens zumindest als nicht allein für das Objekt erhellend anzusehen. Die Ausgangslage mag durchaus die Verbildlichung einer Redensart gewesen sein. Über sie hinaus ließe sich aber etwa »der Blick nach rückwärts« thematisieren, der dem Augentragenden das hinter ihm Liegende als einzige Auskunft über das erschließt, was er vor sich zu sehen glaubt - worauf er sich zu orientieren scheint. Man gefiele sich aber nur in einer Geistreichelei oder in einer hämischen Zurechtweisung, wenn man dieses vor dem Augenträger liegende Unbestimmte als die bloße Wiederholung des schon hinter ihm liegenden darstellte, - wenn man also, wie gegenwärtig von der Kunstkritik erfolgreich praktiziert - die Aussage ableitete, daß die Zukunft der Kunst oder eines Künstlers in seiner Vergangenheit liege.
Im Sinne unserer vorausgesetzten Überlegungen im Geleit der ungleichen Zwillinge konstatieren wir für das Spoerri'sche Objekt:
Erst das noch unbekannt und undurchschaut vor uns Liegende schafft uns eine Vergangenheit. Der Blick nach rückwärts verändert sich in der Bewegung des Schreitens durch die immer neue Position, die der Augenträger einnimmt. Deswegen folgt aus dem Blick rückwärts nicht eine eindeutige Rekonstruktion des bisher beschriebenen Weges - aus der sich zwangsläufig die nach vorwärts einzuschlagende Richtung ergäbe; sondern es entsteht eine Vielzahl einzelner Konstruktionen von Teilstrecken, die sich daran orientieren, wo der sich bewegende Augenträger gerade steht.
Dabei erinnern wir uns alle an jenes Erschrecken, das uns als Kinder erfaßte, wenn wir in einem unbekannten Areal plötzlich entdeckten, daß wir offensichtlich an jener Stelle bereits einmal gewesen waren, an der wir uns gerade eben objektiv planlos - subjektiv planvoll - suchend angekommen sahen. Je mehr wir herumirrten, desto sicherer wurden wir in der Beurteilung der Feststellung, hier - an diesem Punkte - seien wir bereits einmal gewesen - einmal oder gar mehrmals - was uns einzugestehen, unsere Unsicherheit nur noch vergrößerte. Alles, was uns blieb, war die Erkenntnis, daß man offensichtlich nichts ein für allemal hinter sich hat, daß man aber seine Hoffnung auf einen guten Ausgang aus der mißlichen Lage nur dadurch aufrechterhalten kann, daß man immer wieder zwischen dem hinter einem Liegenden und dem, worauf man sich zubewegen wollte, ohne es zu kennen, unterscheiden muß. Der gesuchte Weg ist also tatsächlich nur der, der auf etwas bisher Unbekanntes zuführt. Natürlich spreche auch ich jetzt hier in Bildern, analog zu dem Bildobjekt Spoerris. Die Analogie kann nicht restlos aufgehen, weil ich ja sonst, um auszudrücken, was ich sagen könnte, nur das Spoerri'sche Bildobjekt vorzuweisen brauchte. Erst in der Differenz, in der Abweichung von der Vorgabe erfüllt sich deren Gebrauchswert für mich. Aber - die Richtung der Abweichung ist völlig unbestimmt.
Was ich mit Verweis auf das Spoerri'sche Bildobjekt hätte sagen können, erfahre ich nur, wenn alles, was ich tatsächlich zu dem Objekt sage, dieses Objekt selbst nicht vollständig ausschöpft, ihm seine Befremdlichkeit und seine unerwarteten Aspekte nicht zu nehmen vermag. Das alltägliche Interpretationsverständnis, die Erarbeitung des Gebrauchswertes der Aussagen anderer für uns, will uns darauf festlegen, die Analogie unserer Aussagen zu den Vorgaben möglichst angemessen auszubilden - so, als könne man die eine Aussage in die andere identisch übertragen. Das schaffen nicht einmal Wissenschaftler, die eine Aussage aus einer künstlich eineindeutig gemachten Sprache in eine andere ebenso als eineindeutig vorgegebene übertragen wollen.
Weil diese identische Übertragung nicht möglich ist (dafür gibt es unter anderem auch einigermaßen bekannte neurophysiologische Bedingungen), deswegen hat jede Aussage - in welcher sprachlichen Gestalt auch immer - Aspekte der Inkommensurabilität, der Uneinholbarkeit, die wir normalerweise im Begriff der Autonomie eines Werkes zu würdigen versuchen.
Die Einwände gegen pädagogische Bemühungen in der Werk- Vermittlung sind tatsächlich berechtigt, solange dem angeleiteten Werk-Interpretanten dieser uneinholbare Anteil der Werke verschwiegen oder verniedlicht wird.
So führt denn kein Weg zurück an denselben Ort - in den gleichen Augenblick - auch, wenn sich an der materialen Erscheinung der Örtlichkeit, bzw. an der materialen Gestalt der historischen Werke inzwischen nichts geändert hat. Wenn wir, von Spoerris Objekt veranlaßt, sagen, daß erst sein unbekannter und undurchschaubarer Teil uns dazu zwingt, den Blick zurückzulenken - also auf historische Zeugnisse, mit denen wir in der Vergangenheit mehr oder weniger angstfrei ausgekommen sind - dann können wir diesen Blick zurück nicht als kindliche Flucht in die sicheren Gefilde der Tradition behaupten wollen, sondern als eine Neueroberung des gerade durch seine Vertrautheit schon ganz bedeutungslos Gewordenen für die Orientierung in der Gegenwart. Geschichte kann als wirksame nur in der jeweiligen Gegenwart von Lebenden in Erscheinung treten. Aber sie muß eben als Geschichte wirksam werden - und nicht als die Wiederholung des immer Gleichen.
Wohin läßt uns die Vielzahl der Spoerri'schen Werke blicken, welche kulturellen Bestände der Historie vermittelt uns der Kulturheros Spoerri? Durch die Wahl einer generellen Kennzeichnung für seine Objekte, nämlich als »Fallenbilder« unterschiedlichster Ausprägung, gibt uns Spoerri selber einen Fingerzeig.
Durch seine Werke eröffnet Spoerri uns die Möglichkeit, die »Trompe l'oeil«-Malerei - vor allem die des 17. Jahrhunderts - als in der Gegenwart wieder wirksame Geschichte der bildenden Kunst zu nutzen.
Bis zu Spoerri hin galt den meisten Fachleuten wie den Laien die »Augentäuschungs«-Malerei, speziell die des 17. Jahrhunderts, als reine Genre-Malerei, d.h. als eine anspruchslose Serienproduktion einer Bildformel. Für das Interesse, das sie dennoch fand, wurden u.a. ziemlich platte Begründungen angegeben, etwa die, daß das aufstrebende Bürgertum in den Niederlanden bildliche Vortäuschung einer Objektwelt zu repräsentativen Zwecken und zur Bestätigung ihrer bürgerlichen Weltsicht benötigten. Allen diesen Interpretationen war die Auffassung gemeinsam, als ginge es in der »Trompe l'oeil«-Malerei um eine tatsächliche Täuschung der Augen.
Von Spoerris Fallenbildern her ist die Einsicht unumgänglich, daß es dem Trompe l'oeil nicht um das Vortäuschen, sondern um das Durchschauen von Täuschungen ging.
Dieses Durchschauen gegebener Erscheinungsweisen bereitete intellektuelles Vergnügen bei ganz realem Erkenntnisgewinn: Schon seit der Antike war man der Tatsache auf der Spur, daß alle Menschen offensichtlich auf Grund der Arbeitsweise der menschlichen Wahrnehmung Täuschungen unterliegen - zum Beispiel den optischen Täuschungen. Im 15. Jahrhundert glaubte man, mit der Erfindung der Zentralperspektive eine Erklärung für diese Täuschungen gefunden zu haben. Man glaubte, die Täuschung sei zustande gekommen als Resultat einer nicht regelgerechten Darstellung eines Wahrnehmungsfeldes in den verschiedensten Abbildungen dieses Wahrnehmungsfeldes.
Aber - kaum war Raffael kalt, als sich im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts die später sogenannten Manieristen darüber klar wurden, daß die optischen Täuschungen sich auch in der Gestalt illusionärer Abbildungen nicht durch sogenannte wirklichkeits- gerechte bildliche Darstellungen aufheben ließen. Der Erkenntniswert der damaligen Kunst, aus dem sich dann auch ein naturwissenschaftliches Arbeiten begründete, war - so meinten die Manieristen - danach zu bemessen, in welchem Umfang eine bildliche Darstellung (das Concetto und die Maniera) vom Abgebildeten, den Gegenständen der Darstellung, unterschieden werden konnte; d.h. der Erkenntniswert erhöhte sich mit der im Kunstwerk in Erscheinung tretenden Differenz oder Nicht-Identität von Abbild und Abgebildetem.
Die Trompe l'oeil-Malerei treibt die Erfahrung dieser Differenz auf den Höhepunkt, sie ist also erkenntnistheoretisches Exerzitium. Für sie kam es nicht länger auf wie immer begründete Täuschungen und Illusionen an - sondern auf das Durchschauen der Illusionen und Täuschungen. Das Vanitas-Motiv, das in der Trompe l'oeil-Malerei sehr häufig ist, ist also nicht als eine banale Vergewisserung zu verstehen, das alles menschliche Streben eitel sei, im Sinne moralisierenden Tadels, sich nicht bereichern und hervortun zu sollen - vielmehr heißt das Vanitas-Motiv der Trompe l'oeil Malerei, daß wir uns immer der Tatsache bewußt zu sein hätten, bei unseren Urteilen über die Welt und ihren Zusammenhang auf dem äußerst schwankenden Boden unzureichender Wahrnehmung zu stehen.
Die Welt wie ihre einzelnen, von unserer Wahrnehmung erfaßten Segmente sind tatsächlich nicht das, was sie uns zu sein scheinen. Aus der Aufdeckung der Differenz zwischen dem, was wir wahrzunehmen glauben, und dem tatsächlich Gegebenen resultiert der Erkenntniswert der Trompe l'oeil-Malerei auch für bürgerliche Weltschöpfer, denen es vor allem darauf ankommen mußte, die Welt anders zu sehen, als sie etwa von christlich-theologischen Interpreten vorgestellt wurde.
Von Spoerris Fallenbild-Theorie her und der Art ihrer materialen Erscheinung in Werken entdecken wir an den Trompe l'oeil-Konzepten, daß es nicht darum gehen kann, mehr und mehr unsere Täuschungsanfälligkeit dadurch abzubauen, daß wir die täuschenden Darstellungen durch nicht-täuschende ersetzen. Das natur- und kulturgeschichtliche Erbe in unserer Wahrnehmung läßt sich nur dadurch beherrschen, daß wir uns stets der notwendigen Unzulänglichkeit unserer Wahrnehmungen bewußt sind - und also aus ihnen keine apodiktischen Urteile über etwas uns zur Wahrnehmung Angebotenes verleiten lassen.
Diese Berücksichtigung der Unzulänglichkeit unserer Wahrnehmung bezeichnen wir heute als Reflexivität des Denkens und damit der Reflexivität allen künstlerischen und wissenschaftlichen Tuns. Demzufolge wandten viele Trompe l'oeil-Maler (unter ihnen sei nur der vorzüglichste, also am stärksten reflexiv vorgehende Cornelis Gijsbrechts erwähnt) die Analyse der Augentäuschung auf ihr eigenes Metier, das der künstlerischen Bilderzeugung, an. Gijsbrechts arbeitete in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts vor allem am Kopenhagener Hof, weswegen noch heute einige seiner außerordentlichen Arbeiten im Staatlichen Museum in Kopenhagen aufbewahrt werden. Unter ihnen die zweidimensionale Darstellung der Rückseite eines Gemäldes - also die malerische Darstellung des Doppelrahmens, über den nach vorn die Leinwand gespannt ist. Doppelrahmen soll heißen, daß die gemalte Rückseite eines Gemäldes, an der noch die museale Ordnungsnummer befestigt erscheint, ihrerseits wieder in einem Rahmen repräsentiert ist. Dieser wird aber auch nur als Rückseite dargestellt, obwohl er vom optischen Eindruck her als Rahmen der Darstellung eines gerahmten Bildes erscheint.
In einem seiner Staffelei-Bilder stellt (ebenfalls in Kopenhagen) Gijsbrechts die Illusion eines Atelierraumes dar, in dem sich auf der Staffelei ein Früchtestilleben und davor Malstock und Pinsel, Palette, Spiegelmedaillon und die Karteikarte der Gemäldeklassifizierung befinden. An den Fuß der Staffelei ist ebenfalls die Rückseite eines bespannten Bilderrahmens gelehnt. Gemalt sind also: ein gemaltes Gemälde in einem gemalten und realen Raum, die Malutensilien und die Rückseite einer zu bemalenden, aufgespannten Leinwand.
Es geht dabei ganz offensichtlich eben nicht um die mit malerischen Mitteln erzeugte Vortäuschung eines für real gehaltenen Wahrnehmungsfeldes, sondern um die Reflektion über die Verfahrensweise der Erzeugung einer Bildwirkung. Durch diese Anordnung versucht Gijsbrechts, wie in fast allen seiner Arbeiten, den Betrachter auf dem schmalen Grad balancieren zu lassen, auf dem er im gleichen Augenblick die illusionistische Täuschung einerseits - und die Einsicht in die Täuschung andererseits - zu vergegenwärtigen vermag. (Endlich eine Gelegenheit, auch Timm Ulrichs lobend zu erwähnen: Er stellte die Rückseite des Gijsbrechtschen Gemäldes aus, das ein Bild - Rahmen und Leinwand - von hinten zeigt. Diese von Timm Ulrichs gezeigte Rückseite eines Gijsbrechtschen Gemäldes ist natürlich ihrerseits wiederum eine von hinten gesehene, über einen Rahmen gespannte Leinwand.) Auf einem in Boston befindlichen Vanitas-Gemälde von Gijsbrechts sieht man in einer dargestellten Illusion die üblichen Attribute der Vanitas (Totenschädel, Stundenglas usw.) in einer Nische aufgebaut. Zugleich aber zeigt das Gemälde die obere rechte Ecke der Leinwand so, als hinge sie vom Rahmen herunter, den man seinerseits als gemalten wahrnimmt. Das Herunterhängen der Leinwandecke ist so penetrant, so unübersehbar, daß der Betrachter die räumliche Illusion der Nische stets nur im vollen Bewußtsein ihres bloß illusionären Charakters wahrnehmen kann.
Das Konzept solchen Vorgehens ist so vielschichtig, daß ich selbst als Betrachter nicht mehr genau weiß, ob nun Gijsbrechts selber tatsächlich auf die gemalte Leinwand eine unbemalte, aber reale Leinwanddecke entsprechend befestigt hat, oder ob mir das nur als eine logische Entwicklung erscheint, die mir von Spoerris Fallenbildern des Fallenbildes aufgenötigt wurde. Diese Unsicherheit zeigt nur, in wie starkem Maße meine Sicht auf die angeblich ganz platte Genre-Malerei des Trompe l'oeil-Künstlers Gijsbrechts durch Spoerris Fallenbilder verändert wurde.
Ich will nicht zeusischer als Zeus sein - der sich (in der Darbietung des ausgeschlachteten Opfertieres) mit den ungenießbaren Teilen zufrieden gab, weil er die Täuschung zu durchschauen in der Lage gewesen war, und da sich hinter dem Vorgehen von Prometheus eine ganz vernünftige Überlegung entdecken ließ: das Opfer für die Götter wird zu einem gut begründbaren Anlaß, die kostbaren Tiere zu schlachten - und deren besseren Teil selber zu verzehren. Deshalb will ich die Frage nach dem Rang solcher Trompe l'oeils als Kunstwerke nur in der Hinsicht beantworten, daß sie mir einen erheblichen intellektuellen Genuß, den der Einsicht in meine eigene Art von Beschränktheit, gewähren. Was immer sie über das hinaus, was ich mit ihnen anzufangen weiß, auch noch sein mögen, lasse ich dahingestellt, das wissen die Götter. Das gilt natürlich auch für die Spoerri‘schen Arbeiten als Kunstwerke. Was die Spoerri'schen Fallenbilder aber als Untersuchung unserer von Natur und Kultur geformten Wahrnehmungen leisten, das meine ich zu wissen. Die immer schon vorgeformte Wahrnehmung stellt uns Fallen, die wir kennen müssen, um im Denken nicht nur den Mechanismus unseres Weltbildapparates rasseln zu lassen. Die demonstrativ in die Tafelbildebene gekippten Ensembles von Alltagsdingen lehren uns zu erkennen, in welch' hohem Maße für uns Begriffsbildungen (z. B: »Kunstwerk«) reine Konventionen sein müssen - bloße Verabredungsbegriffe, die wir ganz sinnlos anwenden würden, wenn wir behaupteten, etwas ein Kunstwerk zu nennen, bedeute bereits, einen prinzipiell anderen Objektcharakter für Kunstwerke als für alle anderen Objekte reklamieren zu dürfen.
Die wechselseitige Beziehung und die rücksichtslose Konfrontation von Bildbegriffen und Wortbegriffen in den Fallenbildern gibt uns zu bedenken, daß Wortsprachen und Bildsprachen nicht ineinander überführt werden können, sondern notwendigerweise Bestandteile ein- und desselben Prozesses sprachlich repräsentierter Gedankenarbeit sind. Diese Prozesse würden erheblich anders verlaufen, wenn - wie in einigen Fallenbildern demonstriert - das Wahrnehmungsorgan Auge (etwa durch Blendung) ausfiele.
Ganz wesentlich haben Spoerri‘sche Fallenbilder dazu beigetragen, die Leistungsfähigkeit von Allegorien, d.h. dinghafte Repräsentation abstrakter Begriffe, wieder zu erkennen, nachdem vor allem die sogenannte »abstrakte Kunst« behauptet hatte, die Allegorese gehöre primitiven Stufen sprachlicher Repräsentation des Denkens an.
Im Typus des Fallenbildes als Kunstmultiplikator wird geklärt, in wie hohem Maße unsere Erwartungen gegenüber bildender Kunst am Spiegelungsmotiv ausgebildet und dadurch untauglich gemacht worden sind.
Andere Typen der Fallenbilder lassen uns bemerkbar werden, wie weitgehend unsere Ordnungsvorstellungen im Bereich des Sichtbaren von Symmetrie-Erwartungen geprägt werden. Die von Spoerri in diesem Typus subtil vorgeführten Störungen von Symmetrien kritisieren Forderungen nach rein formaler Ausbalancierung optischer Eindrücke in einem Wahrnehmungsfeld, die zu lasten genauen Hinsehens gehen. Schließlich und endlich bleibt zu betonen, daß genau jene Eigenschaft vieler Spoerri'scher Arbeiten philosophische Würdigung verdiente, die ihr normalerweise als dadaistische Würdelosigkeit vorgeworfen wird: daß sie Bild-, Wort- und Objektwitze sein wollten.
Sie sind es. Denn derartige Witze entstehen ja nicht aus der plötzlich sich erschließenden Einsicht, daß nur die ungewollten Mißverständnisse und ihre Folgen uns auf die Spur der Wahrheit bringen. Wahrheit aber, im Sinne der Trompe l'oeil- und Fallenbild- Vanitas verstanden: die Wahrheit ist, daß wir uns auf sie nur berufen dürfen, um jeden konkret geäußerten Anspruch auf die Wahrheit kritisch abwehren zu können.
Angefangen hat das alles für mich durch eine denkwürdige Konstellation im Landestheater Darmstadt, 1958. Sellner als Intendant, Bremer als Chefdramaturg, Spoerri als Regie-Assistent, Emmet Williams als Redakteur von »Stars und Stripes« - und ich als Adlatus und Programmheftschreiber von Claus Bremer. Ich betrat die Spoerri'sche Wohnung und sah in einiger Distanz vor mir vier an Waden hängende Füße paarweise so angeordnet wie auf der bekannten Bild-Witz-Karte. Der Inbegriff lebendiger Selbstwahrnehmung wie angenagelt, wie in Zement gegossen; keine Reaktion auf den Eintretenden und auf eine über die nackten Waden laufende Fliege. Dann fuhr mich Spoerri auf einem Motorrad von Darmstadt nach Frankfurt. Er erzählte von Yves Kleins Aktionen in Blau; der Fahrtwind trug Spoerris Erzählung aus dem seitwärts zu mir gewandten Mund als blauen Schleier, der in den Kornfeldern einige Blumen blau färbte. Ich konnte vor Geschwindigkeitsangst einige Tröpfchen nicht halten und entdeckte später, daß meine Hose blau gezeichnet war wie die der Teilnehmer an Yves Kleins Pariser Demonstration; die Herren und Damen mußten beim Auskleiden feststellen, daß das ihnen verabreichte Getränk sie tatsächlich in der Wolle blau gefärbt hatte.
Gegenüber dem Café in Frankfurt, in dem wir Kuchen zerbröselten, lief zur Demonstration des technischen Fortschritts ein Motorradfahrer mit Sozius auf einem Fließband. Wir standen wie angenagelt vor der Bewegung in voller Fahrt, die doch nicht vom Flecke führte. Dann fuhr ich nach Paris - der norddeutsche Provinzler - zu Spoerri in die Rue Mouffetard. Ich sah zum ersten Mal einen Mann mit unvorstellbarer Selbstverständlichkeit in ein Waschbecken pinkeln - dabei das Gespräch kaum unterbrechend. Während ich den Blick irritiert zur Seite abwandte, stieß ich auf eine an der Wand hängende Tafel, die offensichtlich kurz zuvor als Tisch gedient hatte.
Tassen und Gläser, Zigarettenschachteln und Messer versuchten in voller Fahrt, den Gesetzen der Schwerkraft zu genügen; sie teilten ihren Bewegungsimpuls deutlich mit - und kamen doch nicht vom Fleck. Sie waren ihrer hölzernen Unterlage auf immer verpflichtet. Das Umkippen der bestückten Tischplatte von der Horizontale in die Vertikale der gewohnten Bildpräsentation setzte sich in einem imaginären Bewegungsstrom gegen die Decke hin fort. Der Raum begann zu kippen; man stand auf den Wänden, schaute durch den Fußboden hinaus und lehnte den Ellenbogen an die Decke, aus der das Lampengestänge erigierte: Dulaby, wie es Spoerri 1963 in Amsterdam realisierte. Und Spoerri begann vorzulesen - aus einem kleinen, grauen Heftchen, der »Topographie anecdote du hasard«. Zu jedem der auf der Stelle rasenden Objekte, die den Bewegungsimpuls ihres ursprünglichen Benutzers ausdauernd wiederholten, erzählte die Topographie eine Anekdote (von heute aus gesehen, war das der Beginn der Spurensicherung).
Spoerri spielte ein Tonband vor, auf dem sich Claus Bremer und er selbst vor ununterbrochenem Lachen kaum dazu bringen konnten, einige zusammenhängende Sätze zu formulieren. Die beiden hatten sich nämlich hingesetzt, um epimetheisch in die Vielzahl der von Spoerri in die Welt gesetzten Objekte einen entsprechenden Gedanken zu bringen, um das unkalkulierbare Desaster des Unerwarteten zu bändigen, das durch die Spoerri'schen Produktionen angerichtet worden war. Heute nachzulesen in der »Theorie des Fallenbildes« in ihren 17 Differenzierungen.
Mir kam das so vor, als hätte ich an der Schöpfung der Welt teilgenommen. Begeistert versuchte ich, dies Spoerri gegenüber auszudrücken. Ich meinte, er könne sich zurückziehen wie Duchamp und wie Gott persönlich, um Schach zu spielen, spazieren zu gehen oder faul in fernen Dunstwolken dahinzutreiben. Schlagartig war mir klar geworden, daß Spoerri von seinen spontanen Setzungen her Geschichte geschrieben hatte. Eben nicht nur Geschichte der Gegenwartskunst, sondern auch die Geschichte der Trompe l'oeil-Malerei des 17. Jahrhunderts.
Aber Spoerri wollte nicht Duchamp oder Gott spielen, er verstand meine Begeisterung über seine Leistung falsch. Das heißt, er verstand sie als Verweis aus der Avantgarde. Deswegen sahen wir uns jahrelang nicht mehr.
Während seines Schweigens begannen sich mir die angeblichen Stillleben als stillgestelltes Leben aufzuschließen: die beseelten Objekte, gefesselt im Prozeß ihrer chaotischen - also zufälligen - Verteilung über die Welt. Selbst die Cezanne'schen Äpfel schienen noch über die Tischkante zu Boden fallen zu wollen. Anstelle des Prometheus hingen nun die Resultate des durch ihn ermöglichten schöpferischen menschlichen Tuns gefesselt auf ihren Unterlagen, eingeschlossen in Räume, an deren Türen Spoerri das Schild »Attention oeuvre d'art« wie eine Zellennummer angeschrieben hatte. Wir Betrachter sahen uns plötzlich in die Rolle der Aasgeier versetzt, die der gefesselten Dingwelt häppchenweise einen Teil ihres Wesens zu entreißen versuchten; und wir benutzten dabei die wahrnehmende Betrachtung als Erscheinungen zerfetzende Adlerklaue.
Brauchbarer als Spoerri und Bremer es getan haben, läßt sich die Spoerri'sche Fallenbild-Theorie nicht darstellen. Die Zuordnung ihrer einzelnen Positionen zum Werk Spoerris ist unmittelbar evident (siehe Abbildungen). Ich verzichte deshalb hier darauf, sie zu wiederholen. Auch, wenn diese Wiederholung zwangsläufig zu einigen vielleicht interessanten Abweichungen führen würde. Ich gehe deshalb zu einem anderen Leistungsbeweis Spoerri'scher Arbeiten weiter.
In den 70er Jahren begann Spoerri damit, über die Analyse unserer bedingten Wahrnehmungen hinaus auch Formen unserer Weltaneignung, so weit sie in der Tätigkeit des Sammlers bemerkbar wird, zu untersuchen. Hatte er für die Fallenbilder als Ausgangsmaterial den von ihm selbst gestalteten Objektbereich gewählt, so ließ er sich jetzt auf Objekte ein, zu deren Hervorbringung er selbst nichts beigetragen hatte, außer, sie wahrzunehmen, wozu ihn die am Fallenbild-Problem trainierte Wahrnehmungsfähigkeit prädestinierte.
Die bisher umfangreichste Untersuchung zum sammelnden Aneignen der Dinge hat er - mit Unterstützung von Marie Louise Plessen - als das »Musée sentimentale de Cologne« realisiert. Im zeitgenössischen Selbstverständnis wissenschaftlicher, musealer Konstruktion von Ordnungen der Dinge erschien Spoerris Ordnung (von Objekten der kulturgeschichtlichen Topographie »Köln«) völlig aberwitzig, also nicht ernst zu nehmen. Zwar hatten auch einige Spurensicherer ähnliche Objektsammlungen präsentiert, aber die Beiläufigkeit jener Objekte erzwang keine Reaktion durch die professionellen Objektsammler und Objektordner . Dadurch, daß Spoerri auch auf Objektcharaktere einging, die normalerweise in ganz anderen Positionszuordnungen in den wissenschaftlich geführten Museen vorkommen, wurden die Wissenschaftler zu Reaktionen gezwungen, die außerordentlich aufschlußreich sind. Anstatt sich der zunächst unerwarteten und undurchschaubaren - also neuen - Vorgehensweise Spoerris auszuliefern, und unter dem Druck dieser Zumutung die Geschichte des Sammelns als einer Kulturtechnik in neuer Weise anzueignen, stellten diese Wissenschaftler nur fest, daß das Spoerri'sche Vorgehen ihren eigenen Standards nicht genügte.
Ich habe im Katalog der Kölner Ausstellung darzustellen versucht, welche historischen Formen der sammelnden Aneignung man von Spoerris Vorgehensweise her wie neu entdecken kann: nämlich die Präsentationsform der Kunst- und Wunderkammern des 16. und 17. Jahrhunderts.
Museen als Präsentationen heute wissenschaftlich anerkannter Ordnungen der Dinge gibt es ja erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Wer die Kulturgeschichte als immer weiter voranschreitendes Erfüllen eines ursprünglichen Planes - also prometheisch - versteht, für den sind historische Formen der sammelnden Aneignung vor der Etablierung der heutigen Museumstypen uninteressant geworden. Von Spoerris Vorgehen her werden nun aber wieder die Ordnungsprinzipien von Kunst- und Wunderkammern in unserer Gegenwart aktuell. Das bedeutet keineswegs, daß Spoerri - und wir mit ihm - das tatsächliche Selbstverständnis der historischen Einrichter der Kunst- und Wunderkammern vergewaltigten - und sie unangemessen aktualisierten. Das ließe sich nur behaupten, wenn es Instanzen gäbe, die verbindlich anhand eindeutiger Quellen feststellen könnten, welches denn nun das tatsächliche Selbstverständnis der historischen Sammler gewesen ist.
Aber auch das Lesen eindeutigster historischer Quellen kann immer nur eine Interpretation von heute her sein; die Eindeutigkeit der Quellen ergibt noch kein eindeutiges Verstehen. Davon kann man sich ja leicht überzeugen, wenn man die verschiedenen Verständnisse ein- und derselben zeitgenössischen Quellen durch Zeitgenossen zur Kenntnis nimmt, z. B. bei Gericht. Wenn Elisabeth Scheicher in ihrer neuesten Arbeit über die Kunst- und Wunderkammern der Habsburger meint, daß sich heutige Künstler (wie Spoerri) zu Unrecht auf die Kunst- und Wunderkammern beriefen, ja, daß deren Präsentationen »manchen Objektemachern unserer Tage gewisse Zweifel an der revolutionären Effizienz ihres Tuns verursachen müßten«, dann verkennt diese Kritik, daß Spoerri sich nicht auf die Kunst- und Wunderkammern in nachträglich rationalisierender Weise - also das eigene Tun rechtfertigend und überhöhend - beruft, sondern daß sich aus dem Spoerri'schen Vorgehen, nach Rückwärts, eine neue Sicht, eine heute wirksame Sicht auf die Kunst- und Wunderkammern ergibt.
Die Kunst- und Wunderkammern begründen und erhöhen nicht mit ihren Objekten und Ordnungsgesichtspunkten die Arbeiten Spoerris (so, als setzte er eine Tradition fort - dann müßten allerdings dem Spoerri Zweifel an seiner Effizienz kommen); sondern, von Spoerris Vorgehen her wird eine neue Tradition der Aneignung von Welt begründet, für die Kunst- und Wunderkammern ein Beispiel geworden sind.
Das gegenwärtige Interesse an den Kunst- und Wunderkammern - auch bei Wissenschaftlern - ist eine Konsequenz des heutigen Vorgehens von Künstlern wie Spoerri, und nicht umgekehrt; Vorgehensweisen wie die Spoerris sind nicht gegenwärtige Fortsetzungen der alten Kunst- und Wunderkammern.
Wie ich zu Anfang sagte, wollte ich Bemerkungen zu Spoerri als Kulturheros machen - und nicht zu Spoerri als Künstler. Die Arbeit des Kulturheros darf täglich daraufhin angesehen werden, was sie uns für die Bewältigung unserer eigenen Lebensanstrengung bringt. In dieser Hinsicht Kunstwerke zu betrachten, wäre eine starke Einschränkung ihres Wirkungsanspruchs. Es ging mir also um den Hinweis darauf, daß Künstler wie Spoerri uns die Möglichkeit bieten, die von ihnen im Kunst-Kontext entwickelten Wahrnehmungs-und Aneignungsformen als Kulturtechniken für das Alltagsleben zu nutzen.
Von einer dritten durch Spoerri wieder neu thematisierten Kulturtechnik habe ich hier gar nicht sprechen können: der der Transformation der Dinge durch ihre Zubereitung als Speisen. Von den zahlreichen durch Spoerri inszenierten Festmahlen in Galerien und Museen nötigt sich uns eine erneute Thematisierung der Kulturtechnik »Kochen« auf, die wir durch ihre alltägliche Selbstverständlichkeit bis zur Bedeutungslosigkeit haben herabsinken lassen. Die Leistung Spoerris für eine Neubestimmung der Transformation als Kulturtechnik harrt noch einer auch bloß andeutungsweisen Darstellung.
Wenn ich wüßte, was Zeus seinem Adler zurief, damit der auf den gefesselten Prometheus stürze, dann würde ich diesen Zuruf nun ans Publikum richten, um dazu aufzufordern, von Spoerris Angebot einen möglichst vieldeutigen Gebrauch zu machen. Wie Prometheus auf den Angriff des Adlers reagierte, wissen wir. Er stieß den ersten, entsetzlich stummen Schrei aus, den heute noch alle Künstler wiederholen, wenn sie das raubgierige Publikum auf sich zukommen sehen.
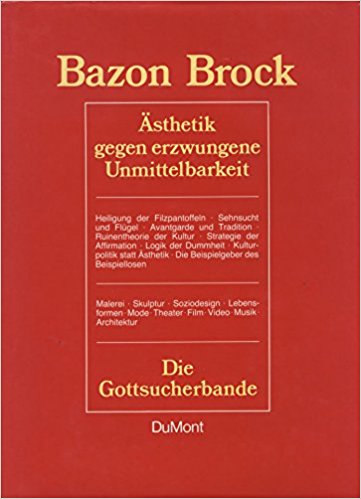 + 1 Bild
+ 1 Bild
