Überarbeiteter Text, gekürzte Fassung des Ursprungstextes In: Bazon Brock: Ästhetik gegen erzwungene Unmittelbarkeit. Berlin 1986, S. 24.
Warum äußert sich das Höchste jetzt so oft als falsche Tendenz? Weil niemand sich selbst verstehen kann, der seine Genossen nicht versteht. Ihr müßt also erst glauben, daß Ihr nicht allein seid, Ihr müßt überall unendlich viel ahnen und nicht müde werden, den Sinn zu bilden, bis Ihr zuletzt das Ursprüngliche und Wesentliche gefunden habt. Dann wird Euch der Genius der Zeit erscheinen und wird Euch leise andeuten, was schicklich sei und was nicht.
(Friedrich Schlegel, Athenaeums-Fragmente)
Das Höchste, das jetzt so oft als falsche Tendenz sich äußert, ist der willkürliche Kraftakt der Selbsttranszendierung, mit dem – so will es scheinen – eine ganze Künstlergeneration unserer Republik sich aus den historisch erzwungenen Selbstbeschränkungen auf den Normalfall zu befreien versucht.
Mit der Politik der Ekstase, die in der Apokalypse des Nationalsozialismus untergegangen zu sein schien, glaubte man auch die Kunst der Ekstase, den Heroismus und Monumentalismus des sich selbst übergipfelnden Daseins (Arno Breker) als historisch überwundene Haltung der Künstler erledigt. Sie war es nicht, und sie ist es nicht, insofern es gerade den fähigen Künstlern schwerlich zugemutet werden kann, auf den Ausdruck des Höchsten, und das heißt ja wohl – wie bei Schlegel – auf den Ausdruck der höchsten Zielsetzung für menschliches Handeln zu verzichten. Ganz allgemein kann dieses höchste Ziel wohl darin geahnt werden, die individuellen wie die allgemein menschlichen Bedingtheiten des Daseins auf Erden hinter sich zu lassen, also zu transzendieren.
Die westlich-mittelmeerische Kultur hat im Laufe ihrer Geschichte nur einige wenige Konzepte und Strategien der Transzendierung des sterblichen Menschleins (Petrarca) prämiiert: das Selbstopfer für andere Menschen; das Martyrium für Glaubens- und Wissensbekenntnisse; das Virtuosentum als Ausbildung extremer und seltener Fähigkeiten; das Herostratentum als Auslösung unvergeßlicher Schrecken; den Titanismus staatengründender und werketürmender Schöpferkraft. Das jedenfalls waren für uns die dominierenden Konzepte und Strategien der menschlichen Selbsttranszendierung.
Erst gegenwärtig lernen wir, eine vornehmlich in anderen Kulturen entwickelte Haltung zu verstehen und damit auch in unserer eigenen Geschichte wiederzuentdecken: den Heroismus des Nichtstuns, den Heroismus des Verzichts auf die große Tat, das Pathos der Prätentionslosigkeit. Erst jüngst? War nicht das, wenn es überhaupt eine tragende Größe des bundesrepublikanischen Nachkriegsdeutschland gegeben hat, ihre bemerkenswerte Leistung, sich im Prinzipiellen bescheiden zu wollen, nach Möglichkeit restaurativen Großmachtillusionen zumindest seit Ende der 50er Jahre abzuschwören? War es nicht Zeichen der Reife, dem repräsentativen Durchschnitt und nicht vermeintlichen Eliten den Aufbau einer parlamentarischen Demokratie abzuverlangen? Waren wir alle nicht eben nur insofern bedeutende Zeitgenossen, als wir uns willentlich für ein Mainzelmännchendasein entschieden, also darauf verzichteten, uns als Weltenschöpfer und Geistestäter zu heroisieren?
Wenn uns etwas heilig sein konnte, dann waren es die banalen, die unauffällig alltäglichen Dinge. – Wer selbst miterlebt hatte, wie wenig selbstverständlich das Selbstverständliche ist, brachte dem Wunder des Normalzustandes in Ruhe und Ordnung und äußerster Ereignislosigkeit gern das Opfer heldischer Größe. Heilig der Mann, der nichts Großes will, um seine Mordlust zu rechtfertigen. Heilig der Provinzialismus, die selbstgenügsame Beschränkung aufs Nächstliegende. Heilig die Filzpantoffeln, in denen man nicht schneller sein kann als der letzte Krüppel. Heilig der sinnierende Blick und die Hände im Schoß. Heilig das matte Blatt, dem kein Gärtner droht, es zu pflegen. Heilig, was geht, wie es immer ging und nicht wünscht, anders zu gehen. Small is beautiful (Fritz Schumacher); gerechtfertigt ist nur der kleinstmögliche Eingriff (Lucius Burckhardt); der Abschied vom Prinzipiellen (Odo Marquardt) ist unumgänglich, soll im Prinzip nicht das Ganze untergehen.
Systematisch waren uns diese Positionen bereits durch Kant entwickelt worden mit der frappierenden und bis heute kaum akzeptierten Schlußfolgerung des humanen Skeptizismus, daß die einzige Form des rechtfertigbaren Verlangens nach Selbsttranszendierung die Annerkenntnis der unendlichen Beschränktheit menschlichen Vermögens ist. Nur im Eingeständnis von niemals abarbeitbaren Vorurteilen, von unkontrollierbaren Emotionen, von immer nur durch neue ersetzbaren Konventionen des Denkens, vermögen wir zu ahnen, daß uns alles Wesentliche fehlt, um mehr zu sein, als wir sind. Wer das ahnt und es für sich gelten läßt, dem gestehen wir Größe zu.
Das Grundgesetz des intellektuellen Nachkriegsdeutschland
Natürlich kann bezweifelt werden, ob alle Mainzelmännchen im Schauder dieser Ahnung ihre Filzpantoffeln heiligten; bewußt sollte uns jedoch sein, daß auch der größte Teil der Herostraten, der Titanen, der Virtuosen und vor allem der Selbstopfer in schaudermachender Ahnungslosigkeit den Weg in die Unsterblichkeit antraten. Solchen Helden bescheinigte Nietzsche, notwendigerweise einen beschränkten Horizont haben zu müssen; und die allgemeine Warnung vor zu gründlichem Nachdenken, weil es handlungsimpotent mache, stützt die Skepsis vor dem Heroismus der großen Tat. Freilich darf man den Skeptizismus nicht so weit treiben, daß er seinerseits prinzipiell wird, um als heroischer Nihilismus das Interesse am Menschen und seiner Geschichte auf Erden zu einem bestenfalls unterhaltsamen Zwischenakt der Naturgeschichte umzudichten.
Für die tatsächlich großen Mainzelmännchen gab Günter Eich in den Abgelegenen Gehöften (1948) einen unüberbietbar klaren Hinweis auf die Möglichkeit, wie das Höchste in einer für sie allein möglichen richtigen Tendenz zu äußern sei.
Aurora, Morgenröthe.
Du lebst, oh Göttin, noch!
Der Schall der Weidenflöte
tönt aus dem Haldenloch.
Wenn sich das Herz entzündet,
belebt sich Klang und Schein,
Ruhr oder Wupper mündet
in die Ägäis ein.
Dir braust ins Ohr die Welle
vom ewgen Mittelmeer.
Du selber bist die Stelle
von aller Wiederkehr.
In Kürbis und in Rüben
wächst Rom und Attika,
Gruß dir, du Gruß von drüben,
wo einst die Welt geschah.
Wann und woran entzündet sich das Herz? Wann wird man selber zur Stelle aller Wiederkehr? Eben dann, wenn man nicht in Speerschem Heroismus Mauern türmt oder auf dem Weg zu Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten Mauern stürzen läßt, sondern wenn man in Kürbis und Rüben, in einer Kokshalde, auf dem dreckigen Rinnsal der Wupper Rom und Attika, also geschichtliche Größe erinnern kann. Solche Erinnerungen an das, was wir nicht sind und nicht sein können, was die Menschheit ein für allemal verlor und nur als Verlorenes sich gegenwärtig halten kann, entzündet das Herz und läßt im Ohr die Welle des ewigen Mittelmeeres brausen. Kürbis, Rüben, Wupper, Kokshalde, also das Banalste, das Alltäglichste, das Unauffälligste, das Selbstverständlichste gilt es ernst zu nehmen, ja zu heiligen, so lautete Günter Eichs Grundgesetz des intellektuellen Nachkriegsdeutschland. In ihm wurde das Höchste als objektive Tendenz faßbar.
Sehnsucht nach heldischem Dasein
Jetzt treten wir pathetisch gegen die Mainzelmännchen an wie Don Quichotte gegen seine Hirngespinste. Jetzt polemisieren wir im Namen höchster Zielsetzungen gegen das Herunterdemokratisieren des Niveaus, bringen Hurras auf eiserne Kanzler und Ladies aus, weil deren Horizont beschränkt genug ist, mit einem Prinzip radikal ernst zu machen. Unsere Sehnsucht nach dem heldischen Dasein ist verständlich, da wir so phantasielos sind, daß wir mit dem Banalen, Alltäglichen und Selbstverständlichen nicht auszukommen vermögen. Unsere Sehnsucht danach, aus der Anonymität aufzuragen und als Schöpfer und Führer anerkannt und verehrt zu werden, wäre verständlich, weil allzu menschlich – tatsächlich reichen wir aber an dieses Allgemeine gar nicht heran. Das enthüllen die Konsequenzen, die wir aus der für uns inzwischen unbestreitbaren Tatsache ziehen, daß es mehr Dichter als Kenner, mehr bildende Künstler als Bildkäufer, mehr Professoren als begabte Studenten, mehr Biographien als große Menschen gibt.
Wir trumpfen auf: Unser Interesse am Zerstörungselement mißtraut einem Literaturverständnis, das Literatur heimlich zur Lebenshilfe macht, den Schriftsteller als Sinnproduzenten mißbraucht und pathetische Identifikationen zwischen einem heroisch verstandenen Künstler und dem sein Vorbild suchenden Leser herstellt. Wo aber könnte diese falsche Sinngebung...am besten buchstäblich widerlegt werden als dort, wo Literatur zur Vorbereitung des Selbstmords wird?...Verlassen wir also die harmonisierende Systematik geistesgeschichtlicher oder existentieller Verformungen des Selbstmords und halten uns an die ursprüngliche und brutal formulierte Betroffenheit Achim von Arnims, der nach dem Tode Kleists... schrieb: Es ist ein Tod wie Wolfdietrich, als ihn die Gerippe aller derer totschlagen, die er einst selbst umgebracht hatte. Das ist der erste Hinweis für unser Interesse, den Selbstmord in Kleists Prosa selbst vorbereitet zu sehen, einer Prosa, die mörderisch ist, weil das Schrecklichste gelassen, kalt und unbeteiligt vorgetragen wird, eine verborgene Komplizenschaft des Autors ahnen lassend.
(1)
Geht man über die kuriose Logik des Arguments auf das ein, was gemeint sein könnte (denn Literatur als Lebenshilfe zu bespötteln, um Literatur als Sterbehilfe für interessant zu halten, darf wohl als rabulistische Krautjunkerei übergangen werden), dann heißt das Programm, der Künstler habe sich mit seiner eigenen Fiktion, seinem eigenen Werk zu identifizieren. Im Unterschied zum Leser, der sein Vorbild sucht, geht der Künstler mit seinem eigenen Werk eine verborgene Komplizenschaft ein – wie der Priester mit seinem Gott, wie das Opfer mit dem Täter! Wenn das keine Heroisierung des Künstlers sein soll, bleibt sein Werk immerhin auch bloß Lebenshilfe für ihn selbst, respektive Sterbehilfe. Der Schreiber übersieht zugunsten eigener Selbstüberhöhung, daß sich gerade der Durchschnittsleser am liebsten mit den Verfassern von Prosa identifiziert, die mörderisch ist, weil sie das Schreckliche gelassen, kalt und unbeteiligt vorträgt und eine verborgene Komplizenschaft des Lesers ahnen läßt.
Jede Tageszeitung trägt heute das Schrecklichste gelassen, kalt und unbeteiligt vor, und die Herren Schreiber gestehen ihre Komplizenschaft ganz offen ein. Regierungsamtliche Verlautbarungen, Urteilsbegründungen, Expertenverträge, Politprogramme zeigen längst jene hier noch als extrem interessante Besonderheit künstlerischer Prosa gepriesene schreckliche Kälte, verfaßt von Komplizen, die sich vor allem etwas darauf zugute halten, ohne philosophische, dichterische, künstlerische Sinngebung auszukommen. Gegen die Leser zu polemisieren, die sich mit Künstlern zu identifizieren versuchen, indem sie diese ihre Vorbilder zu mitleidensfähigen (pathetischen) Heroen überhöhen, solche Polemik darf sich nur zugute halten, wer sich der mörderischen Prosa von Justiz und Journaille, von hochmütigen Ämtern und bornierten Wissenschaftsfunktionären nicht aussetzen muß, weil er deren Komplize ist. Die häufig unbestreitbare Naivität eines Literatur als Lebenshilfe in Anspruch nehmenden Lesers geht um keinen Deut weiter als die Weltfremdheit unseres Schreibers, der mörderisch kalte Prosa den Dichtern vorbehalten möchte.
Mit einer solchen Konsequenz den heroischen Radikalismus der Dichter und Künstler unseren Mainzelmännchengemütern entgegensetzen zu wollen, bleibt unter den allgemeinsten Einsichten der Zeitgenossen über Schlagzeilen-Taten zurück, die man auch nur für eine Viertelstunde in Erinnerung behalten möchte. Daß ohnehin nicht mehr als eine Viertelstunde Ruhm für jeden von uns, trotz genialster Leistungen, herauskommen kann, hat uns Andy Warhol zwar zu bedenken gegeben, aber kaum einer hat ihm geglaubt. Auch hier ist das Unterhaltungsgewerbe aufgeklärter als die Schulen der Philosophie. Die Hitlisten interessieren niemanden mehr, wenn auf ihnen drei Wochen lang die gleichen Namen stehen.
Im vollen Ornat der Selbsterhöhung
Für das Höchste in falscher Tendenz, das heißt in falschen Schlußfolgerungen aus der allgemein menschlichen Sehnsucht nach Dauer der Verhältnisse, Größe und Ruhm, ist in folgender Schlußpassage eines heroischen Nihilisten jüngst ein sprechendes Beispiel veröffentlicht worden: Ermannen wir uns! Überführen wir sein (des Mondes) transzendentales Ideal in die sublunare Wirklichkeit! Vermonden wir unseren stoffwechselsiechen Planeten! Denn nicht bevor sich die Sichel des Trabanten hienieden in tausend Kraterseen spiegelt, nicht bevor Vor- und Nachbild, Mond und Welt, ununterscheidbar geworden sind und Quarzkristalle über den Abgrund einander zublinzeln im Sternenlicht, (...) wird wieder Eden sein auf Erden.
(2) Wer sprach je von einem solchen Eden? Warum aber dann sollte jener Zustand wieder ein Eden sein? Die deutsche Denk-Krampferei hat immer schon das hündische Anbellen des Mondes für den Ausdruck höchster Poesie gehalten, denn die heroischen Seelen waren immer schon vermondet. Solche Beschreibungen der eigenen intellektuellen und seelischen Verfassung in schamloser Offenheit als Ausdruck des Höchsten für die Menschheit, mit nachgerade barbarischem Stolz auf die eigene Unbedarftheit, vorzutragen, soll wohl der Selbstüberhöhung durch den Beweis dienen, kein Mensch mehr, sondern bereits ein Unmensch zu sein, ein interessantes, weil eiskaltes, mitleidloses und unberechenbares Untier geworden zu sein.
Aber wer weiß schon, was ihm eigentlich lieber ist, der Wolf im Schafspelz oder ein Schaf im Wolfspelz? Den künstlerisch interessierten Kanzlerkränzchen ganz sicherlich letzteres. Leider lehnt unser Autor beide Rollen für sich ab. Er nennt seine Auffassung schonungslos, wie nur ein wahrer Titan es gegen sich selbst sein darf, ohne Selbstzensur humaner Gefühlsduseleien. Er umhüllt sich mit der Gloriole eines Partisanen der anthropofugalen Résistance, der für die von ihm vertretene Wahrheit zwar Niederlagen, aber keine Kapitulation kennt. Seit den 60er Jahren ist trotz erbitterter humanistischer Störmanöver eine Phase erneuter Stabilisierung und Konsolidierung (des menschenflüchtigen, menschenverachtenden und menschennegierenden Denkens) zu verzeichnen, die darauf hoffen läßt, daß das Untier – wie es seiner Intelligenz gebührt – sehenden und verständigen Auges jenen apokalyptischen Streich gegen sich selbst und die mitleidende Kreatur führen wird, für den es sich seit dem 2. Vorbereitungskrieg so fieberhaft ertüchtigt. Dieses menschenzermalmende Denken tritt also, was seine Breitenwirkung angeht, von vornherein gar nicht in Konkurrenz zum Humanismus, den es als funktionales Sedativ der letzten Aufrüstungsphase durchschaut und in seiner Unvermeidlichkeit akzeptiert. Es definiert sich zu keinem Zeitpunkt als mehrheitsfähige Doktrin, als säkulare Religion oder weltanschaulichen Sozialkitt, sondern jederzeit als Minoritätenperspektive, als Philosophie einer kleinen exilierten Fraktion von Nachdenkenden.
(3)
Nun ist also der Krönungsornat des Selbsttranszendierers entworfen: In gemeinsamer Größe, wie nur wenige seinesgleichen, denkt er schonungslos ein Ende, dem er sich verpflichtet fühlt und dem sich alle anderen wimmelnden Kreaturen auf jede nur denkbare Weise zu entziehen versuchen. Er lächelt nicht, er leidet. Er kann nicht lächeln, da er sich seiner eigenen Lächerlichkeit nicht bewußt ist, wie er da als beamteter Professor im Faschingskostüm durchs Dickicht der Naherholungsgebiete schleicht, harmlose Spaziergänger durch Entblößung seines teuflischen Pferdefußes in Panik versetzend. So sahen bei uns immer schon die Heroen des Muts zur beispiellosen Konsequenz aus; aber wenn irgend jemand ihnen gegenüber das zu praktizieren drohte, was sie der gesamten Menschheit als Heilsplan angedeihen lassen wollten, entpuppten sie sich als vom Selbstmitleid geschüttelte Kinder: Es geschieht meiner Mutter ganz recht, wenn mir die Hände abfrieren; warum kauft sie mir keine Handschuhe! Vor fünfzig Jahren glorifizierte ein anderer Lehrstuhlinhaber das Untier in Person und Programm. Als das Schwarze Corps über ihn eine Kritik veröffentlichte, die nicht im entferntesten so radikal war, wie diese Leuchte der Wissenschaft sie gegenüber ihren Opfern schamlos – bis zur Auslöschung des Namens – in Dutzenden Fällen vorgetragen hatte, fühlte sich dieser Titan des radikalen Denkens, dieser Gigant des schonungslosen Zuendedenkens, dieser Heros reiner, vorbehaltloser Logik sogleich als Verfolgter des Nazi-Regimes.
Ein Ruf wie Donnerhall
Ein drittes Zeugnis für die falsche Tendenz, mit der die Elite der bundesrepublikanischen Intellektuellen, Schriftsteller und Künstler seit gut fünf Jahren sich aus dem Normalnull ihrer Existenz ekstatisch emporzureißen versucht, ihrem höchsten Ziel entgegen, der Erhebung zu Göttern: Heimat kommt auf (die doch keine Bleibe war), wenn ich in den Minima Moralia wieder lese. Wie gewissenhaft und prunkend gedacht wurde, noch zu meiner Zeit! Es ist, als seien seither mehrere Generationen vergangen. (Ohne Dialektik denken wir auf Anhieb dümmer; aber es muß sein: ohne sie!) Stattdessen begleiten uns nun einige jüngere Denker-Satiriker, die Ethno- und Anarcho-Essayisten, bei denen wir etwas unentwegt Naßforsches in Kauf nehmen müssen, diese kichernden Formverstöße gegen das starr Dogmatische der Marxisten, gegen den orthodoxen Lehrbetrieb überhaupt, in den sie sich als Anti-Köpfe gleichwohl viel zu sehr verbissen haben, als daß ihre Fantasie einen bescheidenen Aufschwung nehmen könnte. Wider das sich selbst erledigende Dämliche so viel Kraft zu vergeuden, das zeugt nicht von einem starken eigenen Wissensbegehr. Man macht keine eleganten Fechtübungen an Vogelscheuchen. Bloß gewitzigt sind diese Köpfe und in erster Linie Kritiker; nichts Entwerfendes, nichts Erfinderisches, weder Befreiendes noch Bestürzendes kommt uns von dort. Und solange kein Größerer das Sagen hat, wird uns dies freche Durcheinander unterhalten.
(4)
Als den Größeren, der an mehreren anderen Stellen des gleichen Textes ähnlich unverhüllt herbeigesehnt wird, sieht sich der Schreiber natürlich selber. Nur das Sagen hat er noch nicht, das Kommando, und insofern kann dieser Schreiber, wie eine Reihe seiner Kollegen, voller Überzeugung behaupten, sich selbst nur als die Täufer und Wegbereiter eines Kommenden verstehen zu wollen. Schluß mit dem frechen Durcheinander, Schluß mit der gewitzigten Kritik, Schluß mit dem dialektischen Denken. Die herbeigesehnten Größeren werden zweifellos die Dümmeren sein, wie der Schreiber mit der Selbstsicherheit aller Politfunktionäre des Jahrhunderts attestiert; denn sie können die Anmaßung, größer sein zu wollen – sie können vor allem ihren Anspruch auf Anerkennung nur durchsetzen, wenn sie dümmer sind, als es die Verkehrsformen einer repräsentativen Demokratie erlauben. Fassungslos steht das Mainzelmännchen vor diesem Dichter des Größten, der sein Entwicklungsziel darin sieht, dümmer zu werden, als er ohnehin immer schon sein muß; fassungslos wie vor dem Diktum des anthropofugalen Philosophen, daß wir ohne Humanität auf Anhieb radikaler denken. Vor dem sich selbst erledigenden Dämlichen braucht man in der Tat keine Kraft zu vergeuden. Aber der Haß aus Selbstmitleid, die Tötung aus Liebe, der Terror aus Tugendhaftigkeit erledigen sich eben nicht von selbst; ihnen hat vor allem der starke, eigene Wissensbegehr zu gelten, bis sich jedermann – wenigstens potentiell – als einen solchen Kriminellen aus verlorener Ehre ahnt.
Solche Ahnung ist durchaus bestürzend und befreiend; sie befreit von Allmachtsphantasien, die unsere Kulturheroen als Offenbarungen extraordinärer Geistesgröße vor sich hin phantasieren. Solche Leute müssen sich kichernde Formverstöße von Satirikern und Anarchisten gegen den orthodoxen Lehrbetrieb natürlich verbitten, denn ihrer eigenen Herausgehobenheit läßt sich ja nur im orthodoxen Lehrbetrieb angemessen huldigen. Als Huld empfiehlt der Schreiber, womit er selbst dem großen Dichter huldigt: Daß die hymnische Schönheit, wenn sie nur tief genug, auf dem krausesten Grund entsteht, zu jeder Zeit das höchste Ziel der Dichtung sei, die das Gerümpel sichtende Schönheit, davon möchte man sich immer aufs neue überzeugen, wenn man den Angstträumen des Alltags entfliehen will, in den geschredderten Formen der Gegenwartslyrik keinen Halt findet, wohl aber in den Rilkeschen Elegien. Auch daß die Entgleisung, der Schwulst einbezogen, als Gärstoff unerläßlich sind für die Fügung einer unvergleichlichen Zeile, für die Präzision des Triumphs, für die herrliche Ausstrahlung.
(5)
Herrlich, herrlich, herrlich! Triumph, Triumph, Triumph! Hymnisch, unvergleichlich, tief. Das Niveau dieses Anbetungspathos erreicht doch das tägliche Schriftgut der Nation mühelos, und den Entschluß, undialektisch, also dümmer zu denken, fassen die Gestalter der öffentlichen Meinung täglich aufs neue. Was also will unser Schreiber, wenn er mit derartigen Zielen zu prunken versucht? Warum kann er sich nicht damit zufriedengeben, die prunkvolle Größe des repräsentativen, statistisch erhobenen Mittelmaßes zu sein, als die er sich in seinem Dichten und Trachten, wie eben nur ausschnittweise zitiert, erweist? Was macht diese zweifellos begabtesten Generationsgenossen zu Spottfiguren aus Dreck und Feuer, was läßt sie zu gedankenlosen Nachbetern ehemals als großartig beweihräucherter Glaubensgewißheiten werden?
Die Lehre, auf die es mir ankommt, entnehme ich aber nicht den Regeln..., sondern der Begeisterung (nie im Rausch) – eben dem Gedicht – über Dinge, welche immer noch geltend sind: die Sonne, der Erdboden, die Flüsse, die Winde, die Bäume und Büsche, die Nutztiere, die Früchte (mit Körben und Krügen), die Geräte und Werkzeuge.
(6) Reizt es bloß, etwas trotzig zu behaupten, was selbst die Küchenmädchen nicht mehr singen würden, wenn es sie noch gäbe, und was auch die buntesten Illustrierten ihren Lesern nur noch von Zeit zu Zeit als Schlummertrunk zu verabreichen wagen? Warum empfiehlt da einer der erstrangigen Dichter, die Natur, den Erdboden, Flüsse, Winde, Bäume etc. als immer noch geltend anzubeten, obwohl auch der lebensfrömmste Zeitgenosse inzwischen keinen Spaziergang mehr absolviert, ohne wenigstens einen klagenden Seufzer über die Vergänglichkeit der Natur auszuhauchen? Natürlich weiß das jener Dichter, aber er hält sich gerade darin für groß, das nicht auch sehen und begreifen zu müssen, was jedermann sieht und begreift. Auch das ist nur Verbrämung der so geschmähten Mittelmäßigkeit, wie sie sich in dem Massenappell „Denk positiv!“ zur psychohygienischen Standardmaßnahme entwickelt hat.
Worauf sind diese Inhaber eines Lexikonplatzes unter Analphabeten, diese Raubritter unter Bettlern, diese Sitzriesen unter den Schreibtischtätern, diese Hampelmänner unter lauter Marionetten, diese altdeutschen Gartenzwerge inmitten der Mainzelmännchen stolz? Worauf bin ich stolz – und darf ich stolz sein als Künstler? – Auf den Entschluß, der mich auf ewig von allem Gemeinen absonderte und isolierte; auf das Werk, was alle Absicht göttlich überschreitet, und dessen Absicht keiner zu Ende lernen wird; auf die Fähigkeit, was mir entgegen ist, anzubeten; auf das Bewußtsein, das ich die Genossen in ihrer eigensten Wirksamkeit zu beleben vermag; daß alles, was sie bilden, Gewinn für mich ist. (Athenaeums-Fragmente)
Imitatio imitationis
Daß diese Bilanz Friedrich Schlegels bis auf eine winzige Abweichung heute noch und heute wieder den nur bruchstückhaft und andeutungsweise zitierten Zöglingen des Vergöttlichungs e. V., Bonn, den Akrobaten der Identifikation mit Helden, Heiligen, Genies und Weltverbrechern als Credo dienen kann, gibt uns einen Hinweis auf die Antriebe solcher Durchschnittsmenschen. Jedes Gespräch mit durchschnittlichen Motorradfans, Westernliebhabern, Möchtegernrichthofen oder Ersatzfürsten hat bisher ergeben, daß sie auf das gleiche stolz sind wie unsere Ausnahmekünstler. Wie sie sich mit 180 Sachen und brutalem Fahrstil von allen gemeinen Verkehrsteilnehmern absondern, und zwar in willkürlichem Entschluß; wie sie ihren Mutwillen zu inhumanen Taten treiben, deren Absicht kein Kriminialist und kein Sozialpsychologe zu Ende lernen kann; wie sie selbstverständlich bekunden, daß ihr Werk ihnen aus den Händen geglitten und über alle Absicht hinausgeschritten ist; wie sie das anbeten, was sie unterworfen hat und knechtet; wie sie als Mitglieder krimineller Banden die Wirksamkeit ihrer Genossen zu beleben vermögen und das, was ihre Genossen heranschaffen, als eigenen Gewinn in Anspruch nehmen, das ist eben die stolze Bilanz auch derer, aus deren Masse sich unsere Dichter und Künstlerhelden gerade erheben wollen.
Der kleine Unterschied, den es zu erinnern gilt? Das Anbeten kann deswegen wohl noch nicht wieder klappen, weil Deutschlands Geisteshelden nur sich selbst entgegen sind und also auch nur sich selbst anbeten können. Versteckt erst, indirekt wagt der eine oder andere unter den Zitierten, offen die Macht anzubeten. Auch in diesem Punkte sind die auf ihr Rowdytum stolzen, von ihrer Dummheit gestählten, durch ihre Gewissenlosigkeit unschuldigen Alltagskriminellen überlegen; sie beten nur die Macht an. Aber – die Bilanz Friedrich Schlegels ist ja keine vereinzelte Feststellung über Gewinn und Verlust, über Niederlagen und Siege, über Sein und Scheinen. Renate Liebenwein-Krämer hat in ihrer unerwartet aktuellen Studie über Säkularisierung und Sakralisierung (7) eine Reihe jener Hintergründe enthüllt, vor denen Friedrich Schlegel und die von ihm gemeinten Genossen Position bezogen. Die Sakralisierung der Herrscher und Helden, der Helden der Arbeit und der Künste, wird von ihr so analysiert und dargestellt, daß der großkotzigste und selbstüberheblichste Versuch, unser kümmerliches Dasein zu bestehen, doch auch wieder anrührt und bewegt.
Wenn beispielsweise Friedrich Schlegel und Novalis sich wechselseitig davon zu überzeugen suchen, daß jeweils der andere als Täufer oder Fels einer neuen Religion besser geeignet sei als er selber, dann wird diese Bücklingsgalanterie des Spätrokoko zwar einerseits zu einer Farce ganz und gar von Gott verlassener Idioten, andererseits aber veranschaulichen sie als lebendige Beispiele für uns das, was als objektive Tendenz das Zeitalter beherrschte und was sich im Augenblick wohl auch als beherrschende Tendenz unseres Zeitalters bemerkbar macht. Friedrich Schlegel hatte die Französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre und Goethes Wilhelm Meister in dieser Weise bestimmt. Was ihn selbst beherrschte, konnte er aus Autoreneitelkeit nicht zu einer bloß allgemeinen Tendenz ausschreiben; er wollte sich selbst auf den Spuren von Moses und Mohammed sehen, er wollte persönlich identifizierbarer Urheber einer neuen Religion sein, die sich aber doch bloß als eine verweltlichte Umschrift, eine auf innerweltliche, menschliche Arbeitsleistung reduzierte, gewissermaßen als ins Dichter- und Denkerwerk übersetzte Bibel erwies.
Die Kunst war doch bloß eine Fortsetzung der Religion mit anderen Überzeugungsmitteln. Dennoch: Selbst wollte sich der Künstler verdanken, was die Religion nur als geschichtliche Vermittlung anonymer Texte und Lieder, anonymer Rituale und Legitimationsformen vorgegeben hatte. Die Kunst wurde zu einer säkularisierten Kirche, als deren Priester sich die Kritiker und Intendanten, die Verleger und Pädagogen verstanden; einer säkularisierten Kirche, deren Propheten die Philosophen und Kunstwissenschaftler wurden; deren Apostel Dürer, Raffael, Dante und Shakespeare hießen; als deren Märtyrer und damit wichtigste Gruppierung sich die Künstler ins Buch der Geschichte, das neueste Testament, einzuschreiben versuchten, indem sie ihr Leben, ihre Gesundheit, ihr Glück und ihren Frieden dem Dienste an der Kunst rückhaltlos, bedenkenlos und vollständig opferten. Hatte Dürer sich noch als Christus darstellen können, so macht Renate Liebenwein-Krämer deutlich, um in aller Demut seine individuellen Fähigkeiten öffentlich auf die Gnade Gottes zurückzuführen und sich sichtbar in die Nachfolge Christi zu stellen, wobei sein Leiden ihn Christus immer ähnlicher macht, so traten nun, nach dem Programm Friedrich Schlegels, Künstler gleich dutzendweise in der Nachfolge Dürers oder Raffaels auf, wobei auch das stärkste Leiden des Imitators sein Werk dem Dürers oder Raffaels kaum ähnlicher werden ließ.
Die pathetische Inthronisierung der Kunst als Kirche, mit der dabei notwendigen strikten Ablehnung jeder wahren Kunst im Dienste von Kirchen und Kaisern, Kanonenkönigen und Krämern, mußte zu einer fast vollständigen Isolierung der Künstler in den autonomen Bezirken von Kaffeehäusern und Dachkammern führen. Wer sich in dieser selbstauferlegten Askese radikalen Künstlertums nicht glaubte am Leben erhalten zu können und verlockende Angebote der vier großen K’s akzeptierte, wurde als zweitrangiger Kunsthandwerker und Auftragskünstler stigmatisiert. Aber diese Geächteten, diese vermeintlich schlecht Weggekommenen, denen ihre hohepriesterlichen Kollegen und Autoritäten die Anerkennung versagten, schlossen sich zu einer Fronde zusammen, die sich (mit Höhepunkt im Dritten Reich, im sozialistischen Realismus und im kapitalistischen Realismus der Werbebranchen unserer Tage) fürchterlich rächte. Sie boten sich nämlich ganz offen allen als Partner an, die außerhalb der Kunst auf legitimen Wegen Macht institutionalisierten und ihre Klientel mit Heilsversprechungen der alten Art versorgten.
Um von diesen unverschämt ehrlichen und im Vorhof realer Macht glänzenden Kunstanwendern und Lebensgestaltern nicht vollständig verdrängt zu werden, sahen sich die Vertreter der Kunst als säkularisierter Kirche zu immer aufwendigeren Selbstüberhöhungen gezwungen, die man schon deswegen nicht mehr übersehen konnte, weil sie die Künstler zu wahren Monstern der Selbstverstümmelung, zu Attraktionen negativer Größe entwickelt hatten. Zu jenen Größen gehören wir alle, soweit wir zu jenen Künstlern und Dichtern, Literaten und Musikern gehören, deren peinigendes Pathos in einigen wenigen Beispielen vorgestellt wurde, und die gerade gegenwärtig unter dem Druck der Attraktionen, welche in unserem Weltdorf aufregender geboten werden als in aller Kunst und Literatur aller Jahrhunderte zusammengenommen, um Anerkennung als Geistesgrößen betteln.
Reihenweise imitieren wir zwar nicht mehr Dürer und Raffael, dafür aber Nietzsche und Klages, Goethe und Spengler, Baudelaire und Wagner, und wenn wir ganz hoch hinauswollen, auch noch Hitler, denn schließlich war der ja unzweifelbar in erster Linie Künstler – ein von niemandem in der ganzen Welt übersehbarer Künstler; begnadet mit der Kraft zur letzten Konsequenz; ein Großer, der das Sagen hatte; dem das Wolfsgesetz der Natur immer geltend war; der seine Dichtung, eine mörderische Prosa, ausschließlich als Sterbehilfe für seine Leser anbot. Hitler als unwiderstehlicher Politiker? Das mögen andere beargwöhnen und beurteilen! Hitler als genialer Feldherr? Auch das. Aber Hitler als der größte Filmemacher aller Zeiten? Als genialer Former der sozialen Plastik? Hitler als Kulturheros? Diesem Hitler machen wir Konkurrenz, wir persönlich. Die Kunst ist eine erhabene und zum Fanatismus verpflichtende Mission, hat er verkündet! Großartig! Wer dagegen etwa behauptete, die Kunst ist eine menschliche, zur Heiligung des Banalen verführende Sehnsucht nach Dauer, könnte mit der Zustimmung unserer heutigen Geisteshelden nicht gleichermaßen rechnen.
Sie fänden es roh und grotesk, so meint jedenfalls Slolerdijk, in der Nase zu bohren, während Botho Strauß sein Daimonion beschwört und von göttlicher Seele spricht? Kann man es anders nennen als ordinär, wenn Rühmkorf gegen die Handkesche Ideenlehre einen Furz fahren läßt – oder wäre Furzheit selbst eine der Ideen, die Gott aus seiner kosmogonischen Meditation entließ? Und was hat es zu sagen, wenn dieser philosophierende Stadtstreicher auf Bohrers feinsinnige Lehre vom Eros der Zerstörung mit einer öffentlichen Masturbation antwortet?... Eine Lehre verkörpern heißt: sich zu ihrem Medium machen. Dies ist das Gegenteil dessen, was im moralistischen Plädoyer für streng idealgeleitetes Handeln gefordert wird. Im Hinhorchen auf das, was verkörperbar ist, bleiben wir geschützt vor moralischer Demagogie und vor dem Terror der radikalen, nicht lebbaren Abstraktionen. (8)
Diese Analyse führt zu deprimierenden Schlußfolgerungen. Gerade weil die Geisteshelden ihre Lehren nicht verkörpern können, terrorisieren sie uns mit radikalen, nicht lebbaren Abstraktionen. Gerade weil sie in kritischer Hinsicht nicht sagen können, was sie leben und nicht berufen sind, zu leben, was sie sagen, werden sie niemals gezwungen, ihre Postulate zu überprüfen, sondern folgen einem RoIIenschema für Dichter und Denker, das vor hundertachtzig Jahren aus der formalen Analogie zur Kirche als Macht der Institutionalisierung universaler Größen abgeleitet worden ist. Interesse an diesen Größen, an Schönheit, Ewigkeit, Herrlichkeit, Paradies, Triumph, Gnade etc. dürfte kaum jemand leugnen. Diese Universalia wird aber die Dichtung ebenso wenig wie die Politik als Realia erweisen können. Wer das dennoch versucht, kann diejenigen nicht als kleingeistige Mainzelmännchen schmähen, die solche Versuche zur Realisierung der universellen Größen aus historischer Erfahrung für sich nicht gelten lassen wollen. Das ist nicht schicklich. (...)
(1) siehe Karl Heinz Bohrer im Merkur, Mai 1984.
(2) siehe Ulrich Horstmann: Das Untier. Konturen einer Philosophie der Menschenflucht, Wien 1983.
(3) Ulrich Horstmann, ebd.
(4) siehe Botho Strauß: Paare Passanten. München, Wien 1981, S. 115.
(5) siehe Botho Strauß. a. a. O., S. 119.
(6) siehe Peter Handke: Der Chinese des Schmerzes. Frankfurt a. M. 1983, S. 44.
(7) Renate Liebenwein-Krämer: Säkularisierung und Sakralisierung. Studien zum Bedeutungswandel christlicher Bildformen in der Kunst des 19. Jahrhunderts. Frankfurter Dissertationen zur Kunstgeschichte, Frankfurt a. M. 1977.
(8) nach Peter Sloterdijk: Kritik der Zynischen Vernunft, Frankfurt a. M. 1983.
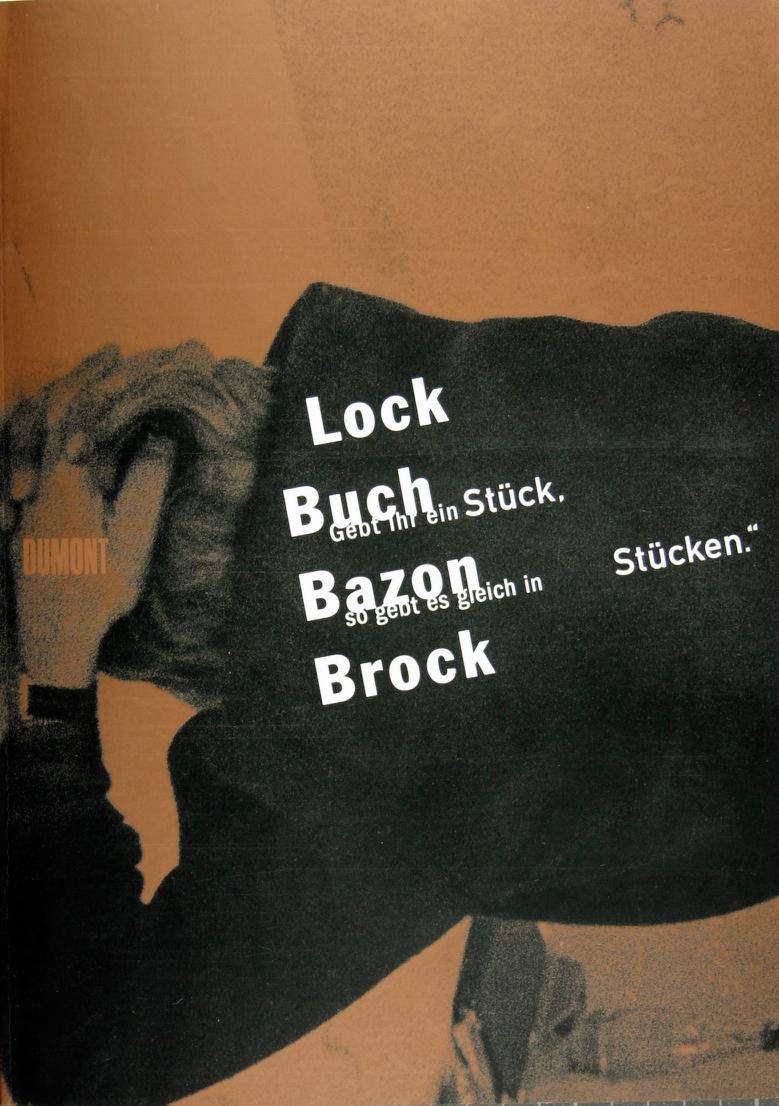 + 3 Bilder
+ 3 Bilder

