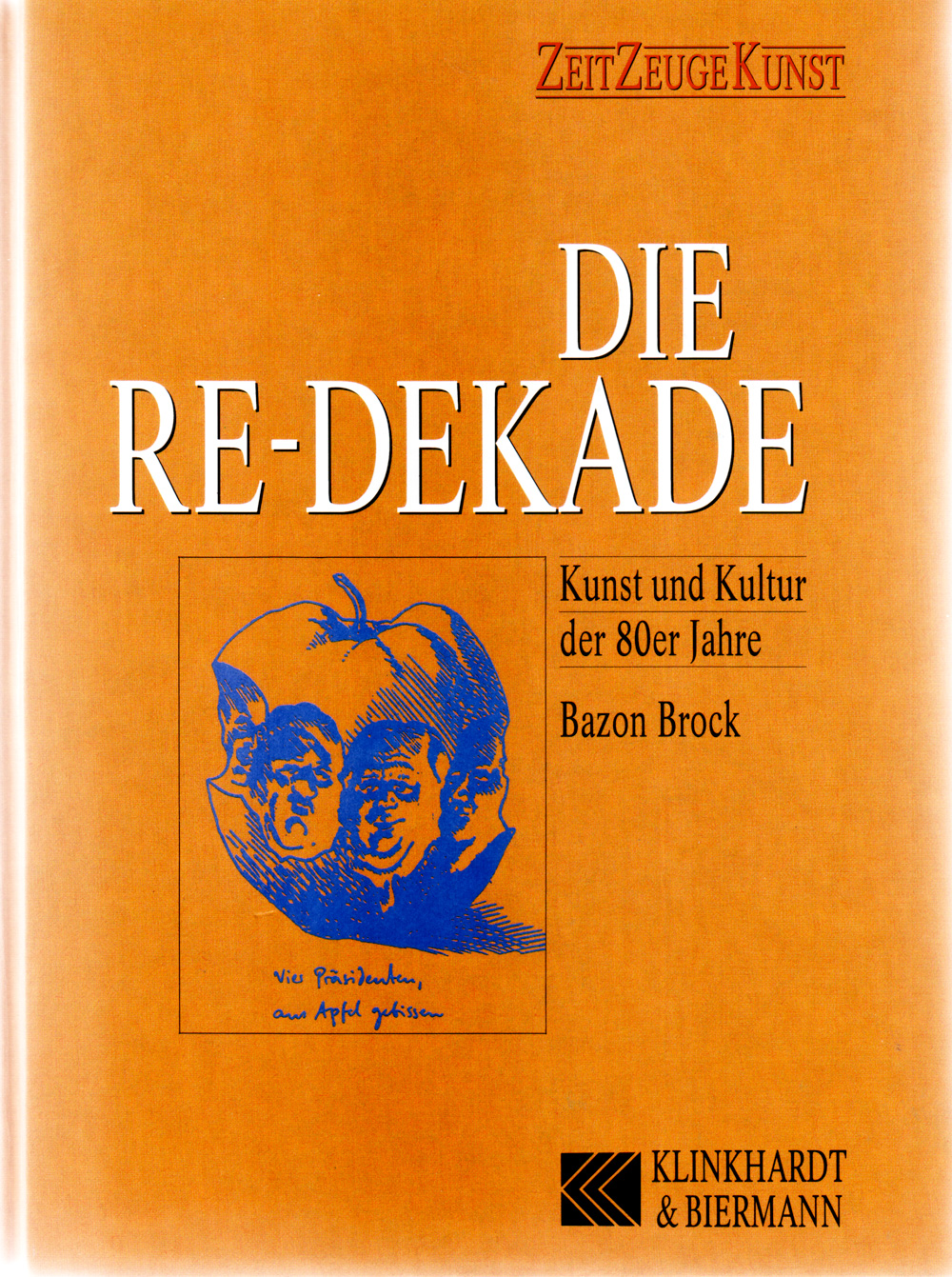Florian Rötzer: Sie verstehen sich als Kunstvermittler. Haben sich seit den sechziger Jahren für diese Rolle Veränderungen ergeben? Hat Ihre Bemühung um Vermittlung Folgen für die Kunstproduktion oder die Rezeption des Kunstpublikums gehabt?
Bazon Brock: Nicht erst seit der „Wende“ Anfang der 80er (das war Kohls wichtigster programmatischer Begriff, als er Kanzler Schmidt stürzte) herrscht eine allgemeine aggressive Stimmung gegenüber den Kunstvermittlern; es gab immer schon radikale, auch denunzierende oder hämische Kommentare gegenüber dem Bemühen, anderen Menschen auf die Sprünge zu helfen. Man verwechselte Kunstvermittlung mit einer Art pädagogischer Liebhaberdemonstration. Man glaubte, daß die Kunstvermittler beispielsweise den Besuchern von Ausstellungen unter der Hand, im Tone eines pädagogischen Conferenciers, etwas unterschieben wollten, was dann – nachgeplappert – für die Rezeption dieser Werke bedeutsam sei.
So ist, außer von Unterhaltungsclowns, aber Vermittlung nie gemeint worden. Sie ist ganz im Gegenteil darauf ausgerichtet, dem Publikum klarzumachen, daß die Rezeption selber eine Form der Produktion ist; daß zum Zuhören, Zusehen oder Betrachten Voraussetzungen gehören, die man genauso professionell erwerben und trainieren muß, wie die Künstler zum Beispiel auf Kunsthochschulen lernen, ihr Metier als Maler oder Bildhauer zu betreiben. In Wahrheit geht es darum, das Publikum aufzufordern, sich selber endlich ernst zu nehmen, sich selbst nicht als Unterhaltungspublikum zu verstehen, das sich von den Künstlern mit Kuchen und von den Vermittlern als Oberkellnern verwöhnen läßt. Es geht darum, die Vermittlung als eine Form der Arbeit zu etablieren, nicht bloß als eine Art Erleichterung des Zugangs zur Kunst. In Zeiten, in denen selbst Liebe unter zwei Personen zur Arbeit geworden ist, ist Rezeption allemal Arbeit. Dagegen hat sich zum größten Teil das Publikum gewehrt; dagegen haben sich vor allem auch Kritiker und Künstler selbst gewehrt, denn sie fürchteten, beim Publikum an Interesse zu verlieren, wenn Kunstvermittler wie ich ihm klarmachen, daß Rezeption Arbeit ist. Das Publikum strömt diesen Künstlern vornehmlich deswegen zu, weil es dort Attraktionen analog zur Zirkuswelt und zum Unterhaltungsgewerbe vermutet. Bloß keine intellektuelle Überfrachtung, bloß keine Anstrengung des Begriffs, bloß keine historischen Exkurse, bloß keine ikonologischen oder sonstigen spezifischen Studien, denn das könnte ja bedeuten, daß bei einer solchen Anstrengung die Attraktivität der Kunst verloren geht.
In den Jahren zwischen 1963 und 1976 gab es sehr viel mehr Menschen, die bereit waren, sich auf die Arbeit des Rezipierens einzulassen als danach. Die heutigen Adressaten reagieren auf jede Art von Hintergrundbestimmung eines Aussageanspruchs von Künstlern ziemlich unwirsch; sie benutzen Kataloge beispielsweise nur noch als Anfaß- und Trageobjekte, wobei die Kataloge auch bewußt so angelegt werden, daß sie nur noch als Tast- und Aneignungsobjekte, aber nicht mehr als Lesebücher verwendet werden. Es wird eigentlich nichts mehr aufgearbeitet. Man strömt in der Woche zu drei, vier oder fünf Ereignissen in Museen, Galerien, Theatern und hat dadurch schon nicht mehr die Zeit, sich auf etwas arbeitend einzulassen.
Florian Rötzer: In den letzten Jahren ließ sich eine fast triumphale Wiederkehr des Tafelbildes und der Malerei beobachten. Steht dies für Sie in Zusammenhang mit der zunehmenden Arbeitsmüdigkeit und Attraktionsgier?
Bazon Brock: Das ist ganz sicherlich eine Reaktion auf die Dominanz der Concept Art in den siebziger Jahren, einer Kunst, die wesentlich mit gedanklichen Konstrukten, Theorien und ziemlich anspruchsvollen Aussagekonzeptionen arbeitete, deren Verständnis intellektuellen Witz und aktive Erschließung verlangten. Diese Überforderung durch die Concept Art hat wesentlich dazu beigetragen, daß die Tafelbildmalerei, die es ja vorher auch immer gegeben hat, plötzlich wieder ins allgemeine Bewußtsein kam, als ob es sie vorher nicht gegeben hätte.
Das Entscheidende ist aber nicht, ob ein künstlerischer Aussageanspruch nun als Konzept, Happening, Tafelbildmalerei, abstrakt oder in der herkömmlichen Ikonographie vorgetragen wird, sondern welche Anforderungen von seiten der Werke und Künstler an das Publikum gestellt werden. Die intellektuellen Anforderungen, aber auch die an die Wahrnehmungsfähigkeit, sind, so scheint es jedenfalls dem Alltagspublikum, bei Tafelbildern vom Typ der Neuen Wilden sehr viel geringer als bei der Kunst der sechziger und siebziger Jahre. Bei der Pop Art mußte man ständig damit rechnen, daß man es bei Bildern von Warhol, Rauschenberg, Jasper Johns oder Vostell nicht mit bejahenden Überhöhungen der Reklamewelt zu tun hatte, sondern daß das negative Affirmationen waren, also Eulenspiegeleien, Nietzscheaden oder Schweijkiaden, die durch hundertfünfzigprozentige Übererfüllung eines ideologischen Anspruchs diesen in sich zusammenkrachen ließen. Die Werke von Warhol zwangen den Betrachter, ständig auf der Hut zu sein, ja nicht einer Behauptung auf den Leim zu gehen, die sich dann als das Gegenteil dessen erwies, was man zunächst geglaubt hatte.
Die Frage ist, warum ein Publikum nicht weiter in der Lage ist, solchen Ansprüchen zu genügen? Es gibt eine Reihe von Vermutungen, daß das mit dem Klima zu tun hat, über das man den Namen der Wende gestülpt hat: „Nun malen sie wieder, nun wird endlich wieder aus dem Bauch und aus dem Urin heraus gewerkelt, nicht mehr aus dem Kopf“, denn es kommt dem allgemeinen Vorurteil entgegen, daß Vollblutkünstler ist, wessen Herz überläuft. Man ist glücklich, in den Künstlern wieder Malschweine sehen zu können, unintellektuelle Herumwühler in den Wonnen der Gewöhnlichkeit, in ihnen keine Kritiker mehr sehen zu müssen, die uns Ambivalenzen des bildsprachlichen Ausdrucks aufzwingen und ständig Ambiguitäten ins Spiel bringen. Man hofft, es wieder mit Eindeutigkeiten und Unmittelbarkeiten zu tun zu haben, wieder einen direkten Zugang zu Bildern zu haben, der nicht mehr über historisches Wissen, philosophische Begriffsarbeit oder zeitpolitische Überlegungen vermittelt ist. Da gibt's wieder prächtige Farben und leuchtende Raumkörper zu sehen. Man redet sich ein, daß alles gleichermaßen möglich sei, daß historische Distanzen nicht mehr zwingend seien und es historische Genealogien nicht mehr gebe, daß alles gleichzeitig und gleichwertig sei. Aus dieser Vorstellung heraus postuliert man die Möglichkeit einer unmittelbaren Konsumierbarkeit von Aussagen. Das gehört natürlich auch zum Schema des Verhaltens in der Politik: keine komplizierten Verhandlungen, keine komplizierten Ableitungen und Begründungen mehr, sondern man will wieder Macht demonstrieren, sich von der beständigen Argumentation, Rationalisierung und Begründung freisprechen und bedingungslos im Handlungsfeld herumwühlen.
Florian Rötzer: Sie führen jetzt alles auf die Wende zurück, die das, was '68 kulminierte als Anspruch und Problematisierung, zu entsorgen sucht. Unmittelbarkeit ließe sich auch in den Nachkriegsmalereien, also beim abstrakten Expressionismus, beim Informel oder bei den Künstlern der CoBrA diagnostizieren. Würden Sie denn Ihre Kritik an der Unmittelbarkeit auch auf diese Kunstformen erweitern? Gerät die Kritik also nicht zu allgemein, weil sie die kritischen Intentionen gegenüber der fortschreitenden Rationalisierung außer Acht läßt?
Bazon Brock: Man muß wissen, daß die Entwicklung der abstrakten und der absoluten Malerei durch die Notwendigkeit erzwungen war, allgemeine lebensreformerische, sozialistische oder anarchistische Utopien überhaupt noch formulieren zu können. Die Gründerväter der Moderne sind allesamt engagierte, von Utopien erfüllte Täter gewesen, die die Erfahrung machten, daß man gesellschaftliche, politische oder sozialrevolutionäre Utopien nicht mehr in den herkömmlichen Ikonographien transportieren konnte. Je abstrakter, je reduktionistischer ein Mondrian, ein Malewitsch arbeitete, desto radikaler trugen sie politische Utopien vor. Denken Sie nur an die Verbindung zwischen russischen Konstruktivisten und der russischen Revolution oder an die zwischen De Stijl und den Lebensreformbewegungen. Weil die Nazis z. B. das wußten, agitierten sie derart extrem gegen die abstrakte Kunst, obwohl sie gegen die Formsprache nichts einzuwenden hatten. In der frühen Nachkriegszeit wurde die sogenannte abstrakte Kunst, das Informel, als Stoffmuster oder als Möbeldesign voll akzeptiert. Die normalsten Menschen trugen das am Leibe und hatten das in ihren Wohnungen. Gegen die Formensprache also hatte man gar nichts einzuwenden, sondern nur gegen die darin formulierten politischen oder reformerischen Utopien. Sobald man die abschneiden konnte, blieb von der sogenannten abstrakten Kunst nichts anderes als Formalismus übrig, der als solcher in der Alltagswelt akzeptiert wurde.
Die Künstler wissen alle, daß es keine Möglichkeit gibt, ein Gedankenkonstrukt, eine Utopie oder andere geistige Vorstellungen zu entwickeln und dafür die genaue Entsprechung etwa in der Malerei zu finden. Das Verhältnis von Inhalt und Form sieht ganz anders aus. Die abstrakte, gar die absolute Malerei, die die äußerste Radikalisierung dieses Standpunktes ist, macht klar: der „Inhalt“ dessen, was beispielsweise als das Quadrat von Malewitsch auftritt, steckt nicht im Werk selber, sondern das Bild verweist nur auf ein gedankliches Konstrukt als etwas im Werk prinzipiell nicht Einholbares und nicht identisch Abbildbares, dem man in keiner Form entsprechen kann. Das Bild holt sich seinen Bezugspunkt aus dem Postulat einer gedanklichen Konstruktion, die immer diesseits der Möglichkeiten bleibt, adäquat sprachlich ausgedrückt zu werden. Es gibt also kein Ausdrucksverhalten mehr, es ist kein Nach-außen-Bringen des inhaltlich schon Vorhandenen, ein bloßes Gestaltwerden dessen, was vorher schon amorph vorhanden war.
Ich begründe prinzipiell die ästhetische Dimension aus unserem durch naturevolutionäre Prozesse entstandenen Weltbildapparat, der nur aufgrund der prinzipiellen Uneinholbarkeit des Gedankens in der Sprache, des Bezeichneten im Zeichen und des Begriffs in der Anschauung seine großartigen Leistungen erbringt. Die ästhetische Dimension entsteht zwangsläufig in jedem kommunikativen Akt aus der Tatsache, daß einem Gedanken unendlich viele sprachliche Ausdrucksformen zugeordnet werden können, egal ob das Gesten, Malereien oder wortsprachliche Ausdrucksformen sind. Diese Erfahrung macht auch jeder Alltagsmensch. Umgekehrt macht auch jeder die Erfahrung, daß, wenn man die sprachlichen Vergegenständlichungsprozesse automatisch ablaufen läßt, Gedanken erzeugt werden, die man vorher gar nicht hatte. Das nannte Kleist das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Sprechen, mit dem jeder Künstler operiert.
Florian Rötzer: Was Sie nun aber über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Sprechen, also einem Vorgang oder einer Methode, dessen Ergebnis das Subjekt nicht absieht, gesagt haben, widerspricht doch in gewisser Weise der postulierten fundamentalen Differenz zwischen Anschauung und Denken im Herstellungsvorgang eines Werkes. Die ästhetische Differenz setzt voraus, daß der Künstler zunächst eine Idee hatte, die er dann darzustellen oder zu realisieren sucht. Ein Ergebnis der modernen Malerei, die nicht zu konstruktiven Verfahren, sondern etwa zum Action Painting geführt hat, war doch, daß aus dem Schaffensprozeß, im intentionslosen Umgang mit Materialien, die Werke entstehen, die erst nachträglich vom Rezipienten auf die darin möglicherweise enthaltene ästhetische Differenz untersucht werden können. Diese Malerei als Aktion müßte man vom Künstler her als eine Form von Unmittelbarkeit interpretieren.
Bazon Brock: Ganz im Gegenteil. Wenn jemand im Sinne der gestischen Malerei loslegt, dann tut er das, was Kleist „beim Sprechen“ nennt. Wenn man anfängt zu malen, dann ergeben sich aus dem bloßen prozeßhaften Fortführen des Bemalens einer Leinwand immanente Zwänge der Gestaltung, denen man nicht mehr entkommt, es sei denn, man zerreißt das Ganze oder verschmiert es. Je weiter man im Arbeiten fortfährt, desto mehr entdeckt man eine eigenständige Logik des Vorgehens selbst. Daraus entwickelt sich die Notwendigkeit einer gedanklich-konstruktiven Einholung dieses Prozesses, die aber nie möglich ist. Ob ich aber nun bei der gestischen Malerei anfange und dadurch auf gedankliche Konstrukte hinzugetrieben werde, die aber nie dem daraus Entstandenen entsprechen können, oder ob ich umgekehrt von so etwas ausgehe wie einem Formgedanken und dann feststelle, daß jede Formulierung als Bild oder als Wort, als Architektur oder Geste diesem Gedanken nie vollständig entsprechen kann, da ich ihn selber ohne die sprachliche Vergegenständlichung gar nicht kennen kann, bin ich immer auf die gleiche Differenz verwiesen, die ich die ästhetische Dimension nenne. Im übrigen gibt es für die ästhetische Dimension gar keine andere Begründung. Wir sind auf Vergegenständlichungszwang festgelegt, wir kommen dem inneren Bild, der inneren Vorstellung nur nahe durch sprachliche Vergegenständlichung, wobei wir unter Sprache jede Form der Entäußerung verstehen, also jede Form der Handlung. Andererseits kann das, was wir im Handeln produzieren, niemals eine adäquate Entsprechung zu diesem Gedanken haben, weil wir ihn erst durch die Formulierung kennenlernen.
Florian Rötzer: Wenn man so allgemein von der Differenz zwischen Begriff und Anschauung spricht als der ästhetischen Dimension, dann lassen sich nur noch schwer ästhetische Phänomene von anderen unterscheiden. Die ästhetische Differenz wäre dann ebenso konstitutiv für das philosophische Denken wie für die wissenschaftliche Erkundung. Ähnliches würde für die Objekte gelten, die man als ästhetische interpretiert. Ist diese Universalisierung also dienlich für eine ästhetische Theorie?
Bazon Brock: Jede Art des kommunikativen Handelns hat eine ästhetische Dimension, genauso, wie es eine logische und ethische Dimension hat. Die Leistungsfähigkeit unseres Weltbildapparates ist nur durch Differenzierung der Leistungszentren in der Großhirnrinde entstanden. Das bedeutete Entkoppelung der Funktionen. Heute weiß man auch in einem neurophysiologischen Sinne zu demonstrieren, wie diese Differenzierung in etwa aussieht, wobei die Leistungszentren dennoch bei jeder Wahrnehmungsarbeit kooperieren müssen. Zumindest seit Baumgartens Zeiten, also Mitte des 18. Jahrhunderts, wird Ästhetik ja nicht mehr als die Lehre vom Schönen, gar noch vom Kunstschönen verstanden, sondern es geht dabei um Fragen der sinnlichen Erkenntnis, also inwieweit wir nicht mit den Augen, sondern mit dem Gehirn sehen und was diese Aufarbeitung des Gehirns steuert. Das sind die naturgeschichtlich entstandenen Raster, in denen wir die Synthesis leisten, nach der Kant fragte, von der aber seit Baumgarten und allemal heute gesagt werden kann, daß sie die Leistung der Naturevolution selber ist in der Hervorbringung unseres Weltbildapparates. Alle Kategorien der unmittelbaren Anschauung sind in ihm vorgegeben. Baumgarten fragte sich, wie es zu den Leistungen unseres Weltbildapparates kommt, aus den sinnlichen Erfahrungsdaten so etwas wie Erkenntnis zu filtern, da vorher hinreichend demonstriert worden war, daß wir sinnlichen Täuschungen unterliegen und auf die Sinnesorgane kein Verlaß ist. Was für einen Sinn kann die Entwicklung der Leistung dieser Sinnesorgane in ihrer angeblich totalen Willkür für die Natur gehabt haben, wenn in ihnen nichts steckte, was im gleichen Sinne erkenntnisfähig und unserer Lebenswirklichkeit angemessen wäre? Wenn Bereiche der Großhirnrinde, so stellt sich das Problem dar, für das Erkennen der räumlichen Kontinuität oder des Melodienverlaufs zuständig sind, andere für verbalsprachlichen Ausdruck und so weiter, dann ist die Frage, wie diese Zentren in ihrer je nur gegebenen Spezialisierung bei den Wahrnehmungsaufgaben zusammenspielen, die ja sämtliche Aktivitäten aller Leistungszentren verlangen. Hieraus hat sich auch die Leistungsfähigkeit eines abstrakten Denkens unter Ausschluß von etwas anderem als dem Denken selbst entwickelt: als Entkoppelung!
Die Spezialisierung der Leistungszentren ist fundamental, aber ebenso fundamental ist, daß sie zusammenarbeiten müssen, und das funktioniert nur durch die Bildung von Dominanzhierarchien, die bei gewissen Aufgaben eingeschliffen und festgesetzt werden. Wenn jemand den ganzen Tag am Fließband arbeitet, dann wird angesichts der Wahrnehmungsaufgabe, seine Hände im Sichtfeld der Augen, bezogen auf bestimmte Objekte und Handreichungen, zu kontrollieren, eine bestimmte Dominanzhierarchie eingeschliffen. Es bedarf dann der nächtlichen Traumarbeit oder des Vergessens, um diese Verklammerung der kooperierenden Leistungszentren wieder aufzulösen. Die komplexeren Dominanzhierarchien können nur durch Denken entkoppelt werden, wodurch die Leistungsfähigkeit des Weltbildapparates garantiert wird.
Florian Rötzer: Die Dimension der ästhetischen Differenz entspricht also der Grundlage einer allgemeinen und physiologisch formulierten Erkenntnistheorie und ist nicht spezifiziert auf Objekte und Wahrnehmungsformen, die man der Kunst zurechnen würde?
Bazon Brock: Die ästhetische Dimension in bezug auf Kunstobjekte stellt nur eine ganz schmale, prozentual kaum meßbare Größe aus dem Feld der allgemeinen ästhetischen Bedingungen jeder Kommunikation dar. Die Ästhetik in der Kunst bezogen auf das Schöne …
Florian Rötzer: Ich sprach nicht vom Schönen, sondern fragte nach der Differenz zwischen der Erfahrung, die man mit Objekten macht, die man der Kunst zurechnet, und anderen Formen der Erfahrung, die beispielsweise der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung adäquat sind.
Bazon Brock: Für die wissenschaftliche Erkenntnisproduktion gilt das gleiche. Wenn beispielsweise Carnap ein Bilderverbot für Philosophen erläßt, dann ausschließlich deswegen, weil er genau weiß, daß durch die ästhetische Dimension die Relation von Gedanken und sprachlichem Ausdruck verfälscht wird. Ihm kam es als mathematisch orientiertem Philosophen auf Eindeutigkeit der Zuordnung von Gedanken und sprachlicher Vergegenständlichung an. Wenn man so die ästhetische Dimension ausschalten will, produziert man Tautologien. Das gelingt, indem man Identität von Gedanke und sprachlichem Ausdruck in einer Operation erzwingt, aber das ergibt nichts anderes als eine Tautologie. Mehr kommt dabei nicht heraus. Das behauptet auch kein Mathematiker. Normalerweise ist beim wissenschaftlichen Arbeiten dasselbe zu berücksichtigen: „Gib an, in welchem Verhältnis Begriff und Anschauung oder Zeichen und Bezeichnetes bei Dir stehen!“ Man kann dabei Regeln vorgeben, damit das Fremden erkennbar wird; man kann Definitionen vorgeben, die nichts anderes sind als katalogisierte Zuordnungen von Gedanken und ihren sprachlichen Vergegenständlichungsformen. Durch Definitionen läßt sich die Zuordnung weitgehend vom beliebigen Zugriff freihalten, ohne je gewährleisten zu können, daß bei noch so exakten Definitionen je das Gesagte eine genau identische Reproduktion dessen ist, was man hat sagen wollen. Es bleibt prinzipiell eine Differenz. Auch die exakteste wissenschaftliche Formulierung ist auslegungsfähig und auslegungsbedürftig. Die Differenz ist durch keine Zwänge, durch keine Dogmatik und keine semantische Ordnungspolizei einholbar. Dabei würde sie auch ihre Wichtigkeit verlieren, weil es keine Kommunikation unter Menschen gäbe, wenn sie in einer Herstellung von Identität in den Reservoirs von Sendern und Empfängern bestehen würde. Verständigung ist nur möglich aufgrund der Nicht-Identität von Gedanke und sprachlichem Ausdruck, Verstehen ist nur durch ein produktives Mißverstehen möglich. Es gibt mit wenigen Ausnahmen mathematischer Operationen keine Möglichkeit, Identität von Gedanke und Vergegenständlichung schon beim Sprechen selbst herzustellen, geschweige denn in der Kommunikation mit anderen.
Florian Rötzer: Eine Konsequenz Ihrer Ausführung wäre doch die, daß die moderne Gesellschaft einem Irrtum aufsitzt, wenn sie Leute als Künstler von anderen unterscheiden will. Sie müßten auch bestreiten, daß, wie etwa Jürgen Habermas behauptet, die Differenzierung von theoretischen, praktischen und ästhetischen Wertsphären in autonome Expertenkulturen zur Moderne unabdingbar beigetragen hat und ihre Grundschicht bildet. Zudem müßten Sie sagen, daß die Zuordnung einer Erfahrung, einer Aussage oder eines Objekts zu einem der Bereiche zufällig ist.
Bazon Brock: Das ist es ja auch zweifellos. Habermas kann doch nicht einmal einen Merz von einem Graubner unterscheiden. Er glaubt, bestimmen zu können, aber nicht erfahren zu müssen, wenn etwas so oder so ist, dann ist es dies oder das. Die Frage ist, inwiefern die Künstler eine besondere Kenntnis von der ästhetischen Dimension haben, nämlich deswegen, weil ein künstlerisches Werk alleine schon daraus entsteht, daß man die prinzipiell gegebene Uneinholbarkeit des Gedankens im sprachlichen Ausdruck thematisiert. Ein künstlerisches Werk entsteht als reflexive Aufarbeitung dieser Grundgegebenheit. Das Werk differenziert zwischen der Oberfläche der Erscheinungen als sprachformale Setzung von materiell vergegenständlichten Zeichen und dem, was möglicherweise darin bezeichnet sein kann; es differenziert reflexiv also als „anschauliches Denken“. Die Concept Art betont beispielsweise das Zusammenspiel von innerer Formgestalt und der sprachlichen Vergegenständlichung und versucht, jene soweit zu reduzieren, wie das überhaupt möglich ist, um den Verweis auf eine innere Gestalt oder Denkform noch zu erlauben. Sie versucht, die Autonomie der Sprache – denn alle Sprachen unterliegen Eigengesetzlichkeiten – so weit zu reduzieren, daß die Annäherung an den Gedanken möglichst unverstellt ist von den Sprachen, die ein Künstler, wie auch jeder andere, wählen kann. In diesem Sinne ist der Künstler ein Spezialist für die ästhetische Dimension, weil er seine Werke aus der Kenntnis der prinzipiellen Nichtidentität von Wesen und Erscheinung oder von Inhalt und Form herstellt.
Das Schöne im klassischen Sinne war dadurch definiert, daß in einem Kunstwerk diese beiden Seiten, also der gedankliche und der sprachlich vergegenständlichte Aspekt, sich in einem hohen Maße identisch setzen lassen und sich so eine Vollkommenheit der Übereinstimmung verwirklicht. Dies aber eben nicht in einer unproblematischen und tautologischen Zuordnung, sondern als Resultat einer langen Arbeit an der Differenzierung dieser Dimensionen. Möglicherweise ist in diesem Sinne heute etwas schön, wenn in ihm nicht oberflächlich Inhalt und Form identisch werden, sondern gerade dann, wenn eine möglichst große Evidenz für das Wechselspiel von sprachlichem Zeichen und dem Gedanken produziert wird. Als Erkenntnismittel sind diese Kunstwerke sehr viel brauchbarer, wenn sie solche „ruinösen“ Charaktere sind. In diesen Werken erkenne ich nämlich die prinzipielle Zuordnungsschwierigkeit, um die es in jeder Art von sprachlichem Ausdruck geht.
Die Künstler haben ein reflexives Verhältnis zu dieser Nicht-Identität. Die Kunst ist also nichts anderes als die produktive Nutzung der prinzipiellen Unangemessenheit von Gedanken und sprachlichem Ausdruck. Es wäre völlig überflüssig, wenn man, wie Picasso, 33mal ein Frauenportrait oder 150mal eine bestimmte Landschaft oder einen Raum malt. Wenn das anders wäre, dann würde jeder Künstler in seinem Leben nur ein einziges Bild malen. In der prinzipiellen Uneinholbarkeit liegt der Zwang fortzufahren, und die nächste Formulierung ist der erneute Versuch, dieses durch Nicht-Identität gekennzeichnete Verhältnis von sprachlichem Ausdruck und innerem Bild zu thematisieren und das heißt immer zu problematisieren.
Während wir im Alltag darauf ausgerichtet sind, diese Problematik zu überspielen, lebt die Kunst aus ihr. Sie leistet sich das, was in der normalen Kommunikation übergangen werden muß. Darin liegt ihre spezifische Leistung für jedermann, nicht nur für den Kunstliebhaber.
Florian Rötzer: Wenn man eine solche Theorie vertritt, müßte man zumindest angeben können, welche Formen der prinzipiellen Nicht-Identität jeweils in einer geschichtlichen Periode formuliert werden können. Was zeichnet denn für die gegenwärtige Kunst die Arbeit an der Differenz aus?
Bazon Brock: Wieso? Man kann natürlich sagen, in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten werden nur bestimmte Arten der Thematisierung zugelassen. Beispielsweise bezeichnet jemand seine eigene Rüstung als „Nachrüstung“, woraus sich die logische Konsequenz ergibt, daß der andere vorgerüstet hat. Das aber ist nur die Logik der Dummheit, die nicht-reflexive Naturlogik. Ich nenne einen anderen „Aufrüster“ und bin dann aus dieser sprachlichen Operation gerechtfertigt, wenn ich nachrüste.
Florian Rötzer: Die radikale Malerei eines Malewitsch etwa entstand doch in einer ganz bestimmten Zeit, während vorher keine schwarzen Quadrate gemalt wurden. Wodurch kommt es zu solch einer Thematisierung, die zuvor nie in den Blick gefallen ist?
Bazon Brock: Das ist doch gar nicht wahr. Seit den antiken Autoren oder seitdem die Literaturlage eindeutig wurde, also seit dem Mittelalter hat es all diese Überlegungen in Theorien und Worten der Künstler selbst gegeben. Wenn Sie die Theorien von Alberti, von Piero de la Francesca oder von Leonardo lesen …
Florian Rötzer: Aber die haben kein schwarzes Quadrat gemalt.
Bazon Brock: Das ist nur im wörtlichen Verständnis richtig. Brunelleschi z.B. thematisierte und problematisierte das Absolute als Gefüge von Flächenproportionen mindestens genauso intensiv wie Malewitsch. Aspekte der Monochromie oder der Aufhebung der Farbe durch Form werden von ihm wie von vielen seiner Zeitgenossen und Nachfolgern bearbeitet, natürlich in damals zeitgemäßen Vorgehensweisen. So sehr sich auch die Gedanken und sprachlichen Vergegenständlichungsformen wandeln können, so wenig vermögen Menschen ihr Denken selbst zu verändern. Nur deshalb können wir historischen Werken der Menschheit überhaupt etwas abgewinnen.
Florian Rötzer: Die Ausrichtung Ihrer ästhetischen Theorie auf die prinzipielle Inkommensurabilität von Begriff und Anschauung hat als Gegenpol die Kritik an Unmittelbarkeit in der Kunst. In welchen Bildwelten wird denn die Differenz ausgelöscht und was ist die zu kritisierende Konsequenz?
Bazon Brock: Der normale Alltagsrezipient glaubt, weil man auf einem Caspar David Friedrich Pferde vor Greifswald auf einer grünen Wiese sieht, benötige er für dieses Bild keinerlei historische, ikonographische oder malereigeschichtliche Kenntnis. Er glaubt, daß zwischen diesem Bild und dem zu ihm Denkbaren, Gedachten oder Vorgestellten keine Differenz herrsche. Das Bild drücke aus, was es darstellt. Das ist eine typische Art der Vernichtung des Aussagewertes dieses Bildes selbst: „Es ist eben das, was es ist. Was ist es denn? Ja das, was es darstellt. Was stellt es denn dar? Ja, das, was es ist.“ Von unmittelbarem Zugang gar keine Rede! Das sind ideologische Phrasen, die gedroschen werden, weil man sich der Anstrengung entziehen will, die Arbeit der Differenzierung zu leisten, vor allem, weil man vom Künstler, den man als eine Art Miniaturausgabe Gottes sieht, vermutet, daß er genau wisse, was er macht – wie man das eben vom lieben Gott auch vermutet, um ihm dann die Theodizee-Frage zu stellen, wie er denn einen solchen Schlamassel auf Erden produzieren konnte. Der Schöpfergott hat genauso wie alle anderen, die etwas produzieren, unter Vergegenständlichungszwang gestanden, und das heißt, daß er als Macher keineswegs unmittelbar besser als andere weiß, in welcher Art der Zuordnung gedankliches Konstrukt, gemalter Plan oder Entwurf zu dem Ausgeführten stehen. Er wird daher genauso wenig für seine Schöpfung in toto verantwortlich zu machen sein wie irgendein Künstler. Immer wenn die Künstler anfangen, die Bedeutung eines Werks zu erklären, dann ist das Publikum sehr unbefriedigt und sagt, daß das ja nun wirklich nicht „alles“ sein könne; es müsse doch noch etwas anderes darin stecken, ein großes Geheimnis, das Gott und Künstler ihnen nicht nennen wollen. Da ist kein Geheimnis, das sich entschlüsseln ließe, außer in der Anerkennung der Tatsache, daß auch ein Macher oder ein Denker unter dem Zwang der Vergegenständlichung in die Nicht-Identität getrieben wird, die er bei bestem Willen nicht kontrollieren kann. Das Bild wird sofort vernichtet, wenn jemand glaubt, in ihm die Differenz zum Gedachten und Vorgestellten nicht sehen zu müssen, sondern es als den unmittelbaren Ausdruck dessen zu nehmen, was es darstellt.
Florian Rötzer: Wenn Sie gegen jene ästhetische Strategie zu Felde ziehen, die Sie mit dem polemischen Titel der Gottsucherbande bezeichnen, und die Unmittelbarkeit erzwingen will, auf Erhöhung und Selbsttranszendierung dringt, dann ist dies eine Kritik, die sich einerseits ästhetisch begründet und andererseits durch politische oder ethische Überlegungen motiviert ist. Untersteht denn die Kunst prinzipiell ethisch-politischen Verpflichtungen?
Bazon Brock: Seit der platonischen Konstatierung der Mittelbarkeit (Methexis) als einzige Möglichkeit, vom Guten, Schönen und Wahren etwas wissen zu können, ist es klar, daß die ästhetische, die ethische und die epistemische Frage miteinander verschwistert sind. Nicht nur die Kunst hat ethischen Gesichtspunkten zu genügen, sondern jede Kommunikation, die aus der ästhetischen Differenz lebt, denn wir können bewußt lügen: Wir wissen, daß wir erst dann in vollem Umfang über unseren Weltbildapparat verfügen können, wenn wir (als Kinder) die Erfahrung gemacht haben, daß wir lügen können. Wie kann man eigentlich feststellen, ob jemand, mit dem ich kommuniziere und bei dem ich nur die sprachliche Vergegenständlichung wahrnehmen kann, die Zuordnung seiner gedanklichen Aussagen willkürlich, also in Absicht zu lügen, verstellt; ob er mich mit dem, was er signalisiert, willentlich in die Irre leitet? Die ethische Dimension ist darin begründet, daß jeder Mensch nur in der Vergesellschaftung überlebensfähig ist und jeder annehmen muß, daß das wechselseitig gilt. Auch naturgeschichtlich ist die ethische Dimension darin begründet, daß uns der Weltbildapparat die Möglichkeit zum Lügen eröffnet. Es geht nicht um die Einhaltung irgendwelcher Normen, wie sanktioniert sie auch immer sein mögen, die eine Ethik begründet, sondern um die schlichte Tatsache, daß ich mich unmittelbar selber tödlich bedrohe, wenn ich diese Vorgabe in einer reziproken Kommunikation nicht einhalte. Es ist also der nackte Egoismus, der mich dazu zwingt, ethischen Gesichtspunkten in der Kommunikation zu entsprechen. Insofern hat auch die Kunst mit dieser Frage zu tun, weil sie in besonderem Maße in der Lage ist zu lügen. Das ist eine alte Frage, wie man mit Bildern lügt, denn bildsprachlich sieht das anders aus als im wortsprachlichen Ausdruck. Eine Rolle spielt hier auch das Realismus-Problem. In der bildenden Kunst sind wortsprachliche Formen wie etwa die Bildung von Konditionalsätzen oder Verneinungen nicht möglich. Man ist daher in besonderem Maße darauf bedacht, inwieweit ein bildsprachlicher Künstler der ethischen Bedingung genügt. Jede Ästhetik ist bezogen auf eine Ethik, und umgekehrt ist jede Ethik abhängig von der prinzipiellen Nicht-Identität der ästhetischen Dimension. Beide sind natürlich abhängig von der Wahrheitsfrage, denn die Täuschbarkeit, der wir unter der Bedingung der prinzipiellen Nicht-Identität gleichzeitig ausgeliefert sind, ist für uns eine Frage der Feststellbarkeit von Wahrheit in einem existentiellen Sinn. Wenn die Natur selber Mimikry anwendet, dann ist die Wahrheitsfrage unmittelbar wichtig, die jedem kommunikativen Geschehen gegenüber erhoben werden muß. Voneinander getrennt, können die ethische, die ästhetische und die epistemische Frage nicht erörtert werden, obwohl die fundamentale Voraussetzung die ästhetische Dimension ist, also die Erfahrung der Nicht-Identität.
Florian Rötzer: Gegenwärtig werden zwei Fragestellungen für die moderne Ästhetik, soweit sie die Kunst betrifft, erörtert. Die eine wurde von Bohrer unter dem Titel des Bösen thematisiert, daß also die moderne Kunst dadurch gekennzeichnet sei, sich gegen ihre Ethisierung zu wenden, indem sie das Böse nackt präsentiert und daraus die ästhetische Faszination erzeugt. Die andere wird unter dem Stichwort des Erhabenen von Lyotard im Rückgriff auf Kant und auf Burke thematisiert, daß die Malerei, sofern sie unter den modernen oder postmodernen Bedingungen noch ernst genommen werden soll, an der Darstellbarkeit des Undarstellbaren zu arbeiten habe, also an dem, was sich der Verständigung der Darstellung prinzipiell entzieht. Können Sie Ihre Theorie in Abgrenzung zu diesen beiden Ansätzen bestimmen?
Bazon Brock: Die Situation ist für die Gegenwartskunst nicht anders, als sie es für die Kunst je gewesen ist. Das Nicht-Darstellbare, das ganz Andere ist nicht jenseits dessen, was wir kommunizieren können, sondern ist das, was unsere Kommunikation als prinzipielle Nicht-Identität bestimmt. Deswegen besteht für mich kein Bedürfnis zur Überhöhung und Überformung in der Ausrichtung auf das ganz Andere jenseits der Beziehungen der Menschen aufeinander. Diese Vorstellungen können nur von Leuten erhoben werden, die keine blasse Ahnung von dem haben, was Kommunikation bestimmt. Mehr als das Uneinholbare, das die ganze Alltagskommunikation bestimmt, kann es selbst unter Zuhilfenahme apokrypher Phantastereien des sogenannten Irrealen gar nicht geben. Den gleichen Einwand erhebe ich gegen Bohrer und andere im Hinblick auf ihren antibürgerlichen Aspekt, das Böse wieder ins Spiel zu bringen. Diese Autoren sind offensichtlich so unterentwickelt in ihren Affekten, in ihren Handlungswirklichkeiten, daß sie für sich und an sich so etwas wie die Versuchung des Bösen, der Gewalttätigkeit, des Hasses oder der Zerstörung, des Machtrausches aus Sehnsucht nach Verbindlichkeit, wünschen müssen. Diese Dimension kenne ich in mir wie jeder voll entwickelte Mensch und habe kein Bedürfnis danach, das jenseits von dem, was ich sowieso schon bin, noch zu thematisieren. Wer die historischen und persönlichen Erfahrungen meiner Generation gemacht hat, der wird sein Leben lang nur bemüht sein, sich selbst zu fesseln und alle diese unter der Dimension des Bösen angesprochenen Aspekte in sich selbst unter Kontrolle zu halten. Ich bedarf keines Hinweises auf einen wahnsinnigen Richard oder auf eine andere phantasmagorische Gestalt als Untier; ein aufgeklärter Mensch weiß, daß er das selber ist, daß er jederzeit in der Lage ist, jedes beliebige Verbrechen zu begehen, jederzeit dazu verführbar ist, Unmittelbarkeit mit Gewalt durchzusetzen, und jederzeit ein exemplarischer Erzwingungsstratege des Absoluten sein kann. Ich rechne überhaupt nur mit Menschen, die das von sich wissen, alle anderen sind sowieso tot. Ich halte es einfach nicht aus, daß ausgerechnet Dichter, Schriftsteller oder Künstler nicht in der Lage sind oder sein sollten, diese Dimension als die schon in ihnen selbst natürlich gegebene Voraussetzung zu erkennen und sich stattdessen an phantasmagorischen Erfindungen aufgeilen müssen. Das sind doch leibarme Krüppel, das sind doch Schreibtischbürokraten, denn nur einem Bürokraten, einem frustrierten, kastrierten und sinnberaubten Stubenhocker kann doch irgend etwas zu solchen Themen einfallen, weil er sie nicht in sich selber vorfindet. Für eine Demokratie ist entscheidend, daß Menschen alles daransetzen, sich tagtäglich, von früh bis abends, davon abzuhalten, das alles auszuleben!
Natürlich muß man zugeben, daß ein kathartischer Effekt, vielleicht auch ein Moment der Selbstfesselung dadurch entstehen kann, daß man diese Vorstellungen oder Kräfte in der Phantasie auslebt, im virtuellen ästhetischen Schein thematisiert, um sie davon abzuhalten, sich in der Lebensrealität zu verwirklichen.
Selbstverwirklichung ist ein Ideal der Vollidioten. Aber auch der ästhetische Schein ist ein Aspekt der Lebensrealität, auch unsere Wahnvorstellungen sind real und beherrschen uns. Es ist nicht möglich, so zu tun, als ob dies alles von uns abgespalten sei im Bewußtsein der bloßen Fiktivität und Irrealität. Heute kann doch kein Mensch mehr behaupten, daß er zu unterscheiden wüßte, welche Aspekte seiner Selbsterfahrung fiktiv oder illusionär sind und welche darüber hinausgehen. Für Leute, die selber eine Potenz darstellen als instinktgetrieben, affektiv angereizt, die wirklich noch von den Wahrnehmungsauslösern ihrer Umwelt angestachelt werden und sich ständig bremsen müssen, darauf zu reagieren, was ihnen abverlangt wird, gibt es gar keinen Grund, in der künstlerischen Tätigkeit zusätzlich für solche Anreize zu sorgen.
Florian Rötzer: Die Arbeit am Bild ist, wie Sie eben auch sagten, noch immer an der traditionellen Differenz zwischen ästhetischem Schein und Realität orientiert. Ist das aber nicht anachronistisch, wenn man davon ausgeht, was sich als Stimmung verbreitet, daß wir in einer Welt leben, die Reales und Imaginäres ununterscheidbar werden läßt?
Bazon Brock: Gerade dieses Gerede von der totalen Simulation halte ich für völlig haltlos. Es bedarf dann eben eines veränderten Begriffs von Wirklichkeit, wenn man sich durch diese Vorgänge schon völlig in eine Fiktion verwandelt sieht. Für mich ist „wirklich“ sinnvollerweise nur das, worauf ich keinen Einfluß habe, denn sonst wäre es mir nicht gegeben, zwischen einer Wahnidee oder einer Obsession und einer begründeten Handlung zu unterscheiden. Sobald ich darauf verzichte, diese Wirklichkeit zu akzeptieren, bin ich trotz aller Virtualität, trotz des totalen Eindringens des ästhetischen Scheins in alle Lebenssphären unserer Gegenwart von einem Irren objektiv nicht zu unterscheiden. In früheren Kulturen wurde das, worauf ich keinen Einfluß habe, also die Wirklichkeit, unter dem Heiligen nur schwer verborgen. Man versuchte, mit dem Gott ins Geschäft zu kommen und ihm noch eine gewisse Beeinflußbarkeit abzuverlangen, man versprach ihm Gebete und Opfer, wenn er sich nur wunschgemäß verhalte. Das war eigentlich der Versuch, die Wirklichkeit auszulöschen. So herum wird nämlich ein Schuh daraus, weil diejenigen, die das Paradigma der totalen Simulation ständig vorführen, es gerne so hätten, daß es nichts mehr gebe, das als Barriere definierbar wäre. Das sind ihre Machtphantasien. Wenn sie allen vorrechnen, es gebe keine Verbindlichkeiten mehr, intendieren sie, die Leute zu verführen. Auf allen Ebenen läßt sich heute erfahren, daß der Widerstand aus dem kommt, was sich nicht verändern läßt (z.B. von der Einsicht, daß wir zwar die Natur zerstören können, aber Leben ohne die Naturbasis nicht möglich ist). Dazu brauchen wir keine theologische Begründung mehr oder müssen das in irgendeiner anderen Weise ableiten. Alles, was uns in unserem gesellschaftlichen Dasein bestimmt, ist nichts als historische Konvention, und trotzdem können wir daran nichts ändern. Das ist Wirklichkeit.
Jedermann erfährt heute, wie er sich in seinem eigenen Bereich abstrampeln kann, beispielsweise reformerische Ideen oder Veränderungen aufs Ganze hin in Gang zu setzen, ohne dadurch irgendetwas Übergeordnetes, gar die ganze Gesellschaft beeinflussen zu können. Dennoch glauben allzu viele, trotz gegenteiliger Erfahrungen, daß es für jedes Problem Strategien der Problemlösungen geben kann, die wissenschaftlich und technisch anwendbar sind.
Wir müßten längst anerkennen, daß es überhaupt keine Problemlösungen gibt, denn beim erstbesten Versuch, heute ein Problem zu lösen, wird uns klar, daß Probleme zu lösen in nichts anderem besteht und bestand, als neue Probleme zu schaffen. Deswegen ist die Behauptung einer totalen Simulation eine hirnrissige Phantasie. Die Mehrzahl der Probleme sind „bösartige Probleme“, die prinzipiell nur durch die Erzeugung noch größerer Probleme gelöst werden können. Und es ist wenig sinnvoll, ein Problem dadurch zu lösen, daß man, siehe Plutoniumwirtschaft, größere Probleme in die Welt setzt. Jeder, der sich selber ernst nimmt, erfährt, daß er mit noch so omnipotenten realen oder fiktiven Eingriffen in das, was Wirklichkeit ist, je auch nur bis an die Grenzen kommt, wo daran gedacht werden könnte, daß die Welt rein simulativ beliebigen Verformungen unterworfen werden könnte. Uns wird im Gegenteil heute in einem so großem Maße die Konfrontation mit der Wirklichkeit zugemutet, wie es historischen Gesellschaften noch nie zugemutet worden ist, denn die Erfahrung der prinzipiellen Unlösbarkeit von Problemen haben diese nie so gemacht, vor allem haben sie daran nicht geglaubt.
Florian Rötzer: Das Verlangen nach Wirklichkeit, das mit der modernen Kunst aufgekommen ist, könnte doch bereits eine Reaktion auf den individuellen oder sozial erlebten Wirklichkeitsverlust sein, also selbst noch in der Kunst, bislang Statthalterin des Scheins, nach authentischen oder realen Erfahrungen zu suchen. Eine Theorie wie die Bohrers ließe sich so als Phänomen verstehen. Das Böse, der Schrecken, der Schock sind Momente, in denen Wirklichkeit aufscheint, die einen plötzlich überfällt und als solche nicht verändert werden kann. Der Gang der modernen Kunst in die Reduktion wäre so auch interpretierbar als Herstellung einer Extremerfahrung durch Erfahrungsarmut, um noch einen letzten Punkt zu finden, der nicht mehr hintergehbar ist, damit Erfahrung sich noch vollziehen kann.
Bazon Brock: Die Schocktheorien kommen meines Erachtens durch eine ganz andere Erfahrung zustande. Der Kunst war bis zu Beginn dieses Jahrhunderts mehr oder weniger ihre Autonomie zugestanden worden, allerdings nur um den Preis ihrer Funktionslosigkeit. Die Künstler, nicht das Publikum, erlitten diesen Schock, als sie feststellten, wie wenig diese erworbene Autonomie eigentlich wert war. Sie glaubten, mit der eroberten Autonomie auch das Recht bekommen zu haben, sich im Sinne einer totalen Freiheit völlig unkontrolliert zu allem äußern zu können, und entdeckten dann, daß die Gesellschaft und vornehmlich das Bürgertum diese Autonomie in ganz anderem Sinne verstanden, nämlich sie nur zu garantieren, wenn daraus keine Konsequenzen und Interventionen entstehen. Der Schock der Moderne war der Schock der Künstler. Die Lächerlichkeit dieser Schocktheorie im Surrealismus etwa erhellt sich unter anderem daraus, daß die eigentlichen Skandalmacher die Künstler waren, die von ihrem Schock her den Skandal inszenieren wollten und damit natürlich vollkommen ins Leere liefen, denn das aufgeklärte Bürgertum sah die Autonomie der Kunst selbstverständlich nur in ihrer Funktionslosigkeit und war sofort bereit, sie zu leugnen, sobald die Künstler eine Rolle spielen, am sozialen Kampf oder an der Revolution teilnehmen wollten. Die Künstler mußten nach einer Möglichkeit suchen, dieses Ohnmachtserlebnis als etwas Kunstimmanentes darzustellen, als den Inhalt ihres formalen Schaffens. Dadurch kam es zu einer Art Aufarbeitung von Themen wie „existentieller Schrecken“, die „Ambivalenz von Freiheit und Abhängigkeit“.
Man sollte bereit sein zu akzeptieren, daß die Künstler selbst diesen Schrecken erlitten haben; gestiftet haben ihn die Richter, die darüber entschieden, ob eine bestimmte Funktion von einem Künstler eingeklagt werden kann, ein bestimmtes Einspruchsrecht garantiert wird oder eine bestimmte Stellvertretung übergeordneter Gesichtspunkte von ihm beansprucht werden kann. Den Schrecken der Künstler stifteten stets die bürgerlichen Richter. Es ist dann auch verständlich, daß Künstler selbst sich zu Richtern erheben wollten, und das geht nur in der Verschwägerung mit der Macht. Da können sie dann eine Funktion erobern, die – nur wegen ihrer Bedeutungslosigkeit gewährte – Autonomie der Kunst verlassen und die Daseinsohnmacht als Schöpfer hinter sich lassen. Sie müssen dann natürlich das Schicksal der Mächtigen teilen. Wenn diese Macht zusammenbricht, muß sich z. B. ein Arno Breker auch diesem Schicksal fügen und darf nicht reklamieren, daß er nichts anderes im Sinne gehabt habe als die edle und autonome Kunst. Das ist lächerlich. Da werden die Künstler zu weinerlichen kleinbürgerlichen Funktionären. Mich hat berührt, daß ein Machthaber, der wie Speer aus dem Kunstbereich kam, im Unterschied zu Militärs, Wirtschaftsführern oder Funktionären in der Lage war zu sagen: „Ja, ich habe das gemacht; ja, ich habe das gewollt; ja, das war für mich die Zukunft und das große Menschheitspathos; ja, das war für mich die Durchsetzung von Größe und Dauer, ich bekenne mich dazu!“
Die Gottsucher haben für mich diese Antworten alle eindeutig verweigert. Sie sind alle mit der Macht verschwägert, sind alle auf die Durchsetzungsstrategie des irdischen Paradieses, des Gottesreiches auf Erden, der Größe und des Ruhms ausgerichtet, ohne dafür bezahlen zu wollen! Sie bilden sich ein, daß sie gesellschaftlich den autonomen Anspruch der Kunst vertreten; indem sie aber einen Wirkungsanspruch erheben, tun sie gerade das nicht. Die autonome Kunst findet sich heute nur auf der Ebene, wo jemand wirklich außerhalb des Anspruchs, wirken zu wollen, arbeitet. Da kann man fast sagen, daß dies die Ebene der Laienkunst ist.
Florian Rötzer: Seit der Romantik gibt es eine Gegenbewegung zum Prozess fortschreitender Rationalisierung der Moderne. Von philosophischer Seite ist hierfür der Angelpunkt das sogenannte älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Es besagt, daß die Idee der Schönheit alle übrigen vereint. Zugleich wird von einer Idee gesprochen, die bislang noch in keines Menschen Sinn gekommen sei, nämlich, daß man über die Ästhetisierung der Ideen eine Mythologie der Vernunft erzeugen müsse und könne. Die Kunst stellt in dieser Perspektive einen Ausweg aus der Unverbindlichkeit der Moderne dar und wird etwa von Schelling als das neue Organon der Wahrheit begriffen. Dieses Programm ist im 19. Jahrhundert weiter verfolgt worden, man denke an Nietzsche und Wagner. In der Erwartung eines kommenden Gottes, Manfred Frank hat darauf hingewiesen, mündete diese Idee auch im Faschismus. Heute taucht sie wieder unter Künstlern auf, die, wie die sogenannten Transavantgardisten, nach einer neuen Verbindlichkeit suchen. Kann denn die Kunst überhaupt eine soziale Verbindlichkeit erzeugen wollen?
Bazon Brock: Zunächst zur Konsequenz der Mythologisierung der Vernunft. Das hätte ja ein verbindliches Programm sein können, wenn man dabei verstanden hätte, daß die Vernunft selber in diesem Sinne mythisch ist. Die Irrationalität ist nicht das Andere der Rationalität, sondern es ist sie selbst, wenn sie sich in einer bestimmten Weise thematisiert. Nur in ihr selber ist das ganz Andere der Vernunft thematisierbar. Mythos ist für mich ein urheberlos gewordener Aussageanspruch. Mythen sind urheberlos gewordene Erzählungen. Insofern ist die moderne Naturwissenschaft der genuine Ausdruck des mythischen Sprechens, denn ihre Lehrsätze sind urheberlos gewordene Sätze, sie erhalten ihre Geltung dadurch, daß sie nicht mehr auf ein konkretes, historisches Individuum verweisen, sondern darüber hinaus Geltung als Wahrheit erheben. Es geht also im Gegenteil immer noch um die Entmythologisierung, so wie das Bultmann und andere gesagt haben; es geht um den Nachweis, daß hinter Aussagen konkrete historische Individuen stehen. Entmythologisieren heißt, einen Aussagezusammenhang auf einen Autor zurückzuführen, d. h. auf Verantwortlichkeit, denn nur der konkrete Autor ist für das, was aus einer Aussage folgt, verantwortlich zu machen, und er macht sie auch nur im Hinblick darauf, selber Verantwortung zu entwickeln. Das aber nicht in abstracto (wie Hitler, der behauptet, für das Ganze die Verantwortung zu übernehmen), nicht in dem Sinne, daß man für irreversible Prozesse wie Tötung Verantwortung übernimmt, sondern daß man sich darauf beschränkt, so zu handeln, daß Verantwortung individuell noch zurechenbar ist.
Die Künstler haben den großen Vorteil, die Verantwortung für ihr Tun relativ leicht übernehmen zu können, weil das, was sie auf dem Papier, auf der Leinwand oder im Atelier machen, reversibel ist. Gerade wenn sie Autonomie anstreben, also auf der Ebene des virtuellen ästhetischen Scheins arbeiten, ist Verantwortlichkeit gegeben, da ihre Formulierungen widerrufbar sind. Die Werke müssen nicht in Konsequenzen umgesetzt werden. Wenn sie hingegen vom Atelier auf die Straße vordringen wollen und von Bayreuth auf den Königsplatz von München transportiert werden, dann ist es mit der künstlerischen Freiheit und der Verantwortlichkeit des Künstlers aus, der sie dann an die Macht delegiert, die ihm Erzwingungsstrategien zur Verfügung stellt. Richtig verstanden, ist der Kunstbereich heute der, in dem Verantwortung im eigentlichen Sinne getragen werden kann.
Florian Rötzer: In der Kunst ist, was Sie ja positiv formulieren, die Rückbindung des Werkes an den einzelnen Künstler entscheidend, damit es auf dem Markt oder im Bewußtsein der Menschen einen Stellenwert erlangt. Hier wird noch das Individuum gefeiert, vielleicht auch kompensatorisch stilisiert, während es ansonsten zunehmend an Bedeutung verliert, zumindest insoweit, Subjekt authentischer und einmaliger Erfahrungen und Handlungen zu sein. Gegen dieses Bedürfnis des Marktes nach einem unverwechselbaren Individuum, das dem Werk seine verwertbare Aura verleiht, gab es ja Versuche, kollektiv etwa Bilder zu produzieren, die am Markt allerdings regelmäßig gescheitert sind, weil die Identifizierungsmaschine daran abrutscht. Sehen Sie denn in der kollektiven Produktion gleichfalls eine Analogie zu den Mythen, weil diese eher anonym ist, keiner ganz für das verantwortlich gemacht werden kann, was gemeinsam produziert wurde, oder ist die Kunst, die das große, geniehafte und verantwortliche Individuum feiert, nur die ausgleichende Utopie für die ansonsten anonymisierenden Verhältnisse?
Bazon Brock: Die Arbeit in Gruppen ist die herausforderndste Art der Arbeit für Künstler. Es ist ja kein Kunststück, als Profikünstler dem Publikum gegenüberzutreten und ihm etwas vorzuzaubern bei entsprechender Beherrschung seines Metiers. In Gruppen integriert man die rezeptiven und die produktiven Aspekte in ein und derselben thematischen Arbeit. Man ist sich wechselseitig Rezipient und Produzent. In die Gruppe flüchten ja nicht, wie man zumeist behauptet, lauter schwache Individuen; für Künstler bietet sie Gelegenheit, verschiedene, gleichermaßen begründete und entwickelte Ansprüche auf Individualität zu erheben. Ein schwach entwickelter Charakter kann einem stärker entwickelten das nicht zugestehen, nur in einer Gruppe von gleich entwickelten und prononcierten Persönlichkeiten ist das möglich. Dann ist die Arbeit in der Gruppe wirklich die entscheidende Utopie, weil man auf derselben Ebene produziert und rezipiert, kein Gefälle zwischen Laien und Profis in Anspruch nehmen muß, sondern hier würde es tatsächlich um die Erörterung der Sachverhalte selber gehen in der Zurechenbarkeit der Aussagen zu ihrem jeweiligen Urheber. Daß der Markt in der Kunst solche Arbeiten nicht akzeptiert, müßte uns eigentlich nicht interessieren, wenn sich nicht so viele Künstler davon abschrecken ließen, so zu arbeiten, weil es ziemlich sicher ist, daß sie auf dem Markt als Künstler keinen Erfolg haben werden. Andererseits ist das auch nicht schade, denn wenn Künstler von sich glauben, daß sie dazu sowieso nicht in der Lage wären und nur auf die Vermittlung von Macht, Geld und Unsterblichkeit ausgerichtet sind, dann sind sie in meinen Augen keine zeitgemäßen Künstler.
Zeitgemäßheit definiert sich jetzt unabdingbar in einer Kultur diesseits von Macht, Geld und Unsterblichkeit. Das gilt es jetzt, wie überall sonst, auch in der Kunst einzusehen. Bislang hielt man nur Künstler für gruppenfähig, die über keine ausgeprägte Wirkungsabsicht verfügen; die tatsächliche Entwicklung zeigt jedoch eher das Gegenteil. Wenn sich in der Kunst das nicht durchsetzt, dann wird ihr das aufgezwungen werden von der Ökonomie und dem sozialen Bereich. Für mich ist das die einzige Form, in der ich eine Vorstellung von mehr als dem jetzt Möglichen erschließen kann. Das ist auch das Ideal der Wissenschaften gewesen. Wenn wir nichts davon retten, werden wir unsere Handlungsfähigkeit in der Wissenschaft und der Kunst verlieren.
Die Wissenschaft hat den größten Teil ihrer Glaubwürdigkeit schon durch das Unverantwortlichwerden der Wissenschaftler eingebüßt. Der Fall Tschernobyl hat bewiesen, daß dort kein Mensch mehr die Verantwortung dafür übernimmt, was er als Wissenschaftler in die Welt setzt. Aber wo das Drohende ist, wächst auch das entsprechend Rettende. Und das ist nichts Höheres oder Ewiges, sondern die Einsicht in unsere ungeheuerliche Ohnmacht vor der Wirklichkeit. Das gelingt in Anerkennung des Alltäglichen und Banalen, des Selbstverständlichen als des Heiligen. Keine Erlösung im Jenseits, sondern die Anerkennung der eigenen Ohnmacht und Beschränktheit und der Verfallenheit an die Banalität, das Geschwätz, die Beiläufigkeit. Wer darin noch ohne Prätention zu philosophieren versteht, der wird zu Aussagen kommen, die einen gewissen Wert haben; alles andere ist doch nur die Fütterung des Unterhaltungsbedürfnisses und die Bedienung des Marktes.
Florian Rötzer: In den letzten Jahren ging es in der Ästhetik auch um die Frage, ob es so etwas wie eine weibliche Ästhetik gibt. Ist diese Debatte nur eine notwendige Kompensation der historischen Ausgrenzung der Frau aus der Kunst und so die Behauptung einer spezifisch weiblichen Ästhetik nur ein theoretisches Konstrukt?
Bazon Brock: Sicherlich ist das eine berechtigte Reaktion auf die jahrhundertelange gegenteilige Erfahrung. So etwas wie eine weibliche Ästhetik im Sinne der Begründung einer Differenz aus der Geschlechterzugehörigkeit kann es sicher nicht geben. Ich finde es auch nicht hilfreich, wenn man auf diesem Wege, obzwar aus verständlichen Gründen, zu argumentieren sucht. Natürlich kann man sagen, daß geübte Leute mit einer unwahrscheinlichen Treffsicherheit sagen können, ob dieses Bild oder diese Skulptur von einer Frau oder einem Mann ist. Das hat aber nichts mit einer prinzipiellen Ästhetik der Frauen oder Männer zu tun, sondern einfach damit, daß die Frauen viel weniger in der Lage sind, die herrschenden Codes, die herrschenden Muster der Stiftung von Bedeutung oder des Differenzierungsgefüges sich anzutrainieren und damit selbstverständlich zu operieren. Sobald das der Fall sein wird, werden sich diese Unterschiede nivellieren. Auf jeden Fall wird die Emanzipation nicht durch diejenigen vorangetrieben, die die Besonderheit der Position von Frauen betonen, sondern von denjenigen, die die Gleichförmigkeit der Problematiken und Positionen von Frauen und Männern betonen. Die Absicht, die Ästhetiken der Künstlerinnen und die der Künstler voneinander abzugrenzen, besteht darin, sie wechselseitig nicht ernst nehmen oder sich auf sie einlassen zu müssen.