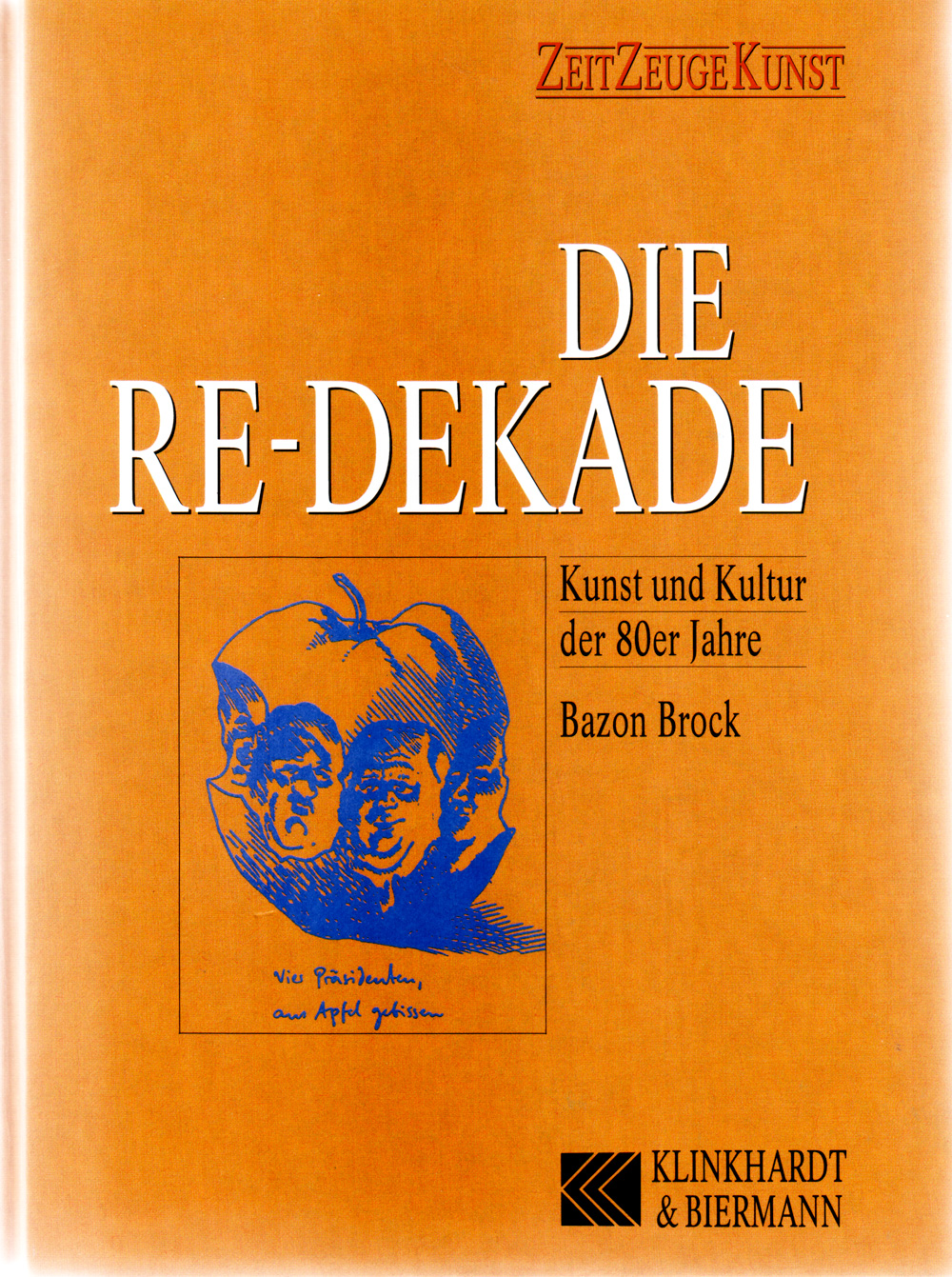Mit der Auflösung von „Stil“ als Ordnungs- und Gestaltungsprinzip verlagerte sich das Interesse der Gestalter auf das Design. Designt aber wurden im wesentlichen Einzelobjekte, zum Beispiel Möbel, zum Teil in hervorragenden Einzelentwürfen. Die Plazierung dieser Objekte im Innenraum blieb eine bloße Addition. Das hatte immerhin den Vorteil, Ausstellungsgegenstände unterschiedlichster Gestaltungskonzepte und unterschiedlichster Materialien wie Holz, Glas, Stahl, Leder, Kunststoff, Stein „zusammenstellen“ zu können. Ja, man hatte es geradezu zum Programm erhoben, die unterschiedlichsten, „unverträglichsten“ Gestaltungskonzepte und Materialien gerade wegen ihrer jeweiligen besonderen gestalterischen Eigentümlichkeiten zusammenstellen zu sollen, woraus sich eine Art Stil der Stillosigkeit ergab, der heute dominiert als bewußte Zusammenstellung des Unterschiedlichsten und Heterogensten. Je unvereinbarer die Einzelobjekte, desto „interessanter“ scheint die Zusammenstellung zu wirken.
Design anstelle der herkömmlichen Innenarchitektur hatte die Tendenz, sich als künstlerisch autonome Gestaltung zu verstehen, obwohl Design als Gestaltung auf das Gegenteil von singulärer Kunstproduktion, nämlich auf die Gestaltung industriell gefertigter Massenprodukte ausgerichtet sein sollte. Der Wunsch der Designer, Künstler zu sein, ergab sich einerseits daraus, daß die ersten Designer bildende Künstler gewesen sind – siehe Bauhaus –, zum anderen besaß der Designer trotz seines „modernen“ Berufs nur wenig Sozialprestige; als Künstler wurde man höherrangig eingeschätzt.
Die Präsentation von Kunstwerken aber ist seit Beginn des Jahrhunderts bewußt raumneutral gehalten worden; seit Loos' ungeheuer folgenreicher Erfindung der weißen nackten Wand in ornamentfreien geometrischen Bauskulpturen präsentierte man allenthalben in Galerien, Museen und Privaträumen Kunstwerke (Skulpturen und Malereien) vor oder auf den nackten weißen Wänden: die Architektur wurde gleichsam weggeblendet, um die Kunstwerke besonders auffällig, nur auf sich selbst verweisend, vorzuzeigen. Die herkömmliche Beziehung zwischen Bild und Nichtbild, zwischen Kunstwerk und Architektur wurde aufgelöst. Die Architekturen wurden zu bloßen Bildträgern degradiert (ähnlich wie vor der Entwicklung der Tafelbildmalerei; erst im 15. Jahrhundert entstand zum Beispiel durch Brunelleschi die Auffassung der Wand als eigenständiger Architektur, die nicht mehr bloß Bildgrund für die Wandmalerei sein sollte).
Die designten Gebrauchsgegenstände präsentierten sich in den neutralisierten Räumen wie Einzelskulpturen; das hatte immerhin den Vorteil, die Nutzer und Betrachter überhaupt erst auf die Tatsache hinzuweisen, daß ja alle Objekte unserer Lebensumgebungen gestaltet sind und daß es sehr unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten gibt.
Durch die Ausweitung der industriellen Massengüterproduktion und das heißt, durch die Verbilligung der Industrieproduktion gegenüber der handwerklichen Fertigung, ließen sich immer mehr Bauherren aus ökonomischen Gründen darauf ein, nicht nur für den Bau selber, sondern für dessen Inneneinrichtung Fertigteile zu verwenden. Soweit die Innenausstattung überhaupt noch als eigenständige Gestaltungsaufgabe akzeptiert wurde und nicht nur als dem Gesamtbau gegenüber vernachlässigbare Folgemaßnahme ohne eigenständiges Gestaltungskonzept galt, sahen sich die wenigen übriggebliebenen Innenarchitekten, oder besser die Designer, genötigt, für die Innenausstattung am Markt gerade angebotene Massenprodukte zu verwenden. Dieser Zwang wurde noch verstärkt durch die zunehmenden Zwangsnormierungen, wie sie von Gewerbeaufsicht, Feuerwehr und Bauordnungen festgeschrieben wurden. Die Innenarchitekten verloren ihr Aufgabenfeld, konzeptuell selbständige und auf den jeweiligen Raum hin unverwechselbar einmalige Lebens- und Arbeitsumgebungen zu entwickeln. Trotz aller Gegenbewegung, wie sie schon im 19. Jahrhundert von Schinkel über Morris bis zu den Gründungsmitgliedern des Werkbunds zu Anfang unseres Jahrhunderts initiiert wurde, löste sich die Mehrzahl der Architekten unter ökonomischen Gegebenheiten und denen der vornehmlich technisch geprägten Massengüterproduktion von ihrer Aufgabe, mit Innenarchitekturkonzepten nicht nur die nackten Raumkörper zu definieren, sondern diese Raumarchitektur als Lebensraum zu gestalten. Auch gegenüber der Architektur wurden immer wieder Forderungen nach dem Gesamtkunstwerk laut; bis auf wenige Ausnahmen konnte aber dieser Forderung nicht entsprochen werden. Das lag vor allem an der verlorenen Maßstäblichkeit, nach der vom Größten bis zum Kleinsten, vom Baukörper im städtischen Architekturensemble bis zum Löffel auf dem Tisch gestaltet werden konnte. Die wenigen Versuche, solche Maßstäbe erneut zu finden, zum Beispiel als Le Corbusier'sches „Modul“, scheinen offenbar wenig überzeugend gewesen zu sein: man bezweifelte immer stärker, ob es überhaupt einen sinnvollen einheitlichen Maßstab für die Gestaltung des Größten wie des Kleinsten geben kann. Die immer wieder angeführten historischen Beispiele (etwa die maßstäbliche Einheit, in der sowohl die gotische Kathedrale wie die kleinsten Reliquiare gestaltet worden waren) wurden eher als Kuriosität denn als vorbildhafte Ordnungsprinzipien verstanden.
Als solche Kuriositäten galten lange die einheitsmaßstäblichen Gesamtkunstwerkarchitekturen von Rudolf Steiner oder die der Bastelfanatiker à la Picassiette oder die Bauten von Salvador Dali. Wirksam wurde die Gegenbewegung gegen das Auseinanderfallen von Außen- und Innenarchitektur nur in einem Bereich, den wir gegen alle ideologische Besetzung auch heute noch unter dem Programmnamen „Schönheit der Arbeit“ fassen können; denn diese Auffassung lichtdurchfluteter, sauberer, überschaubarer, humaner Arbeitsstätten als Fabrik und Werkstatt wurde ja nicht von den Nationalsozialisten, sondern von den Bauhäuslern entscheidend geprägt. Diese Beispiele sollten allerdings für die Innenarchitektur nicht überschätzt werden, da es in den Fabriken und Werkstätten wenig für den Innenarchitekten (außer Farbgebung, Klimatisierung und Orientierungssystemen) zu gestalten gab.
Die Innenarchitekten verloren wesentliche ihrer Arbeitsbereiche auch durch die angeblich fachmännische Beratung, die das Verkaufspersonal von Einrichtungshäusern ihren Kunden versprach und verspricht. Es soll nicht bestritten werden, daß es einzelne Einrichtungshäuser gibt, in denen innenarchitektonisch ambitionierte Berater tätig sind. In der überwiegenden Zahl der Fälle aber bleibt die Beratung bei beliebig begründeten Geschmacksurteilen hängen. Der Verkäufer versucht, den vermuteten Geschmack des Käufers zu bedienen; der Käufer rettet sich mit dem Diktum, schließlich sei alles Geschmackssache, so daß gegen seine Wahl nichts Entscheidendes eingewendet werden könne. Alles ist aber nur Geschmackssache, solange man einen Geschmack hat, und das heißt, wenn man unterscheidungsfähig ist, also überhaupt unterschiedliche Stil- und Gestaltungskonzepte, Raum- und Lebensraumprägungen voneinander unterscheiden kann; denn eine begründete Auswahl kann es nur als Wahl zwischen gleichgewichtigen Alternativen geben. Diese Alternativen überhaupt sich vorzustellen, dazu fehlt es an ästhetischer Kultur.
Es ist auffällig, wie gerade in unserer Gesellschaft (ohne kritische Leitbildfunktion einer Oberschicht) die ästhetische Erziehung vernachlässigt worden ist. Die Mehrzahl der Mitglieder unserer Führungseliten in Wirtschaft, Politik, Universität hält die ästhetische Erziehung offenbar, vor allem bei sich selbst, für eine vernachlässigbare Größe gegenüber den angeblich entscheidenden Faktoren: wirtschaftlicher Erfolg und mehrheitsfähiger Konsens.
Unter diesen einigermaßen betrüblichen Voraussetzungen, vielleicht gerade wegen dieser nicht länger akzeptablen Gegebenheiten, entwickeln sich seit einigen Jahren Tendenzen zur Wiedergewinnung der eigenständigen AufgabensteIlungen für Innenarchitekten. Das geschieht vornehmlich unter dem Druck a) zur Entfaltung von Corporate Culture als Voraussetzung wirtschaftlichen Erfolgs (82); b) zur Gestaltung von Kaufhäusern, Restaurants und Diskotheken, Touristenherbergen und Dienstleistungszentren als Erlebnis- und Ereignisräumen (83); c) autonomer künstlerischer Entwicklungen (84); d) von Absatzstrategien für anspruchsvolle Designobjekte (85); e) prägende und erinnerungsfähige Orte für gesellschaftliche Rituale zu schaffen (86).
Entfaltung der Corporate Culture als Wirtschaftsfaktor
Wo bisher nur die Gestalter, die Designer, von den Unternehmen zur Ausprägung ihrer Corporate Identity (vom Briefbogen über den Arbeitskittel bis zur Gestaltung der Auslieferungsfahrzeuge; von der Verpackung über das Display bis zur kompletten Werbekampagne) in Anspruch genommen wurden, da entsteht seit einiger Zeit der Ruf nach umfassenden Konzepten unter Führung von Architekten und Innenarchitekten. Diese Aufgabenstellung wird von den Konzepten der Unternehmenskultur, der Corporate Culture, erzwungen. Nicht nur international operierende Großfirmen wie Eni oder Olivetti, Philip Morris oder IBM, Deutsche Bank und Bertelsmann, sondern auch Firmen mittlerer Größe haben inzwischen erkannt, in welchem Umfang das Firmenschicksal nicht nur von ökonomischen und politischen Entwicklungen abhängig ist, sondern von sozialen und vornehmlich kulturellen.
Die Firmen nahmen zur Kenntnis, daß sie Sozialverbände sind, deren innerer Zusammenhalt, wie bei allen Sozialverbänden, vornehmlich kulturell gewährleistet wird, zumal dann, wenn unabdingbare Minimalvoraussetzungen sozialer, politischer und ökonomischer Sicherheit bereits erreicht wurden. Das Führen der Unternehmen wird damit selbst zu einer kulturellen Aufgabe, für die eine eigene kulturelle Infrastruktur geschaffen werden muß. Durch nichts wird diese Infrastruktur derartig geprägt wie durch die Architektur der Handlungs- und Lebensräume einer Firma. Damit ist gemeint, daß die Firmen sich nicht nur an ihren nur von außen Nicht-Repräsentationsbauten und sonstigen Erscheinungsbildern identifizieren lassen sollten, sondern daß sich die Firmenkultur nach innen und von innen für die Mitarbeiter ausprägen muß. Genau das stellt aber Probleme, die nur von konzeptuell umfassend denkenden und gestaltenden Architekten/Innenarchitekten bearbeitet werden können. Da reichen Designer von Einzelproblemstellungen nicht aus. Um ein kulturelles Klima als Ausdruck des kulturellen Selbstverständnisses einer Firma zu schaffen, müssen Arbeits- und Lebensräume entworfen werden, deren Einheit als Ganzes wie im kleinsten Detail deutlich zu spüren ist. Leider sind bisher viele auf den Gesamteindruck ausgerichtete Innenarchitekturen wenig glaubwürdig, weil sie im Detail entweder durch Nachlässigkeiten oder Unfähigkeiten der Architekten oder der ausführenden Handwerker sabotiert werden. Immer noch werden Oberflächenqualitäten nur durch Simulationen kaschiert; immer noch werden aus angeblich technischen Zwängen grauenerregende Deckenverblendungen verwendet; immer noch geht man an den Testergebnissen der Farbpsychologie und der Wahrnehmungspsychologie in sträflicher Weise vorbei; immer noch wird verdrängt, daß es Klimatisierung und eine künstliche Lichtatmosphäre nur geben kann, wenn man fälschlich behauptet, die Zufuhr von Frischluft, die Garantie einer Durchschnittstemperatur und die optimale Belichtung von Arbeitsflächen bildeten allein schon die Komponenten von Klima und Atmosphäre.
Wir dürfen hier aus verständlichen Gründen keine Beispiele nennen, eines ist aber jederzeit beweisbar: die überwiegende Zahl firmeneigener Handlungs- und Lebensräume wird in ihren katastrophalen Auswirkungen auf soziale Bindungs- und Identifikationsfähigkeit, auf Konzentration, Motivation und allgemeines gesundheitliches Wohlbefinden der Firmenangehörigen von diesen nur deswegen nicht erkannt, weil sie ästhetisch völlig unbedarft sind und deswegen ihre Irritation durch andere Gründe, zumeist subjektive, zu klären, das heißt akzeptabel zu machen versuchen. Dieses Desaster herrscht selbst in Unternehmen, die von der Produktgestaltung, von der Zulieferung von Elementen architektonischer und innenarchitektonischer Gestaltung leben. Dieses Desaster herrscht selbst in Design-Instituten wie dem CCI des Centre Pompidou, wo die Mitarbeiter zu Dutzenden in kleinen Kälberpferchen aus brusthohen, angeblich blattgrünen Verstellwänden hausen.
Wie gesagt, immer mehr Firmen erkennen ihren kulturellen Auftrag auch und vor allem gegenüber ihren eigenen Mitarbeitern; da gegenwärtig eine Unzahl von Pseudoinnenarchitekturen allein schon deswegen umgestaltet werden muß, weil die verwendeten Materialien inzwischen als gesundheitlich bedenklich erkannt wurden, geht der Appell an die Innenarchitekten, der Bereitschaft der Firmen zur kulturellen Leistung durch alternative, aber jeweils auf die konkrete Aufgabe bezogene Konzepte zu entsprechen. Nicht länger gilt, für die Architekten ebensowenig wie für die Innenarchitekten, die Ausrede, die auftraggebenden Firmen hätten die Realisierung großartiger Konzepte durch kleinbürgerliches Kaufmannsdenken verhindert. In Wahrheit scheinen viele potentielle Innenarchitekten ihrerseits durch zu enge kulturelle Horizonte daran gehindert zu sein, überzeugende Alternativen zu entwickeln.
Firmenkultur läßt sich nicht länger durch punktuelles kulturelles Engagement für Sinfonieorchester, Kunstausstellungen oder die Restaurierung von Renaissancekirchen glaubhaft machen, wenn von den kulturellen Werten nichts auf die firmeneigene Kultur einwirkt: die hohen kulturellen Ansprüche sollen nicht in firmenfremden Objekten hervorgehoben werden, sondern in den Firmen selbst. Es macht keinen Sinn, noch so großartige künstlerische Gedanken in Ausstellungen zu präsentieren, wenn die Firmen in einem chaotischen Sammelsurium gestalterischer Beliebigkeiten hausen. Hier sind Innenarchitekten gefordert, die wissen, daß ein Handlungs- und Lebensraum nicht aus der Addition einzelner Designobjekte (möglichst noch hierarchiebezogener Abstufungen nach Materialwert und Raumgröße) besteht. Sinnvolle Differenzierung im optischen Erscheinungsbild ist nicht nur illustrative Zugabe zur Firmenphilosophie; in ihr erhält eine Firmenphilosophie erst Substanz.
Erlebnis- und Ereignisräume
Bemerkenswerte Veränderungen im Aufgabenbereich der Innenarchitekten entstanden aus der Zielvorgabe, Kaufhäuser, Restaurants, Diskotheken und andere Dienstleistungszentren als Erlebnis- und Ereignisräume zu gestalten. Die Räume figurierten wie Bühnenbilder für Theaterinszenierungen. Durch die Integration von Produktausstellung, Verkaufsraum und Kundenpassage in Kaufhäusern, durch die Integration von Küche und Speiseraum in den Restaurants, von Funktions- und Aktionsräumen in den Diskotheken, von Verkaufsbüro und Animationszentrum in Verkehrsbüros wurden diese neuen Innenarchitekturen seit Ende der 70er Jahre zu Bühnen, in deren Kulissen Publikum, Verkäufer, Animatoren fast ununterscheidbar voneinander agierten. Für Messen (ein gewaltiges Arbeitsfeld für Innenarchitekten, seit die bloße Standgestaltung nicht mehr konkurrenzfähig ist) wurden besondere Interaktionsmodelle geschaffen, bei denen die präsentierten Produkte das Spielmaterial der Interaktion bildeten.
In all diesen Erlebnis- oder Ereignisräumen konnten die Objekte nicht mehr wie bisher additiv nebeneinander präsentiert werden, sondern mußten in thematisierten Einheiten inszeniert werden – thematische Einheiten, die sich in Raumstimmung, Exponierverhalten des Publikums, des Personals und der Produkte auffällig voneinander unterscheiden sollten. Besondere Berücksichtigung mußte bei diesen Inszenierungen von Ereignis- und Erlebnisorten die Tatsache finden, daß wir nicht mehr wie bisher primär über das Auge, also visuell, die prägende Kraft der Räume erfahren, sondern über die Anregung des Tastsinns und vor allem über die Akustik, also das Hören. Zwar wird die Orientierung in den Räumen weiterhin in erster Linie optisch vermittelt, aber das Raumerleben selber wird durch haptische Aneignungsreize und musikalisch/akustische Hintergründe bestimmt. Die musikalisch/akustischen Ereignisse und die Tast- und Aneignungsreize leiten weitgehend die visuelle Wahrnehmung an; die Innenarchitekten vollziehen nun auch, was die Filmproduktion schon lange vorexerziert hat: die Filmmusik bereitet den Kinogucker auf die gewünschte Interpretation und Erlebnisform eines Geschehens in der Spielszene vor.
Ähnliche Anleitungsfunktion hat die Musik in fast allen Erlebnis- und Ereignisräumen. Das schafft zugleich aber Probleme, zum Beispiel solche der Schalldämpfung und der akustischen Raumsausgrenzung, die nur unter Verwendung entsprechend leistungsfähiger Produkte der Zulieferindustrie bewältigt werden können.
Die bedeutsamen innenarchitektonischen Tendenzen lassen sich in diesem Zusammenhang unter dem Begriff der Inszenierung zusammenfassen: Mit dem Begriff „Inszenierung“, dem verbreitetsten Verständigungsbegriff über diese Tendenzen, wird ausgedrückt, daß der Innenarchitekt gleichsam Regisseur eines komplexen Geschehens wird. Nicht nur öffentliche, halböffentliche, sondern auch private Lebensräume werden zu Bühnen, auf denen alle Beteiligten Gelegenheit haben sollen, die unterschiedlichsten Rollen zu spielen. „Wir alle spielen Theater“, konstatierte schon vor einem Jahrzehnt der amerikanische Soziologe Goffman und drückt damit aus, daß die Soziologen allgemein dazu übergegangen sind, soziales Geschehen wie inszenierte Theaterstücke zu betrachten. Bühnen sind Simulationsanlagen, auf denen Verhaltensweisen, Wahrnehmungsformen und Aktionstypen durchgespielt werden. Da wir alle in unserem Verhalten nicht mehr durch Erziehung, durch Schichtenzugehörigkeit, durch Statusposition festgelegt werden, erwarten wir in den inszenierten Ereignis- und Erlebnisräumen Anleitungen, Anregungen und Verführungen zum Durchspielen abweichenden Verhaltens; wir wollen unsere Aktions- und Reaktionsmöglichkeiten erweitern, indem wir bei solchen Gelegenheiten die Aktions- und Reaktionsformen möglichst vieler anderer Menschen (zumal nur probeweise und beschränkt auf die Zeit des Aufenthalts in diesen Räumen) durchprobieren.
Dazu die Möglichkeit zu bieten, ist die hohe Kunst der Inszenierung von Ereignis- und Erlebnisräumen. In diesem Sinne wird vom Publikum heute bereits erwartet, daß selbst Ausstellungen zur Verkehrsaufklärung inszeniert sind, von Kunstausstellungen jeden Typs und von der Inszenierung von Freizeiträumen ganz zu schweigen. Die vor kurzem noch allein von Kunstausstellungen und Freizeitparks entwickelten Standards der Inszenierung gelten längst für Kaufhäuser, Diskotheken etc., weil die Grenzen zwischen Freizeit und herkömmlicher Arbeitszeit durchlässig geworden sind. Für die meisten Zeitgenossen ist Einkaufen zur Freizeittätigkeit geworden. Da aber Freizeit nur beschränkt zur Verfügung steht, erwartet man auch in einem großen Teil herkömmlicher Arbeitsräume verdichtete Rauminszenierungen vom Typus der Erlebnis- und Ereignisräume. Daß diese Tendenz auch sehr bedenkliche Aspekte aufweist, ist bekannt. Wenn alles zum inszenierten Spiel wird, gehen viele Unterscheidungskriterien, auch die der Qualität, verloren. Die Urteilsfähigkeit des Publikums nimmt ab. Es ist nicht beliebig möglich, dagegen mit immer weitergehenden, auftrumpfenden Übersteigerungen ästhetischer Reize anzugehen. Der bereits jetzt erkennbare Ausweg wird wohl darin bestehen, die Einzelinszenierungen thematisch scharf gegeneinander abzusetzen, also Ereignis- und Erlebnisräume zu schaffen, die jeweils nur noch unter einem Thema stehen. Trotz aller postmodernen Theorien und mancher tatsächlichen Beweise kann sich das Schreckgespenst einer Totalsimulation unseres Erlebens und Handelns in der Welt nicht verwirklichen, wenn wir hinreichend unterscheidungsfähig bleiben oder werden. Daran verantwortungsbewußt mitzuwirken, wird gerade von Innenarchitekten als Inszenatoren unserer Lebensräume zu fordern sein.
Autonome künstlerische Entwicklungen!
„Inszenierung“ ist nicht das einzige Konzept, das aus dem Bereich der bildenden Künste, des Theaters, der Musik in die Gestaltung unserer Alltagswelt übernommen wurde. Seit den 70er Jahren arbeitet vor allem in Deutschland eine Reihe von Künstlern wie Palermo, Knöbel, Förg, G. Merz daran, die Beziehung zwischen Bildern, Skulpturen, Objektensembles einerseits und der Innenraumarchitektur andererseits zu verändern. Diese Künstler gestalten nicht nur mit großer Sorgfalt, vor allem durch Farbgebung, die Räume, in denen sie ihre Kunstwerke ausstellen, sondern sie stellen die Räume selber als Einheit von Raum, Bild und Skulptur aus. Die herkömmliche Unterscheidung zwischen Kunstwerk und Ausstellungsraum, zwischen Bild und Nichtbild wird rückgängig gemacht. Der Ausstellungsraum wird als Bild lesbar, als Skulptur erfahrbar. Da die Räume immer größer sind als das in ihnen Ausgestellte, gewinnen die künstlerischen Aussagen mit der Ausstellung des Raumes selbst andere Dimensionen, die allerdings häufig (durch ihre Monumentalität) als zu überwältigend kritisiert werden. Wie immer man das Pathos dieser Versuche beurteilen mag, in ihnen ist ein radikaler Wille zur Form nicht übersehbar. Diese Versuche wirken deswegen wohltuend, weil sie zeigen, wie man auch ohne Stilzwang und ästhetische Überbietungsstrategien zu geordneten, also thematisch abgegrenzten Raumwirkungen kommen kann, bei Wahrung höchster qualitativer Ansprüche. Beispiele zeigen, daß diese Ansätze nicht auf Museen und Galerien beschränkt bleiben müssen, sondern auch in profanen Innenräumen, etwa von Verwaltungsgebäuden oder Banken, Bestand haben.
Absatzstrategien
Eine Aufgabenstellung für Innenarchitekten ergibt sich auch aus der Designentwicklung selbst. Seit Ettore Sottsass schulbildend zu werden begann, also seit den Tagen der Gründung von Alchemia und Memphis, verschob sich die Grenze zwischen Kunstwerk und Gebrauchsgegenstand erheblich. Heute gibt es international viele junge Designer, die die Unterscheidbarkeit von Kunstwerk, zum Beispiel als Skulptur, und Designobjekt, zum Beispiel als Möbel, grundsätzlich leugnen. Damit man eine Skulptur als Tisch oder Stuhl, als Gedeck oder Lampe, akzeptieren kann, und der Stuhl, die Lampe, der Tisch, das Gedeck als Skulptur wirken können, müssen besondere Räume konzipiert werden, die bisher nur von den vielgeschmähten Yuppies tatsächlich auch als Lebensräume akzeptiert werden. Als inszenierte Bühnen haben sie sich aber in der Werbung und der Zeitschriftengestaltung durchgesetzt, zum teil auch bei der Einrichtung von Hotels sowie Konferenzzentren und in der Festarchitektur.
Der erinnerbare Ort – Rituale
Die Entwicklung einer neuen Festarchitektur ist ebenfalls ein außerordentlich lohnender und nachgefragter Entwurfstyp für Innenarchitekten. Bisher haben sich leider nur Dienstleistungsagenturen darauf spezialisiert, für Firmen und Private Feste in eigens dazu konzipierten Dekorationen auszurichten. Aber bei den Dekorationen kann es nicht bleiben. Es hilft nicht viel, die Geburtstagskinder, Firmenjubilare, Staatsgäste nur in andere Dekorationen zu stecken; es geht auch um die Entwicklung eines neuen Verhaltens und neuer Geschehensformen, die wir als festlich empfinden können. Da vor allem von den Festräumen der entscheidende Einfluß auf das Verhalten und die Aktionsformen der Festteilnehmer ausgeht, sind Innenarchitekten in Zukunft gesucht, die prägende und erinnerungsfähige Orte für gesellschaftliche Rituale zu schaffen vermögen.
Diese Rituale können von Kommunikationsdesignern nicht beliebig abstrakt, sondern nur mit Bezug auf konkrete Festarchitekturen entwickelt werden. Die Typologie des einprägsamen Ortes – und wo wäre sie wichtiger als für das Festefeiern? – ist noch sehr unterentwickelt. Staatsakte und Privatveranstaltungen werden mit Vorliebe in historische Architekturen des vordemokratischen Zeitalters, in Schlösser, Tempel, Ruinen verlegt, weil diese Architekturen tatsächlich noch als einprägsame Orte erlebt werden können. Mit denen kann kaum eine der spärlichen Festarchitekturen heutiger Innenarchitekten konkurrieren. Es muß aber doch, von allen anderen Gründen abgesehen, jeden Innenarchitekten herausfordern, zeitgemäße Konzepte des einprägsamen Ortes gesellschaftlicher Rituale zu entwickeln. Und den verschiedensten Gruppierungen unserer heutigen Gesellschaft muß es doch langsam bedenklich erscheinen, daß sie ihr kulturelles Selbstverständnis vornehmlich in historisch überkommenen Festarchitekturen manifestieren. Man kann nicht auf Dauer die Rituale einer feudalen ständischen Gesellschaft als Vorbilder für eine internationale Industrie- und Informationsgesellschaft beibehalten; so wichtig auch historische Kontinuität gerade für die Entfaltung gesellschaftlicher Rituale sein mag: die Mehrzahl dieser historischen Übernahmen ist inzwischen völlig sinnentleert, sie können nur noch als blanke Show inszeniert werden; damit verlieren sie aber ihre Verbindlichkeit.
Das Beziehungsgeflecht zwischen Menschen ist nur dann sinnvoll als deren Kultur anzusprechen, wenn diese Beziehungen Verbindlichkeit gewährleisten. Bei einer Abräum- und Wegwerfmentalität, die es ja auch im Bereich der Architektur und Innenraumgestaltung gibt, muß solche Verbindlichkeit der Beziehungen, also Kultur, geradezu vernichtet werden; das kann sich keine Gesellschaft leisten, es sei denn um den Preis weiterer optischer und akustischer Umweltverschmutzung durch gestalterische Willkür. Von wem sonst als von den Architekten/Innenarchitekten können wir Abhilfe erwarten, die ja auch gegen unsere eigene Nachlässigkeit und Kurzsichtigkeit durchgesetzt werden muß.
Man wünscht den Architekten/Innenarchitekten die nötige Unnachgiebigkeit bei Auftraggebern, Bauherren, Kritikern und vor allem beim Publikum, formale und materiale Ansprüche durchzusetzen, in unser aller weitsichtigem Interesse. Ein guter Architekt ist ja nicht nur ein Architekt, der ein gutes Konzept aufs Papier bringt; ein guter Architekt ist nur, wer gute Konzepte durchsetzt, wer mit seinen Konzepten Auftraggeber und Publikum überzeugt, über die willfährige Erfüllung bestehender Erwartungen hinauszugehen. Das ist schwer. Aber wäre es denn überhaupt lohnend, den Innenarchitekten als zentrale Figur unseres Kulturschaffens wiederzuentdecken, wenn diese Aufgabe nicht eine gewaltige Herausforderung darstellte?
Vom erweiterten Kunstbegriff zur Kulturgesellschaft
Die Debatte um den erweiterten Kunstbegriff initiierte Joseph Beuys. Er fragte sich und seine Zuhörer, was wohl dabei herauskäme, wenn man nicht nur Malereien und Skulpturen nach den mehr oder weniger etablierten Kriterien der Kunstproduktion und Kunstrezeption beurteilte, sondern auch die übliche Warenproduktion, den Kapitalverkehr und den Warenkonsum unter Gesichtspunkten zu werten versuchte, die bisher Kunstwerken vorbehalten waren.
Die Überlegungen von Beuys gingen einerseits von den in den 60er Jahren leidenschaftlich vorgetragenen Argumenten gegen Kunstwerke als Waren, als Handelsprodukte und Konsumprodukte aus. Viele kritische Geister glaubten damals mit einigem Recht, den Phänomenen der Kunst besser beikommen zu können, wenn man auf die herkömmliche schöngeistige Erörterung verzichtete und Kunstwerke statt dessen als schiere Wirtschaftsgüter wie Automobile und Modeartikel, wie Investitionsgüter und Produktkapital betrachtete.
Zum anderen stützte sich Beuys auf die ebenfalls in den 60er Jahren mit großem Aplomb vor allem von Künstlern vorgetragene Behauptung, daß Kunstwerke ihre eigentliche Wirkung erst zu erreichen vermöchten, wenn sie für das ganz normale Alltagsleben der Menschen Bedeutung hätten. Kunst ist gleich Leben, hieß die Maxime; der künstlerische Schaffensprozeß und die Konfrontation der Werke mit dem Publikum sollten nicht von den anderen Lebensprozessen abgespalten und auf museale Institutionen, zum Beispiel auf die Museen als Kunsttempel, reduziert bleiben. Kunst als Ware und Kunst gleich Leben, diese Erörterungen wollte Beuys mit seinen Vorstellungen vom erweiterten Kunstbegriff sowohl zeitgemäß fortsetzen, als auch nach seinem persönlichen künstlerischen Credo neu definieren. (87)
Beuys behauptete zurecht – wie eine ganze Reihe von zeitgenössischen Künstlern, aber auch von Wissenschaftlern, vor allem Wirtschaftswissenschaftlern –, daß Kreativität nicht nur bei Künstlern als ihr eigentliches Kapital zu gelten habe, sondern inzwischen für alle Beteiligten am Wirtschaftsleben, an der politischen Kultur und den gesellschaftlichen Verkehrsformen, vor allem in der Sphäre des Privatrechts, gelte. Und was heißt eigentlich, kreativ zu sein? Es heißt, sich aus der Welt etwas zu machen, also die Gegebenheiten in der Welt zu thematisieren, also noch das scheinbar Selbstverständliche oder immer schon Geltende und scheinbar gar nicht anders Vorstellbare zum Thema zu machen und als neue Aufgabenstellung zu entdecken.
Die von Beuys ins Zentrum seines erweiterten Kunstbegriffs gestellte Behauptung, jeder Mensch sei ein Künstler, besagte selbstverständlich nicht, daß jeder Mensch ein Maler oder Skulpteur ist – es wäre ja aberwitzig, so etwas zu behaupten; jeder Mensch ist insofern ein Künstler, als er, wie das bisher nur den Künstlern zugestanden wurde, sich Themen und Problemen vorzugeben vermag, an denen es für ihn lohnt zu arbeiten.
Beuys’ Interesse an der direkten Demokratie und der ökologischen Bewegung war darin begründet, daß in diesen Bereichen bereits viele Menschen in eigener Initiative die scheinbar unvermeidlichen Entwicklungen zum Problem zu erheben verstanden, ohne bloß auf Expertenmeinungen oder die Behauptungen gewählter Funktionsträger zu reagieren.
Einwänden gegen seinen erweiterten Kunstbegriff begegnete Beuys zwar geschickt, aber nicht sehr stichhaltig. Hatte nicht auch Hitler sich in erster Linie als Künstler verstanden, der soziale, politische, wirtschaftliche und militärische Gestaltungsaufgaben in Fleisch und Blut lebender Menschen so realisierte, wie Künstler das in Gips, Ton, Stein, Bronze oder Farbe taten? Hatte nicht die Übertragung künstlerischer Schöpfungsgewalt in das Alltagsleben, wie Hitler und viele andere historische Täter sie betrieben, zu katastrophalen Resultaten geführt? Das mußte auch Beuys zugeben; er meinte, solchen Gefahren für die Zukunft aber begegnen zu können, wenn nicht nur einzelne Machtinhaber, sondern eben Jedermann sein künstlerisches Schöpfungspotential in das politische, wirtschaftliche und soziale Alltagsleben einbringe.
Aber die Frage blieb, auf welche Weise man denn seine Fähigkeit, wie ein Künstler Themen zu entwickeln und Probleme zu entdecken, ins Alltagsleben übertragen, wie also diese Fähigkeit angewendet werden kann. Denn das ist ja nicht unmittelbar möglich, sondern nur vermittelt über Kommunikation, in der erst die Wirksamkeit von Gedanken und Konzepten, von Arbeitsprozessen und Arbeitsresultaten erreicht wird. Wenn Kreativität als gesellschaftliches Kapital in der Thematisierung und Problematisierung liegt, dann sind Informationen, Konzepte und Meinungen die wichtigsten Vermittlungsgrößen in der Kommunikation zwischen Menschen. Zwar sind auch Informationen Waren, aber man kann die Informationen nicht wie herkömmliche Waren feilbieten, weil die Informationen nicht in gleicher Weise von ihrer Vermittlung zu trennen sind, wie man zum Beispiel einen Videorekorder als Ware von der Art und Weise unterscheiden kann, in der er von Kaufhäusern präsentiert wird. Informationen und ihre Vermittlung durch Medien sind eine fast unauflösliche Einheit, die man nur mit extremer kritischer Anstrengung auseinanderzulegen vermag.
Der Medientheoretiker McLuhan (88) behauptete in den 60er Jahren sogar, daß die Übermittlungsmedien die eigentliche Information darstellten; es komme gar nicht mehr darauf an, was einer sagt, sondern wie jemand, der etwas behauptet, seinen Zuhörern oder Lesern im Medium Fernsehen oder Illustrierte präsentiert werde. Diese Annahme, wäre sie zutreffend, führte zu unerträglichen Schlußfolgerungen über die Entwicklung demokratisch verfaßter Gesellschaften. Gott sei Dank hat sich längst erwiesen, daß die Annahme, das Medium sei die Botschaft, falsch ist. Nur die Medienmoguln halten die Medien noch für allgewaltig, weil sie das gern glauben wollen. Auf der Verbreitung dieses Glaubens an die Allgewalt der Medien ruht schließlich ihre Macht.
Was bisher als Macht der Medien galt, nämlich jede Information, jeden Gedanken und jede Meinung auf das Einheitsmaß gerade im Schwange befindlicher Präsentationsformen zurecht zu stutzen, hat sich längst als kontraproduktiv erwiesen, sowohl für die Interessen der Wirtschaftsbosse wie für die der Politiker; denn der mediale Einheitsquark lähmt die Kreativität als das eigentliche Kapital einer Gesellschaft.
Man kann Waren nur absetzen und Meinungen nur zur Diskussion stellen, wenn sich die Waren und Meinungen jeweils voneinander unterscheiden lassen. Absatz, Umsatz und Einfluß lassen sich nicht durch Gleichmacherei steigern, sondern nur durch Differenzierung. Differenzierungsleistungen über Entwicklung von Unterscheidungskriterien sind aber die eigentliche Domäne von Kunst und Kultur. Alle Urteile über den Wert und die Bedeutung von Dingen in der Welt basieren darauf, wie man die Dinge, seien es Pflanzen oder Tiere, Waren oder Kunstwerke, Lebensräume oder Lebensformen, voneinander unterscheiden kann. Die Medien können ihre Aufgaben, selbst wenn sie von privaten Profit- und Machtinteressen beherrscht wären, nur erfüllen, wenn sie die Unterscheidbarkeit von Waren und Meinungen, von Ideen und Haltungen, von Fakten und Fiktionen erhöhen, statt sie in einen allgemeinen Zuckerguß angeblicher Gleichwertigkeit einzutauchen.
Vom erweiterten Kunstbegriff über die medial gesteuerte Informationsgesellschaft zur Kulturgesellschaft, das bedeutet nicht, der erweiterte Kunstbegriff sei nunmehr zu den Akten gelegt und die massenmedial vermittelte Information sei unerheblich geworden. Es soll vielmehr gesagt werden, daß die hochentwickelten Industriegesellschaften als Kulturgesellschaften entwickelt werden müssen, deren Kapital die Fähigkeit zur Differenzierung ist und die ihre Bedeutung und Sinnhaftigkeit nicht aus höherer Offenbarung beziehen und nicht der Omnipotenz irgendwelcher weltlichen Mächte verdanken. Jeder Mensch ist nur darin produktiv, daß er eigene Differenzierungsleistungen erbringt, also selbständig den Dingen eine Bedeutung zu geben vermag (davon hängt inzwischen die Hälfte unseres Bruttosozialprodukts ab): Erst die Differenzierungsleistung des Modeentwerfers macht aus produzierten Stoffen eine volkswirtschaftlich bemerkenswerte Handelsware. Erst die auf Unterscheidung bedachte mediale Präsentation macht aus einer Ansammlung von Informationen ein verkaufbares Publikationsorgan. Über die bloße Information, über die nackte Materialität des Stoffes läßt sich die Kommunikation zwischen Menschen nicht mehr aufbauen. Das Beziehungsgeflecht zwischen Menschen ist aber die Basis jeder Gesellschaft. Es ist nur tragfähig, wenn es als sinnhaft und bedeutsam verstanden werden kann. Und es ist nur sinnhaft und bedeutsam, wenn die Beziehungen zwischen den Menschen über differenzierte, unterscheidbare Objekte und Informationen vermittelt werden, über Güter also, die von jedermann so beurteilt werden, wie man bisher nur Kunstwerke beurteilte.
• (82) Lawrence M. Miller: Barbarians to Bureaucrats. Corporate Life Cycle Strategies, New York 1989.
• (83) Michael Schuyt u. Joost Elffers: Phantastische Architektur/Ungewöhnliche Entwürfe und verwirklichte Träume, Köln 1980; G. Kyriazi: The Great American Amusement Parks, Secaucus N.Y. 1976.
• (84) Günther Förg: Katalog zur Einzelausstellung Kunsthalle Bern 1986, Westfälischer Kunstverein Münster 1986, Museum Haus Lange Krefeld 1987; J. Brand/H. Janseligs (Hg.): Architektur und Imagination, Zwolle 1980.
• (85) Gabriele Koller: Die Radikalisierung der Phantasie/Design aus Österreich, Salzburg 1987 u. Barbara Radice: Memphis, Mailand 1984.
• (86) Kent C. Bloomer u. Charles W. Moore: Architektur für den „einprägsamen Ort“, Stuttgart 1981; Messe Frankfurt GmbH (Hg.): Public design. Jahrbuch zur Gestaltung öffentlicher Räume, Ffm 1989.
• (87) Johannes Stüttgen: Zeitstau – Im Kraftfeld des erweiterten Kunstbegriffs von Joseph Beuys, Stuttgart 1988.
• (88) Marshall McLuhan: Das Medium ist Massage, Ffm/Berlin/Wien 1984.