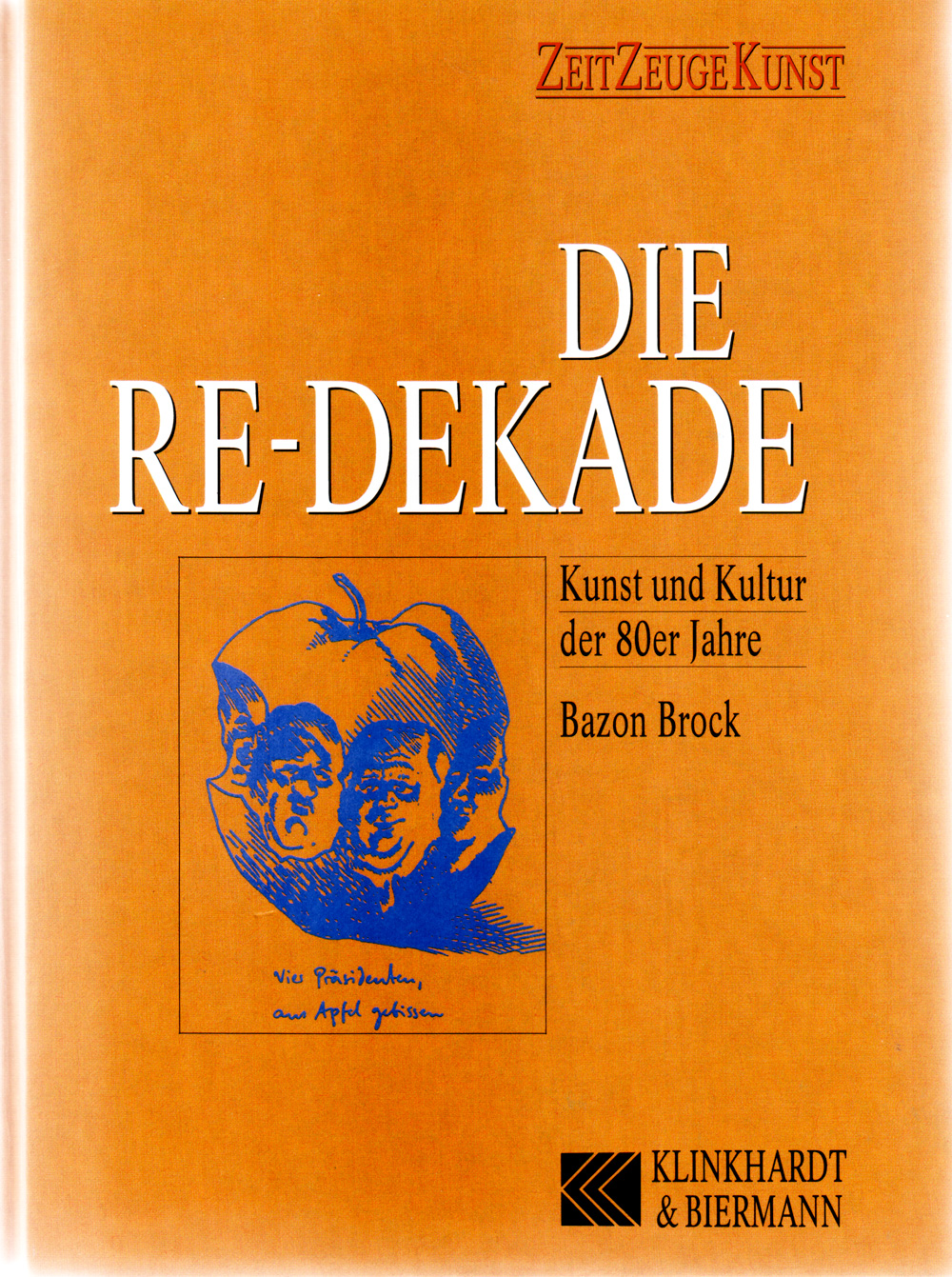Der Künstler Winfried Baumann löste 1988 – na was wohl? richtig – einen sogenannten Skandal aus, als er mit seinen Entwurfsarbeiten vorschlug, die Kathedralen als Müllhalden zu nutzen und wo sie nicht ausreichen, dem Müll neue Kathedralen in unseren Städten zu bauen, da der Müll für die Zukunft unserer Gesellschaft den gleichen Stellenwert habe, wie ihn die Repräsentation Gottes für die Zukunftssicherung früherer Gesellschaften besaß. Gegen die Vereinnahmung religiös besetzter Begriffe durch die Konsumgesellschaft hat es früher schon Proteste jeder Art gegeben, die allerdings bei der Einführung christlichen Personals in die französischen Werbekampagnen des Jahres 1989 wohl nur als Abwehr unlauteren Wettbewerbs in Erscheinung traten. Da hatte der deutsche Werberat doch noch andere Maßstäbe, die sich allerdings nicht durchsetzen ließen. Er erklärte am 24. August 1936 die Bezeichnung „Autofriedhof“ für geschmacklos und daher unerwünscht, eine Kennzeichnung, die damals erheblich diskriminierender wirkte als heute.
Autofriedhof
Ging es um eine Pietätlosigkeit? Wehrte man sich gegen die Herabwürdigung von Friedhöfen zu bloßen Müllhalden des verbrauchten Materials? Nun war man ja gerade in nationalsozialistischen Zeiten nicht zimperlich und von Humanitätsduselei, wie es damals hieß, befangen, wenn es darum ging, Menschen aus der Welt zu bringen. Die Aufrüstung war in vollem Gange und Hitler bekundete, daß der Gedanke zum Losschlagen ihn von Anfang an beherrscht habe. Wem es auf ein paar Millionen Tote mehr oder weniger nicht ankam, dürfte kaum großes Interesse an der pietätvollen Unterbringung von Toten in der Ewigkeit, also auf Friedhöfen, gehabt haben.
Andererseits mußte man in der offiziellen Verlautbarung den noch lebenden, aber schon für das Sterben einkalkulierten Menschen versichern, daß man den Toten womöglich größere Aufmerksamkeit zugesteht als den Lebenden, damit die Lebenden umso eher bereit sein würden, ihr Leben zu opfern. Der Friedhof sollte zur Heldengedenkstätte überhöht werden, und dieser Absicht widersprach die Gleichsetzung von Friedhof der Menschen mit Friedhof der toten Dinge.
Für die Deutschen insbesondere war ja aber das Auto nicht ein Ding unter vielen anderen Gebrauchsgegenständen. Das Auto hatte für viele durchaus eine Seele. Seit 1930 „Die Drei von der Tankstelle“ in der schmissigen Musik Werner Richard Heymanns sangen: „Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt“, meinten die zahllosen begeisterten Fans von Willy Fritsch, Heinz Rühmann und Oskar Karlweis nicht ohne Grund, der beste Freund, der hier besungen wurde, sei das Auto. Selbst in seinem materiellen Wert, der 1930 ja noch viel höher war als heutzutage, wurde das Auto weit überschätzt. Jeder glaubte den Dreien von der Tankstelle, daß man für den Verkaufserlös seines liebsten Gutes, nämlich seines Autos, eine komplette Tankstelle erstehen konnte. Aber die Tankstelle legte man sich ja nur zu, um wiederum – nunmehr von Berufs wegen – Gelegenheit zur Beschäftigung mit dem liebsten Freund Auto zu haben.
Wie man sich erinnert, ging diese Rechnung erwartungsgemäß auf. Die Generaldirektorstochter Lilian Harvey verhalf den Dreien nicht nur zu einem noch schöneren Auto, als sie es vorher verkauft hatten; Lilian brachte sich selbst als Inhalt des Autos, als dessen Seele, mit; sie machte verständlich, was ohnehin alle vermuteten: das Auto ist eine Frau.
Der Aufstieg der Automobilbranche, glaubt man ihren Werbekampagnen, ist nicht zuletzt dieser Beseelung des Automobils als edler, luxuriöser, rassiger, eleganter, sexuell stimulierender Skulptur der Frau schlechthin zu verdanken. Es ist hinreichend bekannt, daß die Gestalter von Automobilkarossen häufig ganz platt und umstandslos primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale von Männern und Frauen zum Vorbild nahmen, um den Käufern und Benutzern der Autos Mut zu dem Bekenntnis zu machen, daß das Auto, zumal in Schnellfahrt, Anlaß und Erfüllung des erotischen und sexuellen Zusammenspiels von Mann und Frau sei.
Das galt bis weit in unsere jüngste Vergangenheit für das lebende, also das möglichst makellos reine, auf jeden Fall aber noch gebrauchstüchtige Auto. Da nimmt es nicht Wunder, daß man einen so aufgeladenen, emotional besetzten Gegenstand nicht einfach wie andere Gegenstände am Ende seiner Lebenszeit pietätlos auf den Müll werfen konnte; das Auto schien ein Anrecht darauf zu haben, auch auf einem Friedhof beigesetzt zu werden. Vielen Autos war es beschieden, die kulturell höchste Stufe der Aufbewahrung bis zur Ewigkeit zu erreichen, nämlich die Unterbringung in Sammlungen und Museen.
Die immer noch laufenden Kampagnen zur 100-Jahr-Feier des Automobils finden mit solchen musealen Sammlungen alter Automobile großes Interesse beim Publikum. 1986 wurde in München die beachtliche Ausstellung „Das Automobil in der Kunst“ eröffnet. Es ist also verständlich, daß sich der Begriff Autofriedhof allgemein durchgesetzt hat – gegen alle Versuche, den Begriff Autofriedhof als geschmacklos, ja unsittlich, zu stigmatisieren.
Der Werberat der deutschen Wirtschaft, der mit seiner vollen Autorität zu verhindern versuchte, daß der Begriff Autofriedhof in der Öffentlichkeit verwendet werden durfte, ist gescheitert. Nach dem Kriege hieß und heißt diese Institution „Deutscher Werberat“. Er will in freiwilliger Selbstkontrolle der Werbewirtschaft möglicher Gerichtskontrolle zuvorkommen.
Horst Schneider kennzeichnet in einem Jahrbuch der deutschen Werbung (93) dessen Aufgaben folgendermaßen:
„Der Werberat verwirklicht Selbstkontrolle. Mit den Verantwortlichen für eine als unzulässig geäußerte Werbeäußerung führt er ein Gespräch, das überzeugen soll. Dazu bedarf es keiner Sanktionen, die auf das Haupt des Schuldigen mit Wucht herunterfallen, sondern allenfalls der Einsicht des Betroffenen. Sie ist fast immer gegeben. Fehlt die Einsicht, kommt also eine selbstdisziplinäre Eigenkontrolle nicht zustande, erst dann werden Sanktionen erforderlich.“
Das gilt für die Werbenden, also auch für die Werbung der Automobilbranche. Es ist nicht bekannt, wie häufig der deutsche Werberat Anzeigen dieser Branche beanstandet hat, weil in ihr gegen ethische Regeln, zum Beispiel die allzu deutliche Gleichsetzung von Auto und Frau, verstoßen worden ist. Was aber macht man gegen Verbraucher, über die der deutsche Werberat keine Sanktionen verhängen kann? Horst Schneider beklagt, „daß der Werberat für den Verbraucher bisher überhaupt noch kein Begriff ist“. Aber selbst wenn die Verbraucher kapierten, daß der deutsche Werberat auch in ihrem Interesse, oder gerade in ihrem Interesse, tätig ist, würden sie sich wohl kaum den gutgemeinten Mahnungen des deutschen Werberates unterwerfen. Das eben beweist die allgemeine Durchsetzung des Begriffs Autofriedhof, obwohl der Werberat der deutschen Wirtschaft alles daran setzte, diesen Begriff aus dem Verkehr zu ziehen. Gegen das Auto als Inbegriff der erträumten Aktionseinheit von erotischer Frau und heldischem Mann nützte bis vor kurzem kein Einspruch.
Wer Helmut Käutners großartigsten Nachkriegsfilm „Die Geschichte eines Autos“ gesehen hat und niemals wieder vergessen kann, wird den Gedanken an einen Kultplatz des toten Autos, heiße er nun Autofriedhof oder Automuseum, weniger abwegig finden als der Werberat der deutschen Wirtschaft. Die Filmepen, deren Helden und Heidinnen Autos waren, sind für die 50er und 60er Jahre kaum zu zählen. In einem von ihnen, der sich um den legendären Volkswagenkäfer rankt, wird das Auto sogar zu einem Geisterwesen engelhafter Himmelsbewohner. Nur der liebe Gott verzichtete noch darauf, einen achtzylindrischen Mercedeskompressor für seine Inspektionsfahrten zu benutzen; denn den hatten bereits Führer und Potentaten als angemessene zeitgenössische Erscheinung des Zeus’schen Himmelswagens für ihre Auftrittsspektakel vereinnahmt.
In seiner Dokumentation „Haben Sie Hitler gesehen?“ (94) gibt Walter Kempowski den Bericht eines Personalchefs, Jahrgang 1929, wieder:
„Wir guckten uns München an. Im Haus der deutschen Kunst, da ging so ein Raunen durch die Menge: der Führer! Der trank da draußen Kaffee. Wir sind dann auch rausgegangen, da stand er gerade auf, wurde eskortiert von schwarzer SS. Ich war enttäuscht, man dachte so an einen braungebrannten sportlichen Menschen, aber er hatte eine rosige Gesichtsfarbe, es blieb der Eindruck, daß man gar keine Führergestalt vor sich hatte, nicht braungebrannt. Er stieg dann in sein Auto, ein offener schwarzer Mercedes, wie wir ihn als Kinder zum Spielen hatten. Im Katalog stand drin: Führermercedes.“
Viele Zeugen berichten, welche Faszination für sie von diesem Führermercedes ausgegangen ist. Öfter tritt die Gestalt des Führers sogar hinter das glanz- und machtvolle Automobil zurück. Ob dieser Götterwagen wohl noch in einer Sammlung oder einem Museum steht? Undenkbar, daß man ihn und seinesgleichen umstandslos auf den Müll befördert hat.
Damit sind wir bei dem eigentlichen Geheimnis der allgemeinen Verbreitung des Begriffs Autofriedhof. Bis in unsere Tage wehren sich die Menschen verzweifelt gegen die Einsicht, was sie den Dingen antun und worin ihre eigentliche Lebensaktivität sich äußert: nämlich im Erzeugen von Müll, Dreck und Abfall. Was der Mensch einmal in der Hand hatte, wird zu Müll, wird verschlissen, zerstört, zersetzt und weggeworfen. Erst seit wir in unserem eigenen Müll genauso zu ersticken drohen wie in dem Überangebot neuer, sinnlos produzierter Massenware, kommt uns zu Bewußtsein, was die Industriegesellschaft bisher erfolgreich zu verdrängen wußte: zu den Problemen jeder industriellen Produktion gehört eben nicht nur die Herstellung, also das In-die-Welt-Bringen der Güter, sondern auch der Verbrauch, also das Aus-der-Welt-Bringen der Güter. Die Ächtung des Begriffs Autofriedhof durch den Werberat der deutschen Wirtschaft kann also auch als Versuch gewertet werden, diesen Zusammenhang von „In-die-Welt-Bringen“ und „Aus-der-Welt-Bringen“ zu vertuschen.
Die Industrie wollte nicht in ihrem Produktionsrausch dadurch eingeschränkt werden, daß sie sich mit eben so vielen Milliarden Investitionen darum zu kümmern hatte, was aus den von ihr in die Welt gesetzten Gütern nach deren Verbrauch werden sollte. Beim Gebrauchsgut Auto hatte man noch die Illusion hegen können, daß es, nachdem es seinen Geist aufgegeben hatte, ausgeschlachtet und in gewandelter Form wieder verwendet werden könnte. Das war bereits 1936, wie die Kampagne gegen den Begriff Autofriedhof zeigt, wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Wo es keine Schwierigkeiten macht, Neues in Massen zu produzieren und wo es zu den Wirtschaftspflichten der Konsumenten gehört, möglichst schnell immer neues Neues zu verbrauchen, besteht für die Ausschlachtung und Wiederverwendung des Alten kein Bedarf mehr. Obwohl sich der Begriff Autofriedhof unaufhaltsam durchsetzte, war allen längst klar, daß auch die Autos ihre Karriere auf dem Müllplatz beenden mußten.
Aber auch für den Müll nahte die rettende Ideologie: Um 1960 herum starteten eine Reihe von Künstlern Aktionen, die diesem Vermüllungsschicksal des beliebten, begeisternden, beseelten Idols Auto eine neue Dimension abzugewinnen suchten. Der englische Bildhauer Chamberlain produzierte aus zerlegten Automobilen, vor allem aus ihren farbigen Karosserien, beachtliche Plastiken, die in alle größeren Kunstausstellungen der Zeit einzogen. Der französische Bildhauer César ließ aus den unter Hochdruck komprimierten Autos Ikonen des Popzeitalters werden, Denkmale des kapitalistischen Realismus und der neuen Einsicht in die Gleichwertigkeit von Neuprodukt und Verbrauchsrelikt.
Der deutsche Künstler Wolf Vostell inszenierte vielbeachtete Happenings, in denen museale Dampflokomotiven prächtige Autos auf Schienen zerquetschten, um zu demonstrieren, daß das Auto eigentlich schon ins Museum des technischen Zeitalters gehört wie die Dampflokomotiven. (95) Mitte der 60er Jahre entwickelte der englische Kulturphilosoph M. Thompson seine inzwischen berühmt gewordene Mülltheorie der Kultur. (96) Thompson bewies schlüssig, daß viele neue Kulturwerte aus dem Müll kommen. Nach dieser Theorie müssen Gebrauchsgüter durch ihren Verschleiß gleichsam ihre ursprüngliche Wertigkeit verlieren; ihre Formen und Farben, ihre Gestalt- und Funktionszusammenhänge werden in der Müllphase neutralisiert, also vergessen. Dadurch können sie mit neuen Augen gesehen und in neuen Zusammenhängen benutzt werden. Thompson zeigt zum Beispiel, wie die neue Wertschätzung für den Jugendstil der Jahrhundertwende aus dem Sperrmüll kam. Die Leute warfen einfach weg, was sich für sie als Gestaltqualität oder Gebrauchszusammenhang allein schon durch Gewohnheit bis zur Unkenntlichkeit ausgelaugt hatte. Dann kamen die Sperrmüllsammler, entdeckten in diesen weggeworfenen Dingen ganz neue Qualitäten: sie entdeckten sozusagen die Schönheit des Abfalls und des Mülls, bauten um diese neue Schönheit des Häßlichen neue Sammlungen und Museen auf, wodurch der eben noch völlig wertlose Plunder, auch kommerziell gesehen, wieder zu Ehren kam.
In den bildenden Künsten war diese Technik der Abfallverwertung seit den Zeiten der Dadaisten und Kubisten als Methode des Collagierens allgemein üblich. Kurt Schwitters' Klebearbeiten mit Fahrkarten, Zeitungsausrissen, Trümmerholz sind inzwischen jedermann bekannt. Die collagierten Autoplastiken der Chamberlain, César, Vostell und vieler anderer genießen inzwischen zumindest als Zeitdokumente künstlerischen Rang. Ist das ein Rezept für die Industriegesellschaft, nach dem Muster des Friedhofs für Kunstwerke, genannt Museum, mit den Problemen der Abfallbeseitigung fertig zu werden? Es scheint so. Die Vermüllung der Welt ist weit fortgeschritten, und so bleibt uns zumindest als Einzelnen nur noch ein Ausweg aus dem Dreck: ihn schön zu finden. Wir regen deshalb an, neue touristische Programme aufzulegen, etwa nach dem Motto: „Führer durch die schönsten Müllhalden der Bundesrepublik“.
Den Feierern der 100-jährigen Automobilgeschichte geben wir den Tip, sich ihren größten Erfolg nicht entgehen zu lassen, der sicherlich darin bestehen würde, die Automobilfans von Kunsthistorikern und Industriearchäologen über die größten Autofriedhöfe dieses unseres schönen Landes da draußen zu führen. Noch ist es makabre literarische Vision, daß auf diesen Friedhöfen angesichts der präzise arbeitenden Hochdruckpressen für die Verwandlung von Autokarossen in minimalistische Kunstkuben mancher Besucher den Wunsch äußern könnte, sich mit seinem Auto beerdigen zu lassen. So ein zusammengepreßter Block eines ehemaligen Automobils ist übrigens weniger als halb so groß wie ein menschlicher Sarg. Nicht nur die Autofriedhöfe haben inzwischen Platzmangel, und wessen Ziel wäre es nicht, in die Ewigkeit als Kunstwerk einzugehen und sei es als Autoskulptur. (97)
Das griechisch-lateinische Automobil ist ja das sich selbst bewegende Ding. Ein Selbst hat schließlich jeder, auch wenn er nicht Künstler ist. Das Volk hat instinktsicher gewußt, warum es sich den Begriff Autofriedhof vom Werberat der deutschen Wirtschaft seit 1936 nicht hat nehmen lassen: Auto-Mobil-Friedhof wörtlich: sich selbst zum Grab hin bewegen.
Kathedralen für die neue Wirklichkeit
Es gibt zwei prinzipielle Haltungen von Künstlern gegenüber ihrer Zeit. Sie können ihre kulturelle Produktion als Gegenbild zum Zustand und den Erscheinungsformen der Gesellschaft konzipieren, in der sie leben, oder aber mit ihrer eigenen kulturellen Produktion in diesen Zustand eingreifen, damit es den Zeitgenossen möglichst schwerfällt, diesen Zustand zu verdrängen.
Winfried Baumann gehört zum letzteren Typ, wobei die Radikalität seiner Haltung und hoffentlich auch die Wirkung seiner Arbeit von der Formkraft getragen werden, über die er als professioneller Künstler, Bildhauer und Architekt in so großem Maße verfügt.
Als Zeitgenossen ist Baumann klar, daß die entscheidenden Probleme der Konsumgesellschaft durch unsere Unfähigkeit entstehen, mit dem Abfall und den zerstörerischen Konsequenzen von Produktion und Konsum fertig zu werden.
Gerade das aber, womit wir nicht fertig werden und was sich unseren Wünschen nicht fügt, definiert unsere Wirklichkeit. Womit wir nicht fertig werden, das macht uns Angst, und was uns Angst macht und als übermächtige Wirklichkeit unser Schicksal jenseits aller individuellen Anstrengungen bestimmt, das müssen wir rituell zu bannen versuchen.
Solche Ritualformen entwickelte die Kultur auf unterschiedlichen Ebenen; am bedeutsamsten war diejenige, die als Sakralarchitektur den Gott, die Götter, die Geister und die Ideen ins Gehäuse, in den begrenzten Bezirk zu zwingen versuchte. Der Dämon unserer Zeit scheint sich nirgends so übermächtig und so wirklichkeitsbestimmend zu zeigen wie in der Verwandlung der Welt in eine lebensfeindliche, unkontrollierbare, mondtote Giftmülldeponie.
Diesem Dämon, also unser aller Besessenheit, baut Baumann Kathedralen, damit der Geist, der uns vermüllt, sich vielleicht doch noch zwingen läßt, einen Teil seiner Macht an uns abzutreten, und wir im Gegenzug uns bereitfinden, den Müll und das Gift als unsere Schicksalsmacht anzuerkennen und ihnen die höchste Aufmerksamkeit zu widmen.
Anbetung war schon immer höchste Form der Selbstvergewisserung des Menschen über sein Schicksal. In dieser Hinsicht unterschieden sich für den Künstler Gott und Müll nicht.
Das Überzeugende an Baumanns formalen Konzeptionen (98) (seien es die Vorschläge für die Gestaltung der Abfallbeseitigungsanlage Atzenhof oder die für die architektonische Neuformulierung des Regierungsviertels in Bonn, seien es die für die Gestaltung eines Altars in einer ruinösen (!) gotischen Kathedrale oder die von Restauranttischen für schwermetallvergiftete Fresser) liegt in der Synthese von technischer Funktionstüchtigkeit und psychodynamischer Symbolbildung. Dabei hat Baumann zum Beispiel für den Entwurf der Abfallkathedrale nicht nur tradierte Formensprachen ägyptischer Pyramiden und Flugzeughangars addiert. Der Anklang an diese Formen ist gewollt und wünschenswert (monumentale Sakralbauten waren immer auch von neuen technischen Meisterleistungen abhängig); meines Wissens aber hat bisher kein anderer Künstler zu solchen Architekturkonzepten wie Baumann gefunden. Zweifellos sind diese Konzepte aus seiner Arbeit als Bildhauer entstanden, sie sind aber keineswegs nur monumentalisierte Skulpturen. Von ihrer Symbol- und Formkraft sind sie eigenständig projektierte Visionen, die meiner Ansicht nach zum ersten Mal die Heiligkeit des unser Menschenschicksal bestimmenden Mülls, des Gifts und der Strahlung erfahrbar werden lassen.
Mit Hinweis auf Baumanns Konzepte für die Kathedralen des Abfalls können wir uns endlich auf unsere entscheidende Kulturproduktion, nämlich die von Tod und Verderben in unseren Städten einlassen; wir brauchen den tödlichen und deswegen anbetungswürdigen Dreck nicht mehr in lebensfernen Gegenden unter die Erde zu verbannen oder durch allgegenwärtige Verteilung zu minimieren, das heißt versuchen, ihn unsichtbar werden zu lassen. Je schneller wir uns aber zu der tödlichen, schicksalbestimmenden Wendung unserer eigenen Werke gegen uns selbst bekennen, indem wir den selbsterzeugten Tod in Kathedralen bannen, desto begründeter wird die Hoffnung, daß sich die strafenden Götter noch einmal besänftigen lassen.
• (93) Horst Schneider, in: Jahrbuch der deutschen Werbung, Düsseldorf 1974.
• (94) Walter Kempowski: Haben Sie Hitler gesehen?, München 1973, S. 55.
• (95) Wolf Vostell: Das plastische Werk 1953–1987, Mailand 1987.
• (96) Michael Thompson: Die Theorie des Abfalls/Über die Schaffung und Vernichtung von Werten, Stuttgart 1981.
• (97) Reimar Zeller (Hg.): Das Automobil in der Kunst, München 1986.
• (98) Winfried Baumann: Arbeiten 1986–1989, Münsterschwarzach 1990.