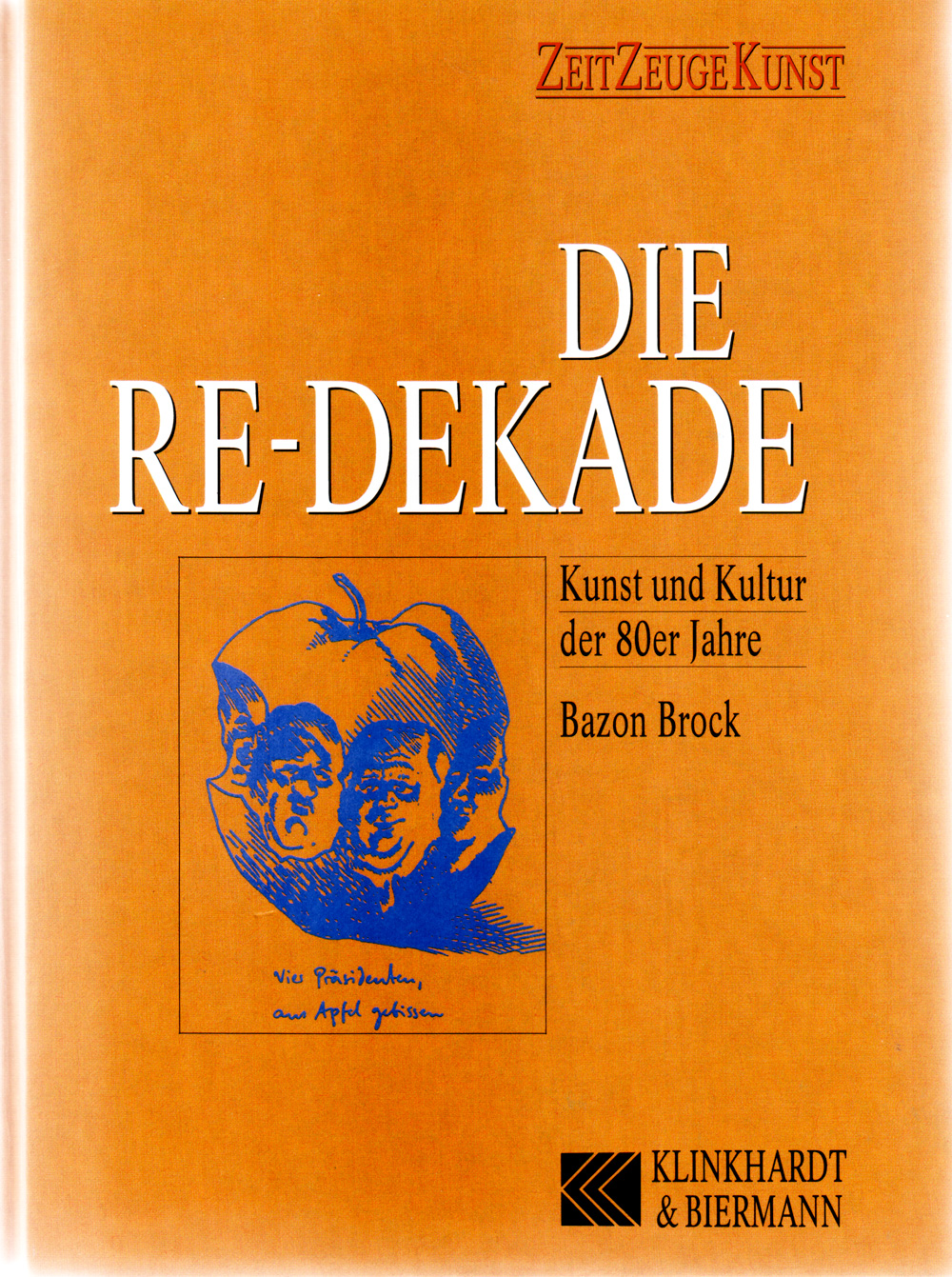Joseph Beuys fühlte sich nirgends so wohl wie da, wo er so etwas wie Volksbildung, Volkserziehung spürte. Seine Mitstreiter und Gastgeber haben ihn immer wieder gefragt, warum er zu jeder noch so kleinen Veranstaltung hindüse. Mir antwortete er einmal: „Ja, hör mal, wenn Du das nicht verstanden hast, daß es eine Gnade ist, daß einem jemand zuhört, dann hast Du auch gar nichts zu sagen!“ Das war es, was ihn veranlaßte, ständig auf solchen nervenaufreibenden und seine körperlichen Kräfte bei weitem übersteigenden Veranstaltungen zu erscheinen. Darunter waren auch solche, von denen er gar nicht wußte, in welchem Zusammenhang er dort etwas hätte ausrichten können.
Aber er hat es tatsächlich als eine Art Gnade empfunden, wenn ihm jemand zuhörte. Denn das ist nicht selbstverständlich, obwohl die im Kulturbetrieb hochgradig Integrierten den Eindruck vermitteln, nach ihnen bestehe überall Nachfrage. Was Beuys an genial Hochfahrendem, dann aber auch wieder kabbalistisch Heiterem, pathetisch Menschheitsbeglückendem verkündete, ist im Kern als Reaktion auf die unerwartete Tatsache zurückzuführen, daß ihm jemand zuhören wollte.
Beuys hat ja seine Gedanken nicht im stillen Kämmerchen, nicht am Schreibtisch entwickelt, sondern stets unmittelbar aus der Herausforderung, eine Situation mit Menschen bestehen zu müssen, die von ihm erwarteten, daß er etwas zu sagen habe. Und zwar nicht irgendetwas, sondern etwas, demgegenüber es sich lohne, zuzuhören und sich damit zu beschäftigen. Das war alles andere als normal für ihn und ist es wahrscheinlich für keinen, selbst wenn er in ähnlichen Situationen mehr als einmal pro Jahr steckt.
Aber das Publikum schien im wesentlichen auf die Haltung eines Künstlers wie Beuys gar nicht vorbereitet zu sein. Es kam ihm eigentlich mit viel größeren Erwartungen entgegen, keineswegs mit der Haltung: wir bilden jetzt gemeinsam eine soziale Situation von einer gewissen Dichte, aus der wir etwas machen müssen. Erwartet wurde, daß Beuys aus sich heraus, aus seinem künstlerischen Ingenium heraus, aus Inspiriertheit und Engagement etwas zu sagen habe, mit dem man – unter der Vergewisserung, daß ein großer Künstler gesprochen habe – getrost sein konnte.
Die Kruditäten und die im wohIverstandenen Sinne merkwürdigen Unsinnigkeiten seiner häufigen Ausführungen sind auch daraus zu erklären, daß er die Situation, in der er zu Leuten sprach, experimentell nutzte zur Entwicklung von Vorstellungen, die er nicht als die seinen allein wissen wollte, sondern die vielmehr aus den Anforderungen des Publikums hervorgingen. Das war nicht einfach, da das Publikum ihn förmlich auf Haltungen festlegen wollte, wie sie im 19. Jahrhundert, im bürgerlichen Milieu, dem künstlerischen Genie entgegengebracht wurden – und das war für Beuys von äußerster Peinlichkeit.
Beuys hatte die Vorstellung, nur einer unter vielen anderen zu sein, die ihre Probleme ernst nehmen.
Beuys kannte keine Strategie zur Absetzung seiner besonderen künstlerischen Individualität und Persönlichkeit, wie man das ihm immer wieder vorgeworfen hat. Er hat in erster Linie auf andere hin seine Arbeit geleistet. Und es ist sicher unstatthaft, dem nun wiederum eine negative Wirkung beizugeben, etwa nach dem Muster eines Selbstopfer-Syndroms, das man von Sozialarbeitern und Missionaren kennt. Es ging ihm vorbehaltlos um die Frage: Warum sind zwei Menschen immer mehr als das, was einer allein in Gedanken und Taten repräsentieren kann.
Die Gespräche mit Beuys bestanden nicht darin, etwa Großes und ein Weniges (seine künstlerischen Aussagen und die der Anwesenden) zu addieren, sondern er war überzeugt, daß erst in der Hinwendung auf einen anderen, auf das, was der hätte sagen können oder glaubte sagen zu können, irgend etwas Sinnvolles vom Künstler zu leisten ist. Ohne Bezug auf einen anderen Menschen ist das, was wir von der Welt wissen, geradezu nichtig. Wenn wir die Wahrheit genau wüßten, wäre sie doch bedeutungslos, solange sie nicht im Hinblick auf wenigstens einen Menschen, nach Möglichkeit auf viele Menschen, gesagt wird, so zitierte er Goethe.
Der entscheidende Entschluß, den er mehr oder weniger bewußt getroffen hat, lag darin, seine Aussagen nicht mehr auf irgendein, wie immer zustandegekommenes Kunstwerk zu gründen, sondern auf seine Fähigkeit, im Medium dieses Werkes andere als die herkömmlichen Beziehungen eines Künstlers zu seinen Zusehern und Zuhörern aufzubauen. Er sah in seinen Aktionen nicht nur eine zeitgemäße Erweiterung des überlieferten Werkschaffens, sondern etwas prinzipiell anderes. Er ist sogar so weit gegangen, kategorisch zu verbieten – verbindlich über seinen Tod hinaus durch Verträge mit Museen und Sammlern festgelegt –, daß der Werkcharakter seiner Aktionen als verselbständigtes künstlerisches Objekt ausgestellt werde. Zentrales Anliegen war für ihn herauszufinden, ob es in der Arbeit des Künstlers eine Möglichkeit gibt, andere und neue Beziehungen zu Menschen aufzunehmen, aufzubauen und zu intensivieren.
Wenn man sich das in aller Bereitschaft zur kritischen Distanz genau überlegt, hat es viel für sich. Denn was ihn, auch im herkömmlichen Sinne, als werkschaffenden Künstler und Plastiker auszeichnete, war, sich nicht auf die besondere Überzeugungskraft der Werke zu verlassen. Die Wahrnehmungen seiner Werke lenkte er immer wieder auf den Betrachter zurück. Das eigentlich Entscheidende bei seinem Werk ist, daß es uns eine neue, ganz spezifische Art des Verstehens unserer selbst als Betrachter ermöglicht. Beuys hat in diesem Sinne unsere Reflexion verändert; das ist seine entscheidende Leistung. Aber er setzte nicht nur Wirkung gegen Werk, sondern auch Werk gegen Wirkung.
Wirkung hieß für ihn nicht, Wirkung von jemandem als Künstler mit einem entsprechenden Werk, also nicht Wirkungsanspruch eines Werkes als in der Zeit bedeutsam und allen anderen überlegen, sondern Wirkung meinte die Wirkung von Ideen, Wirkung der Vorstellungswelt, für die das Werk in erster Linie Medium war.
Natürlich hat er insgeheim gewußt, daß sein Werk im Museum enden und auch eine Würdigung in überlieferter Hinsicht erfahren würde, und dieses Wissen im Hintergrund mag ihm auch Sicherheit gegeben haben, seine Zeit – wie andere meinten – mit solchen Kinkerlitzchen wie Diskussionen zu vergeuden. Es ging um Wirkung im Sinne eines Wirksamwerdens von Ideen, von Vorstellungen, von Themen, die sich nicht von allein ergeben. Sie ins Gespräch zu bringen, bedeutet schon eine ungeheure Leistung. Das Zentrale dieser Ideen war keineswegs vorgegeben, so sehr er auch auf Theorien von Ökonomen, Philosophen und Anthroposophen zurückgriff. Die zentralen Themen sind von ihm selbständig entwickelt worden.
Wirkung erzielen hieß, etwas für Menschen, in ihren Beziehungen, in ihren Gesprächen, in ihren Verhaltensweisen zum Thema zu machen, was in etwa der Thematisierung entspricht, die ein Künstler – wenn er auf sein Werk rekurriert – auch entwickelt, aber nur im Hinblick auf sein Werk, und die Wirkungsgeschichte der Werke ist dann doch eine ganz andere als die der über die einzelnen Werke hinausgehenden Themen und Probleme.
Wenn gefragt wird, wie Beuys diese Aspekte sinnvoll vermittelte, dann zeigt das am besten sein Beitrag zur „documenta“ 1982. In der Anhäufung der Basaltsteine der Aktion „7000 Eichen“ vor dem Hauptgebäude der „documenta“ wurde der Wirkungsanspruch direkt ablesbar, denn in dem Maße, in dem Menschen den Wirkungsanspruch aufnahmen, verschwand das Werk selbst: jeder sollte ein, zwei oder viele Bäume für die Stadtbewaldung gegen die Stadtverwaltung stiften. Und zu jedem gestifteten, neu gepflanzten Baum wurde dann einer dieser Basaltsteine vom Friedrichsplatz weggenommen. Sobald man dem Appell dieses Werkes entsprach, wurde es selbst aufgehoben, bis zum vollständigen Verschwinden des Werkes als einer Skulptur von Beuys auf dem Friedrichsplatz.
Es gibt eine ganze Reihe solch bedeutsamer Werke von ihm. Diesen Werkcharakter entwickelte er in völliger Eigenständigkeit und mit ungeheurer Konsequenz. Diese Entwicklungen kamen nicht aus dem hohlen Bauch; sie waren nicht bloßer Intuition zu verdanken, sondern wurden von ihm in jenen „Diskussionen“ konzipiert; sie gaben dem Gestalt, was er seinen Partnern und sich als Problem zumuten wollte, damit man endlich aufhören konnte, das künstlerische Arbeiten auf das Schaffen von Kunstwerken zu beschränken. Die Arbeiten wirkten hinterher so, als hätten sie sich nur in der Konsequenz dessen ergeben, was er ohnehin schon im Atelier entworfen hatte. Ihr Entstehungsprozeß verlief aber genau andersherum; nicht das Werk war ursächlich, sondern die Wirkung. Ihm ging es um die Frage, wie eine Arbeit angegangen werden könnte, um über sie die Beziehungen zwischen Menschen zu verändern. Andererseits beharrte er auf dem Werk gegen dessen Wirkung, weil die Beeinflussung von Menschen sonst schnell willkürlich werden könne oder missionarisch dogmatisch. Nur die Eigenständigkeit des Werkes, bis hin zu seiner uneinholbaren Fremdheit, bot den hinreichenden Widerstand gegen den Zugriff des vermeintlichen Verstehens, durch das man glaubte, mit einem Problem fertig werden zu können. Mit einem leistungsfähigen Werk kann man nicht fertig werden, ebensowenig wie mit einem Menschen. Das eben sollte man sich gesagt sein lassen; dabei bleckte er die Zähne lachend. Am herzlichsten lachte er über das, was er da eben, auch für ihn selbst überraschend, gesagt hatte.