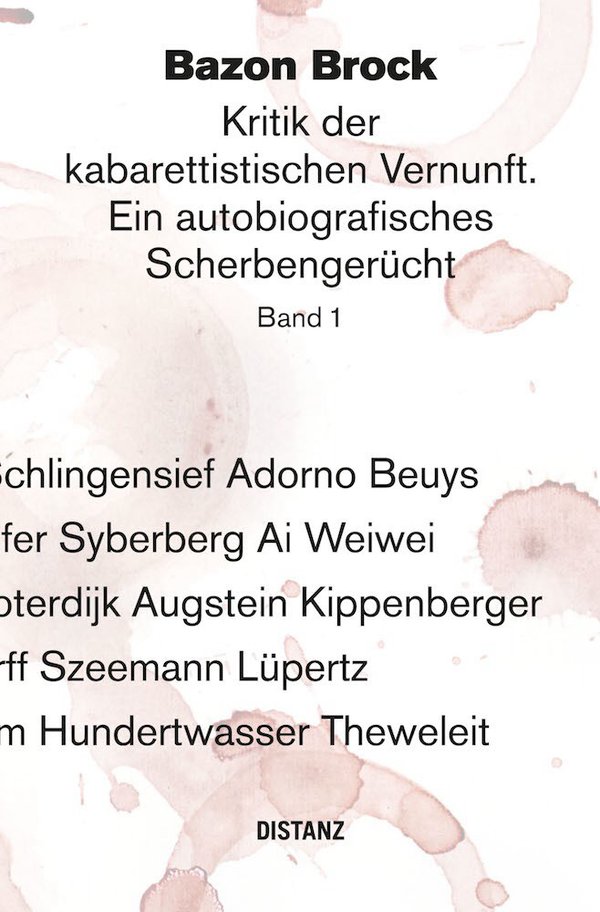I. Anfang für alle, die den Beipackzettel ohnehin nicht beachten, weil sie dem Irrsinn demonstrierter Verantwortungslosigkeit in der Verpackung wissenschaftlicher Argumente nicht gewachsen sind; denn in jedem Beipackzettel wird erstrangig darauf hingewiesen, dass man das Medikament nicht nehmen dürfe, wenn man gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch reagiere – was man allerdings erst durch Einnahme des Medikaments feststellen könnte. Alle, die solchem systemkonformen Irrsinn sich gewachsen fühlen, lesen unter II. weiter.
„Ein Autor, der etwas taugt, infiziert sich mit den Stoffen an denen er arbeitet“, äußerte Peter Sloterdijk Carlos Oliveira gegenüber – veröffentlicht 1996 unter dem programmatischen Titel Selbstversuch. Solche Selbstversuche mit der Absicht der Immunisierung gehen im christlichen Europa auf das Beispiel der „Versuchung des Hl. Antonius“ zurück.
Gegenwärtig reicht das Spektrum der Versuchungen von ekstatischer Gewalt bei Fans und Hooligans inklusive religiöser Fanatiker über die „großen Verführer zum kleinen Hunger“ bis zu den Experimentatoren der Bewusstseinserweiterung und der Selbstversuchung von Extremsportlern. Sie alle erwarten Immunisierung gegen selbstzerstörerische Ängste, gegen die Folgen sozialer Auslöschung und gegen den Verlust von Handlungsfähigkeit.
Aber wie man weiß, können besonders starke Immunisierungen zu Autoimmunerkrankungen führen, bei denen das Schutz-/ Abwehrsystem sich gegen den eignen Träger wendet. Im Bereich des Geistes nennt man solche Autoimmunerkrankungen Fundamentalismus, Dogmatismus oder sektiererischen Fanatismus.
Bazon Brock würdigte mit einem Festvortrag zur Verleihung des Cicero-Rednerpreises an Peter Sloterdijk dessen Selbstversuch als Selbstversuchung und spricht die Arzeneyen an, die Sloterdijk gegen derartige Verführungen zum Systemkonformen Irresein ausprobiert hat. Sie reichen vom Zustimmungsversuch als Pilger in Poona (si si si Poona = sacrificium intellectus) über den Zynismus, die Paradoxie und Parodie (seine Kritik der zynischen Vernunft) bis zum Eurotaoismus (Training des Paarlaufs von chinesischer Antike und europäischer Moderne). Und wo bleibt der Trost, wenn man die Schilderung der Sphären-Trilogie nicht schon als Kommentar über die Fernsehberichte zum Weltuntergang sehen will? Diese Archäologie der Zukunft erregt tröstlich das freudige Erstaunen, was alles den Weltuntergang überlebt (so wie wir immer wieder staunten, wie viele Zeugnisse des Gewesenen nach den Kriegen aus den Trümmern gezogen wurden). Mit der Sicherung und Interpretation dieser Relikte übernahmen Wissenschaftler längst die Funktion der Reliquiensammler heilsgeschichtlichen Angedenkens (siehe Petrarcameister in seiner Darstellung des De rebus Memorandis. Gedenckbuch aller der Handlungen, die sich fürtrefflich vonn anbegind der Welt wunderbarlich begeben und zugetragen haben / wirdig und werdt dass sie inn ewig zeyt nymermer inn vergeß gestellt). Die Vermittlung zwischen Heilsgeschichte und Weltgeschichte stifteten die Humanisten, insbesondere Petrarca mit seiner Trostschrift „Von der artzney bayder Glück/des guten und widerwertigen“. Wie die großen Beispielgeber für das Europa identifizierende Prinzip „Autorität durch Autorschaft“ zielt auch Sloterdijk auf die Einheit von Werkschaffen, Wirken und Wahrheitsbezeugen ab. Der wahre Trost liegt also in der Verpflichtung, jede Diagnose durch eine Prognose zu verantworten – und was wäre Wahrheit anderes als Konsequenz der Verpflichtung auf Verantwortung? Das ist Sloterdijksche Arzeney.
II. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Philosophen als Paradoxienberater:
Zunächst einen kurzen Hinweis auf ein Motiv, das für Preisverleihungen als Würdeformel immer wieder angesprochen wird, nämlich die Konfrontation von Persönlichkeiten hoher Beispielhaftigkeit mit der Langeweile erzeugenden Ödnis der Lobreden. Würde, hat das Sloterdijk nicht auch gesagt, demonstriert sich heute wohl nur noch in der Art und Weise, wie jemand Reden über sich selbst erträgt, die vermeintlich der außerordentlichen Leistung des Ausgezeichneten gelten sollen, aber durch die mindere Leistungskraft des Laudators eben deshalb nicht erreicht werden können. Dieser Aporie von Preisung des Außergewöhnlichen durch Mittelgrößen entgeht man, wenn man einer Empfehlung von Günter Anders, die er selber strikt befolgte, Vorrang vor allen anderen Argumenten einräumt: „Lass dich nur von denen ehren, die du selbst ehrst.“ Da bin ich voll gerechtfertigt vor dem zu preisenden Peter Sloterdijk, denn er hat vor zwei Jahren zur Eröffnung des Münchner „Lustmarschs durchs Theoriegelände – Ästhetik einer schweren Entdeutschung“ im Haus der Kunst meinem irdischen Mühewalten seine Stimme gegeben.
Besonders sprechende Beispiele für derartige Reziprozität von Ehren und Geehrtwerden bieten Großunternehmer, die sich, wie Wolfgang Ullrich zeigt, besonders gern mit dem Rücken vor anspruchsvollsten, das heißt bekanntermaßen unverständlichen Kunstwerken porträtieren lassen (Unternehmersammler Christian Boros: „Ich sammele nur Werke, die ich nicht verstehe, wie ich das bei Bazon gelernt habe.“).
Die Herren legen Wert darauf, dass man nicht bloß ihren Instinkt für Marktchancen von Produkten herausstellt, sondern den letzten Grund ihrer unternehmerischen Persönlichkeit wahrnimmt, nämlich ihre Stressresistenz gegenüber den Zumutungen des Ergotismus, der Beweis- und Rechtfertigungspflicht, und Unerschütterlichkeit angesichts der Versuchung zum Mitleid mit vernichteten Konkurrenten. Die von Ullrich analysierten Porträts signalisieren, dass sich die hohen Herren selbst vor dem Umgang mit jenen Elaboraten von Künstlern nicht fürchten, die pausenlos erklären, nur mit dem Undenkbaren, Unvorstellbaren und dem Undarstellbaren zu operieren, mit dem Unfug als inkommensurabler Fügung und dem Unsinn als hermetischer Form des Sinns.
Weitere Aporien des öffentlichen Auftretens von Herausragenden, Preisungswürdigen und Genialen hat Markus Lüpertz ganz wunderbar demonstriert. Da sitzt er in der ersten Reihe in der Paris-Bar, guckt auf die Passanten und beschwert sich darüber, dass sie alle keine Ahnung hätten, warum er der großartige Maler Lüpertz sei. Im Hinblick auf dieses Manko beschimpft er die passers-by natürlich als Ignoranten und bemerkt dann plötzlich die Paradoxie, in die er geraten ist, nämlich von denjenigen Anerkennung zu verlangen, die er ja als minderbemittelt einschätzt. Das ist das Grundmuster des öffentlichen Auftretens. Da benötigt man schon Stressresistenz, um das zu ertragen.
Thomas Bernhard fügte seine diesbezüglichen Erfahrungsberichte über dutzende Verleihungen von Preisen an ihn selbst zu einer eigenen literarischen Gattung – der Kakologie, zu welcher Gattung zum Beispiel Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“ gehört und Bazons „Polemosophie“.
Ähnlich verhält es sich hier beim Cicero-Preisgeschehen im Plenum des Bonner Bundestags mit der wesentlichen Gruppierung, der einladenden Sozietät deutscher Redenschreiber, die fordern, dass man eine Rede schreiben soll, um sie halten zu können.
Ich kann indessen die Festrede nicht ablesen, wenn ich sie halten soll, denn das wäre ja eine Vorlesung. Und es ist überflüssig sie hier nunc stans zu halten, wenn ihre schriftliche Formulierung an jedem beliebigen Ort zur Kenntnis genommen werden könnte.
Daraus folgt eine weitere Paradoxie nach der schon angesprochenen Lüpertzschen, von denen Anerkennung einzufordern, die man für Ignoranten hält: Einerseits Reden vorlesen zu sollen; die Vorlesung aber für einen Beweis der Unfähigkeit zu nehmen, tatsächlich sich in freier Rede angemessen äußern zu können; andererseits aber den befähigten Redner für einen bloßen Rhetoriker zu halten, weil er ja solchen Wert auf das Reden und nicht auf die authentische Wiedergabe eines nach vielen Korrekturen freigegebenen Textes legt.
Nichts kennzeichnet den Philosophen mehr als die allgemeine Erwartung, dass er weiß, auf welche Weise man Denkkrämpfen entgeht und aus den Begriffsfallen der Aporie und der Paradoxie herausfindet: durch Parodieren, durch Ironisieren, durch übertreibendes Affirmieren und durch Karikieren – ein Hundsfott, ein Zyniker ist, wer dabei Verdächtigungen streut oder gar die Empfehlung zum Harakiren erteilt.
Wie wird man stressresistent, also ruhmfähig? Sloterdijk zitiert Jean Paul, vor allem die berühmte Episode im Titan, in der der Held dieses Großwerks die Lobreden „auf jeden großen Mann mit einer Wollust las, als wären sie auf ihn verfasst.“ Das ist natürlich ein bürgerliches Verfahren, das vornehmlich über Dramen, Biografien und Historienmalerei vermittelt wurde. Man ging ins Theater, um sich zwar die Geschichte von Macbeth, dem Räuber Karl oder Gretchen erzählen zu lassen, war aber darauf getrimmt, „am liebsten gleich mitspielen zu wollen“, wie es Heinrich Mann vom untertänigen Besucher einer „Lohengrin“-Aufführung berichtet. Tua res agitur – pass auf, es wird von dir die Rede sein, bereite dich darauf vor, dass du dich auf der Bühne des bürgerlichen Lebens zu bewähren hast. Wer sich da bewährt, wird rühmenswert.
Sloterdijk schrieb: „Von der Antike an sind geschichtete Gesellschaften ruhmverteilende Systeme, die ihre öffentlichen Chöre mit den intimen Liederwartungen der Einzelnen, der Individuen synchronisieren.“ Was wir heute also praktizieren, ist das Synchronisieren unserer unterschiedlichen Erwartungen an das Schicksal, an das Glück in beiderlei Gestalt und an unser Ingenium, dem wir ja seit altrömischer Zeit mit Geburtstagsfeiern huldigen. Synchronisiert bilden wir den öffentlichen Chor, als dessen Mitglieder wir gefeit sind gegen die Verlockungen des Sirenengesangs, der Schicksalsmelodien, dem Liebestaumel und ganz im Allgemeinen gegen die Attraktionen eines süßen, aber sinnlosen Lebens. Die Ruhmeshallen sind Vortrags-, Theater- und Konzertsäle, in denen die Liederwartung des Publikums die Akteure zur Selbstübergipfelung ihrer kleinen Menschlichkeit vorantreibt in kollektiven Selbsterregungszuständen. Auch ich kann ihnen bestenfalls eine rhetorische Oper bieten zur Erweckung von Gefühlen, die durch die Erwartung von Einmaligkeit und die gleichzeitige Gewissheit, dass auch hier nur ein Erwartungsschema erfüllt wird, das sich gar nicht verändern darf, um für uns Bedeutung zu haben.
III. Indikation
Also Festvortrag! Was ist ein Fest? Ein Fest vermittelt zwischen den verschiedensten Aspekten unserer Wahrnehmung des Lebens als einmalig und herausragend und der Sehnsucht nach Wiederholung, nach einer Erfahrung von uneingeschränkter Wiederholbarkeit. Feste sind die Vermittlung zwischen diesen beiden Aspekten von Einmaligkeit und der Daueransprüche an Ewigkeit durch das Wiederholen.
Einmalig ist heute natürlich, dass der Cicero-Rednerpreis zum ersten und einmaligen Großereignis wird, wenn ihn Peter Sloterdijk bekommt. Andererseits ist die Vermittlung der Zyklizität darin zu sehen, dass er so gut wie alle Preise schon erhalten zu haben scheint, obwohl er faktisch noch keine Höchstauszeichnungen erhielt. Sloterdijks Status in der Öffentlichkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass jedermann glaubt, er habe selbstverständlicher Weise schon alle Preise erhalten, von denen man jährlich hört und liest, sie seien an die bedeutendsten SchreiberInnen vergeben worden – also naturgemäß auch an Sloterdijk.
Ich habe mir angewöhnt, bei Laudatio-Veranstaltungen – aber ich soll ja heute keine Preisrede halten, sondern eine Festrede – diejenigen zu preisen, die den Preis nicht bekommen haben. Denn die Nichtgepriesenen sind ja die Bedingung der Möglichkeit, dass einer unter ihnen ausgezeichnet, also „erkannt“ werden kann. Die Nichtausgezeichneten, die Nichterwählten der shortlists, die Loser auf höchstem Niveau sollten also gewürdigt werden durch die Chance, eine brillante Laudatio zu halten, die möglichst die Preisrichter beschämt, eine anfechtbare Wahl getroffen zu haben und sie durch die nächste Preisverleihung zu korrigieren. Da es aber keine unanfechtbare Wahl geben kann, weil es stets ein Missverhältnis zwischen der Gruppe der Preisenswürdigen und dem einen Auserwählten geben muss, halten die Loser nicht die Laudatio, sondern eine Festrede.
IV. Zur Anwendung:
Wir haben bei solchen Gelegenheiten die Vorstellung, dass in der festlichen Vermittlung von Einmaligkeit und Wiederholung das Grundmodell unserer Lebenserfahrung, nämlich die Vermittlung von Zukünftigem mit den Erfahrungen des Gewesenen enthalten ist. Das bedarf des Festes, denn fast alle neigen dazu, von der Zukunft nicht eben das Beste zu erwarten; dem kann man nur in festlicher Gestimmtheit begegnen, also in der Stimmung, in der man in der Antike die großen Tragödien rezipierte, nämlich im Akt demonstrativer Lebensfreude mit Schlemmen und Schlürfen auf den Tribünen. Nur so konnte man es ertragen, das Kommende als eine Katastrophe, als ein drohendes Ende zu akzeptieren.
In dieser Hinsicht verändert sich in unserer Gegenwart etwas grundsätzlich. Die sterblichen Menschlein, die sich bisher angesichts ewiger Natur nur als Sandkörner im Stundenglas verstanden, sind plötzlich zu Trägern der Hoffnung auf Dauer geworden. Nachdem selbst die Eisberge abschmelzen, selbst die Gletscher ruiniert werden, die Hochgebirge abbröckeln, ist auf die Repräsentanz der Ewigkeit als Natur kein Verlass mehr. Nur die Menschen tragen noch die Vorstellung, dass es so etwas wie Ewigkeit und Dauer geben muss als Remedium gegen die Furien des Verschwindens: Und was wäre ein noch angemessenerer Anlass zum Festefeiern als die Verpflichtung auf die ewige Wiederholung? So ein Tag wie heute, er dürfte nie vergehen, schrieb Nietzsche als Summa aller Lustantriebe, denn alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit.
Hannah Arendt hat den Wechsel von der ewigen Natur zum flüchtigsten Menschenleben als Stifter der Gewissheit von Ewigkeit in einem grandiosen Essay untersucht, den sie mit dem eigenen Vortrag eines Festgedichts beschließt. Es stammt von Rilke, der im Malte Laurids Brigge übrigens eine ganz eigene Selbstversuchung schildert.
Berge ruhn, von Sternen überprächtigt,
– aber auch in ihnen flimmert Zeit.
Ach, in meinem wilden Herzen nächtigt
obdachlos die Unvergänglichkeit.
Rilkes festliches Pathos verweist auf Sloterdijks Begriff des apokalyptischen Anfangens, den er in den Frankfurter Vorlesungen verwendet.
V. Kurierung durch Symptomverordnung
Der im Titel der Festrede angegebene Begriff der Arzeneyen geht auf Petrarca zurück, der in seiner berühmtesten Schrift De remediis utriusque fortunae, also in der Darstellung der Heilmittel gegen Glück wie Unglück, gegen die Furie des Verschwindens und die Sehnsucht nach Dauer, nach dem Anfangen-zu-dürfen, um Enden-zu-können, mehrere probate Mittel anbietet, unter denen die Abwehr des horror pleni an erster Stelle steht. Was damit auf heutigem Erfahrungsniveau gemeint ist, weiß jeder Autor, der sich für selbstsicher genug hält, die Frankfurter Buchmesse besuchen zu können oder im „Kaufhaus des Westens“ als Reisender ein Zwischengericht zu sich zu nehmen. Ihn erfasst vor der unübersehbaren Fülle von Büchern und lukullischen Attraktionen ein unüberwindlicher Ekel, dem man nur durch Flucht aus der Fülle der Welt begegnen kann. Denn die Erfahrung in der Moderne der von Produkten vollgestellten Welt heißt ja „less is more“. Aufmerksamkeit ist nur durch Reduktion, durch Abblendung der beliebigen Vielheit von Reizen zu erreichen. „Epoché/Abschattung“ nennen das die Philosophen und stellen dem Laien in Aussicht, gerade in der Leere die Fülle der Selbstwahrnehmung erfahren zu können. Aber diese moderne Erfahrung teilte schon Petrarca in den 1340er Jahren, als er in seinem Trostspiegel unter dem Titel „Von überfluß/menge und viele der Bücher“ klagt, man würde von der Unzahl der produzierten Bücher daran gehindert, selber welche zu schreiben – wieder eine Paradoxie Sloterdijkschen Formats, der ja ununterbrochen schreibt, um nicht gezwungen zu sein, die meist unerheblichen Schreibereien anderer lesen zu müssen.
Aber nicht erst Petrarca machte derartige Erfahrungen von modernem Bewusstsein. Diese Erfahrung gehört bereits zur Grundlage des Philosophierens von Christen, wie es mit dem Johannes-Evangelium und dem Bericht der Apokalypse des Johannes begann und über Justinus, Tertullian bis zu den neuen Patriarchen, den Kirchenvätern in der revolutionären Gestalt von Philosophie als Theologie entwickelt wurde. Nichts Ehrenderes und Größeres lässt sich über Sloterdijks Werkschaffen sagen, als dass er in dieser evolutionären Reihe gesehen werden kann: Wer Theologie als Wissenschaft betreibt, ist Philosoph. Das ist natürlich einerseits, wie Franz Overbeck schrieb, Theologie als Kunst, sich den Bekenntnisterror der Religionen vom Halse zu halten; andererseits kennzeichnet das die unhintergehbare Notwendigkeit, selber zu denken, also auf die eigene Erfahrung gerade für die Erkenntnis des Allgemeinsten angewiesen zu sein, sich nicht mehr tradierten Wahrheiten unterwerfen zu müssen, bloß weil die Wahrheit in keiner Hinsicht von der ausgeprägten Individualität abhängen, also von ihrer Vermittlung durch Individuen bestimmt sein könne. Sloterdijk hat sich mit dem Begriff des apokalyptischen Anfangens auf beide Positionen bezogen: Auf die Notwendigkeit, durch Reduktion und Epoché die Humaninseln zu bilden, in deren Innerem Individualität entstehen kann, und auf die apokalyptische Kehre, mit der Johannes auf Patmos den bis dato bloß dialektisch abstrakt gedachten Zusammenhang von Enden und Anfangen zu einer Handlungsmaxime jedes Menschen werden ließ. Sloterdijk verficht als einer der wenigen Zeitgenossen das Konzept des Werkschaffens als Vollendung des Zusammenhangs von Anfangen und Enden – ganz in Folge der Bennschen Maxime, dass etwas vollendet sein müsse, wenn es beendet wird. Er beugt sich nicht dem Defätismus der Ohnmacht, die ihr Versagen zur Werkvollendung in eine sachlogische Bestimmung von jeder Arbeit als „work in progress“ rationalisiert. Sloterdijk schafft Werke von patriarchischem Anspruch auf Vollendung. Von den christlichen Kirchenvätern des vierten Jahrhunderts über die amerikanischen Gründerväter des 18. Jahrhunderts zum Begründungsvater des Synkretismus als avanciertester Theorie der Moderne, deren Fortschrittsdefinition lautet: Diejenige Gesellschaft ist die fortschrittlichste, die die größte Anzahl ihrer historischen Entwicklungszustände vergegenwärtigt (vor allem in der phantastischen Erfindung von Museen). Fast möchte man hoffen, dass der zentrale Wirkungsort Sloterdijks, Karlsruhe, zu einem Vatikan des Synkretismus werden möge, einem neuen Alexandria, von „sloterten Dijken“ umgeben, und er als ein triumphierender Patriarch jener gesellschaftlichen Forderungen verehrt würde, die uns heute in Zeitungen und Banken, in Boutiquen und Unternehmen als das „Mehr“ angekündigt wird, das über die bloße Versammlung von „Allem“ hinausführt: „Geld und Mehr“, „Fisch und Mehr“, „Reisen und Mehr“, „Erholung und Mehr“, „Gesundheit und Mehr“, „Alles und Mehr“.
Der Namenspatron unseres Preises, Cicero, hatte noch 50 Jahre vor der Zeitenwende ausdrücklich angemerkt: „certe ignoratio futurorum malorum utilior est quam scientia“, das heißt, es sei für die Menschen zuträglicher, wenn sie von den ihnen drohenden zukünftigen Übeln nichts wüssten. Eine Empfehlung, die naive Leute sich heute noch gerne von allen gesagt sein lassen, die ein Interesse daran haben, bloß nicht die zukünftigen Konsequenzen gegenwärtiger Entscheidungen auch für das Nichtstun vor Augen zu führen. Aber auch die Nicht-Naiven könnten Cicero gedanklich folgen wollen, weil sie erkannt haben, dass Wissen Ohnmacht begründen kann, gar das Voraus-Wissen zu lähmen vermag. Die Naiven halten es für schlechte Negativität, immer nur auf drohende Katastrophen hingewiesen zu werden. Sie wollen von diesem ewigen Schwarzsehen nichts wissen und diskreditieren die Kraft der Antizipation als gefährlich, weil man den Teufel nicht an die Wand malen solle, beziehungsweise das Menetekel über die Theke gehöre, an der man sich gegen jede Art von bedrohlicher Vorsehung durch Alkohol immunisiert.
Derartige Angsthasen wären leicht zu therapieren, wenn man ihnen das apokalyptische Denken als Arzeney verordnen könnte. Bei Apokalypse denken sie aber an unerträglich schmerzliche Verabreichungen von Untergangsdrohungen, obwohl in der Apokalypse der Vorschein des Endes gerade im Gegenteil die immer erneute Chance des Beginnens bietet. Wer einen Tisch zimmern will, muss das Ende seiner Gestaltungstätigkeit, das Bild des vollendeten Tischs vor Augen haben – sonst wäre das Hobeln und Schneiden und Bohren des Holzes beliebig und führte nicht zu dem gewünschten Resultat, einem Tisch. Im vorweg genommenen Ende liegt also die logische Begründung der Möglichkeit anzufangen. Apokalyptisches Denken befördert demnach die Kraft zum Beginnen, denn wer das Ende antizipiert und damit hinter sich gebracht hat, wird durch nichts mehr gehindert loszulegen, meinte auch der Augustinermönch Luther mit seinem viel zitierten Diktum: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Kirchenvater Augustin begründete geradezu den Sinn des menschlichen Daseins, jederzeit initiativ werden zu können, einen Anfang zu setzen – gerade wenn auf längere Sicht nichts außer der göttlichen Liebe Bestand hat: „initium ut esset homo creatus est“. Dieses Räsonnement, das Sloterdijk im Begriff des „apokalyptischen Anfangens“ so großartig verdichtet hat, wurde für Europa durch die Fassung bestimmend, die ihm Johannes auf Patmos gab.
Als Kaiser Domitian den Apostel Johannes auf Patmos im Jahre 86 n.Chr. für rund acht Jahre festsetzte, erwartete er die Enthüllung des Geheimnisses einer neuen jüdischen Sekte, die vor allem die Römer irritierte, weil die Sektenmitglieder ihren unbändigen Optimismus, ihre Glaubensgewissheit nicht aus der Kraft militärischer Stärke, aus materiellem Reichtum, aus der Unüberwindlichkeit von Festungsmauern und Machtbündnissen ableiteten. Johannes eröffnete dem intellektuell wie künstlerisch höchst ambitionierten Domitian eben das apokalyptische Denken als Zentrum christlicher Zukunftsgewissheit. In Kurzform, die von der Anthropologie über die Alltagsweisheit bis zu den heutigen Trainingsmethoden für Hochleistungssportler verbindlich ist, besagt apokalyptisches Denken: Nur wer sich mit den Gefahren, die das menschliche Leben tatsächlich bedrohen, vertraut macht, indem er sie immer und immer wieder in seine Vorstellung ruft, hat eine gut begründete Chance, der Bedrohung eben durch die Antizipation entgehen zu können. Nur radikaler Pessimismus kann einen nicht naiven Optimismus des Überlebens hervorbringen. Nur wer eine extrem gefährliche Rennstrecke hunderte Male gedanklich durchfahren hat, kann damit rechnen, sie auch realiter mit einem Rennwagen ohne Unfall zu bewältigen. In besonderer Weise wird die Antizipation des drohenden Scheiterns durch die Fähigkeit der Menschen zur Empathie, das heißt zum Vorausleiden, verstärkt, da Schmerzvermeidung den natürlichen Impuls zur Selbstbewahrung des Lebendigen stimuliert.
VI. Versuchsanordnung zur Selbstversuchung: Essayismus in der Isolierstation
Dem fatalen Missverständnis des apokalyptischen Denkens als miesepetrigem Einspruch gegen jeglichen Zukunftsoptimismus durch den triumphalen Hinweis, alles was entsteht, sei wert, dass es zu Grunde geht, entspricht eine ebenso kontraproduktive Fehlinterpretation des Topos „Versuchung“, der in zahllosen Varianten seit dem 4. Jahrhundert n.Chr. auch von Künstlern vergegenwärtigt wurde. Man reduzierte das Motiv auf das Training von moralischer Widerstandskraft der heiligen Männer, die sich nach schweren inneren Kämpfen dann doch gegen die Versuchung durch Wein, Weib und Gesang resistent gezeigt hätten. Dabei hätten simple Überlegungen zum Beispiel zu der Frage führen können, wieso sich die heiligmäßigen Eremiten gerade in die Wüste begaben, um ihre Widerstandskraft gegen sinnliche Versuchungen zu erproben, wo doch in der kärglichen Einöde weder nackte Frauen noch opulente Speisen oder opportunistische Ruhmredner zu erwarten sind. Die Wüste war vielmehr ein Fluchtort für religiös-kulturelles Führungspersonal, das der Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian zu Beginn des 4. Jahrhunderts entgehen wollte. Unter ihnen war auch der Asket Antonius, der sein elterliches Erbe den Armen gegeben hatte und endlich von der Welt in Ruhe gelassen werden wollte: Wer in der Wüste sitzt und der Herzensruhe pflegt, ist den drei anstrengendsten Kämpfen entrissen, nämlich dem Hören auf das Geschwätz, dem Druck mit zu schwadronieren und dem Reagieren auf pornographische Stimulierung der Blicke, die sich doch so schnell erschöpfen. Der Eremit hat nur noch das Ziel, sich von der Attraktivität derartiger Nichtigkeiten freizumachen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und wie gelingt ihm das? Eben durch das Training seiner Kraft zur Antizipation, das heißt durch Feiung gegen Bedrohungen, indem er sich ihnen mutwillig, ja systematisch konfrontiert. Der Asket flieht also nicht vor den Anfechtungen, sondern setzt sich ihnen immer wieder in äußerster Radikalität aus, um gegen sie immun zu werden. So wurde Antonius zum offiziellen Schutzheiligen gegen Seuchen, lange bevor man die Funktionen des Immunsystems entdeckt hatte.
Derartige Selbstversuchung ist das zentrale Motiv, unter dem Sloterdijk, wie ich meine, sein gesamtes Lebenswerk entwickelt hat. Schon 2007 rundete sich der dreißigste Jahrestag unserer gemeinsamen Auftritte: Der erste fand im IDZ Berlin 1977 statt. Da kann man vielleicht schon sagen, was denn die Kontinuität in einem solchen Werk ausmacht.
Sloterdijk schreibt, wie gesagt: Ein Autor, der etwas taugt, infiziert sich mit den Stoffen, an denen er arbeitet. Dass er sich selbst meinen kann als den, der etwas taugt, müssen ihm auch die Böswilligsten zugestehen. Also spricht Sloterdijk auch seine eigene Selbstversuchung an, natürlich nicht nur nach dem Beispiel der Einsiedler, sondern auch nach den Exempla der Begründer wissenschaftlicher Methoden der Immunisierung durch Selbstversuchung. An die Seite des heiligen Antonius treten Gestalten wie Francis Bacon, der lehrte „natura non nisi parendo vincitur“ (in zeitgemäßer Übersetzung: die Natur beherrscht man nur durch Befolgung der Naturgesetze, weshalb Marx meinte, man müsse den Verhältnissen ihre eigne Melodie vorspielen, um sie zum Tanzen zu bringen – ich selber habe dieses Verfahren als Strategie der negativen Affirmation in der Kunstpraxis entfaltet). Bacons Lehre befolgte der Erfinder der Pockenimpfung, Edward Jenner, der sich Ende des 18. Jahrhunderts im Selbstversuch gegen die Kuhpocken feite. Hahnemann baute auf dem Baconschen Gedanken similia similibus die Homöopathie auf, derzufolge der Organismus Krankheitserreger nur durch Aktivierung von deren eignen Wirkmechanismen besiegen könne. Der Erfinder des Herzkatheters, Forßmann, erwies den Selbstversuch als Methode der Selbstversuchung aus ethischem Anspruch: Was du nicht willst, was man dir tu’, das füg’ auch keinem anderen zu.
Zu den bekanntesten Heroen der Versuchungsversuche gehört Odysseus, der sich selbst fesselte, um sich dem Sirenengesang aussetzen zu können, aber nicht ausliefern zu müssen. Der Heroismus der Selbstversuchung feit gegen die sinnfälligen Einverständnisse mit den gegebenen Verhältnissen, gegen die Verlockungen durch die Beförderung, die einen erwartet, wenn man Ja sagt. Ja heißt s.i. oder systemkonformes Irresein. Wer Ja sagt in dieser Welt, muss verrückt sein, systemkonform verrückt sein oder das sacrificium intellectus begehen, also seinen Verstand an der Kasse des Vergnügungsetablissements „Leben“ abgeben, sonst ist die Menschheit nicht zu ertragen. Es ist aber ebenfalls nicht zu ertragen, Nein zu sagen, sonst wäre der permanente Selbstmord das einzige Verfahren, um den Anspruch auf Dauer zur Geltung zu bringen. Wie vermittelt man also das Ja mit dem Nein? Der große Meister in der Vorgängerschaft, eigentlich in direkter Vaterschaft zu Sloterdijk, Friedrich Nietzsche, ist darin unübertroffen, wie er das Ja zum Nein begründet, von dem heute noch alle anspruchsvollen Kabarettisten, Karikaturisten und Zyniker in der Nachfolge des Diogenes zehren.
Aber es gibt, wie wir seit Nietzsche wissen, einen Überschuss an Möglichkeiten der Selbstimmunisierung durch den Effekt, den wir heute Autoimmunerkrankung nennen. Im Bereich des sozialen Lebens hat man dergleichen leidvoll kennen gelernt als Fundamentalismus, Dogmatismus und Totalitarismus; das sind Autoimmunerkrankungen des sozialen Körpers, die als politische Korrektheitsforderung über wahnhaft-kollektive Verblendung noch hinausgehen. Eines der wichtigsten Kapitel aus der Sphären-Trilogie ist der Entdeckung des Immunsystems gewidmet.
Unter den historischen Versuchsanlagen zur Selbstversuchung mit entsprechender Autoimmunerkrankung im Gefolge ist das Leben von Asketen in der Wüste unter den Bedingungen der Depravation, der strikten Reduktion äußerer Stimuli. Es gäbe viele Möglichkeiten, Darstellungen dieser Beispiele hier kurz vorzuführen und ihre Stellung im Kontext aller anderen Versuchsanordnungen zu bestimmen: etwa im Umfeld der Versuchung Christi durch den Teufel, von Dürers „Ritter, Tod und Teufel“, von Dr. Faustus‘ Versuchung durch Mephisto oder die der Ballermann-Gäste auf Mallorca oder die von Wissenschaftlern, welche durch das tägliche Versprechen von Geld und Geltung versucht werden, die tödlichen Mächte aus ihren Laboren loszulassen. Ein barockes Emblem zeigt Christus bei Sturm und Regen mit der Bibel in der Hand umschmeichelt von einer Schlange; die Botschaft des Emblems lautet „Unversucht Mann / nichts wissen kann“.
Aber ich wähle zum ausgezeichneten Exempel ein Gemälde, das in der Staatsgalerie in Karlsruhe hängt: Joos van Craesbeeck hat es um 1650 in der Tradition von Antonius-Darstellungen ausgeführt. Karlsruhe ist Geburtsstadt und heutiges Tätigkeitszentrum Sloterdijks. Unübersehbar ist die Portraitähnlichkeit des Craesbeeckschen Höllenkopfes mit Sloterdijk, vor allem im Ausdruck schauspielerischer Souveränität, mit der mimisch die Balance zwischen gespieltem Schrecken und eben solcher Darstellung von Überraschtheit angedeutet wird. Damit will ich auf eine der Grundkonstellationen aller Selbstversuchung verweisen, nämlich die Bühne als Versuchsanlage. Bis heute führt die Auseinandersetzung zwischen Brechtianern und Stanislawski-Jüngern zu den kuriosesten Auswüchsen; man zerreißt sich förmlich die Mäuler in wechselseitiger Verteufelung über die Frage, ob der Schauspieler aus der Identifizierung mit der von ihm dargestellten Figur die größte Wirksamkeit durch Authentizität zu erreichen vermag oder aber, ganz im Gegenteil, nur die Professionalität wirkt, mit der ein Schauspieler in kühler Distanzierung Seelenqual als Seelenquark demonstriert.
Michael Philipp, der Anfang 2008 dem Topos der Versuchung des heiligen Antonius eine glanzvolle Ausstellung im Bucerius-Kunstforum zu Hamburg widmete, beschreibt das Bild:
„Auffallendes und bestimmendes Element ist der große Höllenkopf, der schräg zur Bildmitte im Wasser liegt [wie Höllengepeinigte, denen das Wasser zum Munde steht, ohne ihren Durst je löschen zu können] (…) Größe des Kopfes, sein Realismus und sein intensiver Blick finden sich bei keinem Vorgänger. Dazu kommt eine hilflose Verletztheit des Ausdrucks, die sich in den verdrehten Augen, dem zum Schrei aufgerissenen Mund und der klaffenden Stirn ausspricht. Die beklemmende, offensive Wirkung erreicht keine der früheren Ausgestaltungen dieses Motivs. Die Augen stieren den Betrachter an, sie lenken aber auch den Blick auf Antonius. Der sitzt rechts unter einem hohlen Baum und hält ein Buch in der Hand. Seine Kutte trägt den Buchstaben A (…) An den Stamm des Baumes, den ein Teufelchen bewohnt, ist ein Zettel mit einer Kreuzigungsszene gepinnt. Beiläufiger, flüchtiger lässt sich die religiöse Anspielung nicht unterbringen. Von den herkömmlichen Attributen des Heiligen hat Craesbeeck nur das Schwein aufgenommen, wobei angesichts der Vielzahl der dargestellten Kreaturen kaum auffällt, dass das Schwein zu Antonius gehört. Das arme Schwein muss ein kleines Monster tragen, ein anderes zieht ihm am Ringelschwanz (…) Auch die [üblicherweise behauptete] Versuchung durch die Frau ist wenig dramatisch. Die Verführerin, am roten Krallenfuss kenntlich, zieht sich das Mieder von der wenig einladenden, unförmigen Brust, die Antonius mit irritiertem, aber unerregtem Seitenblick beobachtet. Sie reicht ihm (…) einen Nautilus-Pokal, ein zeitgenössisches Sinnbild für Reichtum und Wohlstand.
Die Szenerie bevölkert eine bunte Fülle tierischer und monströser Erscheinungen, von denen sich einige einem Bildprogramm zuordnen lassen, nämlich der metaphorischen Darstellung der sieben Todsünden. Die Symbole gehen auf die Radierfolge der Todsünden von Brueghel d. Ä., gestochen 1558, zurück. Die Schnecke, die auf Antonius zukriecht, verkörpert die desidia, die Trägheit oder Müßigkeit. Die ist dem Sprichwort gemäß aller Laster Anfang, denn sie ist der Ursprung von Ausschweifungen, Fressgier und Trunksucht. Für die luxuria, die Wollust, steht der Ziegenbock, der bei der bäuerlichen Schönheit neben dem Baum hervorlugt; die Unmäßigkeit, gula, stellen die beiden Gänse rechts dar, von denen eine ihren Hals in den Krug steckt. Den Neid, invidia, repräsentiert der Puter, dem der Kamm schwillt; die superbia, der Hochmut, wird von dem Pfau im Baum über der Verführerin ausgedrückt. Geiz, avaritia, zeigen die beiden Figuren im Vordergrund, die aus dem Topf Geld zählen und schließlich manifestiert das Männlein mit dem übergroßen Messer den Zorn, ira (…) [Der auf der linken Seite des Gemäldes erweckte] Eindruck einer harmlos verschrobenen Spaßgesellschaft bietet einen Hintergrund, vor dem der Höllenkopf desto drastischer wirkt. Wie bei Darstellungen des 16. Jahrhunderts von Christus im Limbus fungiert er als Pforte [für einen Gespensterzug].
Ein nackter Halbteufel hängt wie ein Ertrinkender mit beiden Händen am Lippensaum; aus einem Nachen reicht ein Tiermonster mit Entenschnabel ein Bündel weißer Tonpfeifen, die ein Grünkopf mit Hut dankbar entgegennimmt. Neben ihm in der Mundhöhle stehen drei Teufel mit glühenden Augen und ein kleiner Mann, der, die Hand vorm Mund, den Betrachter anstarrt (…) Kleine Wesen sitzen in der Stirnhöhle des Kopfes, die die aufgeklappte Schädelfront freigibt. Eines von ihnen schwingt eine Tabakspfeife [ein Verweis auf das in Mode gekommene Laster des Rauchens]. Ein anderes Wesen, mit grüner Jacke und türkisfarbenem Hut, sitzt malend vor einer Leinwand auf Staffelei. So zeigt Craesbeeck, woher die Erscheinungen kommen – es sind Hirngespinste, Kopfgeburten, Denkbilder [wie sie Künstler entwickeln]. Die Staffelei gibt den Bezug zum Maler Craesbeeck: Das Dargestellte entspringt seiner Phantasie, sind die Grillen des Künstlers. Damit greift Craesbeeck eine zeitgenössische Bezeichnung für Genremaler auf, die pictores gryllorum genannt wurden. Grillen bezeichneten sowohl eine plötzliche Eingebung wie eine aberwitzige Idee (…) Dieser Ursprung der Einbildungskraft kennzeichnet alle künstlerische Produktion – im Zusammenhang der Antonius-Versuchung hat Craesbeeck damit eine singuläre Antwort auf die Frage nach dem Ursprung der Versuchung gegeben.“
Das mag heißen, dass für die Künstler gerade die Resultate ihrer je eignen Autorschaft, also ihre Phantasieprodukte zu einer Bedrohung ihres Schaffens werden, nämlich zur Auflösung der Arbeitsfähigkeit führen können, wenn die notwendige Konzentration durch Abschattung in der Abgeschiedenheit des Studiolo oder Ateliers nicht mehr gelingt.
Diese Gefährdung durch Individualisierung, in der der Autor für sich zur Autorität wird, mag man am ehesten erfassen, wenn man den Höllenkopf für einen kurzen Moment jenem des Zeus parallel setzt, den der schmiedekundige Bruder Hephaistos mit dem Meisel öffnete, um den konvulsivischen Kopf- und Gedankenschmerz des Gottes zu lindern; dem Haupte des Zeus entstieg die völlig ausformulierte Kopfgeburt Pallas Athene in voller Rüstung, will sagen, dem Haupt entsprang der Werkgedanke – Pallas Athene stand für die Kraft zur vollendeten Realisierung eines Konzepts. Im Gegensatz dazu scheint dem geöffneten Schädel bei Craesbeeck im wahllosen Auswurf eine Unzahl von Gedankenstückchen und Vorstellungsfetzen zu entweichen. Mit Sloterdijks Worten: Individualität, die sich auf die Spur kommen will, setzt voraus, dass Einzelne sich auf Ruheinseln (die utopoi) zurückziehen, auf denen sie den möglichen Unterschied zwischen Kollektivstimme und inneren Stimmen erfahren können und eine der Stimmen schließlich als die eigene erkennen. Ein so sich selbst erfahrendes, vernünftiges Ich, das sich von anderen zu unterscheiden vermag, ist ohne (akustische) Isolation nicht zu haben.
Auf einer Isola isoliert, wird der homo silens aus seinem Inneren, inwendig voller Figur, so Dürer, einer Kakophonie von Stimmen ausgesetzt, akustischen und visuellen Halluzinationen, die er nur in der Ordnung eines Werkes zu bändigen vermag, sonst gebiert das Hirn, von seinen entgrenzten Möglichkeiten träumend, nichts als Ungeheuer des Wahnsinns. Dem in der Werktätigkeit zu widerstehen, ist ein Akt der Selbstfesselung, ja der Selbstversklavung, für die das gelingende Werk ein angemessener Lohn ist: ars gratia artis, das Gelingen ist der Lohn der Mühen.
In der Tat, das Faszinierendste in der Konfrontation mit den Arbeitsresultaten Sloterdijks ist für jeden seiner Leser wie Hörer ein ungläubiges Staunen, mit welcher Kraft, Unbeirrbarkeit, ja calvinistischer Tüchtigkeit und bohèmefremder Tugendhaftigkeit er die Unzahl der Assoziationen, Geistgestalten, Sinnbilder, die seine Gedankenwelt bevölkern, in die Ordnung eines Werkkonzeptes zu zwingen vermag, um dieses Werk dann auch tatsächlich so zu realisieren, als sei es als Ganzes seinem Kopfe entstiegen wie Athene dem göttlichen Haupt.
Das wesentliche Resultat von Sloterdijks Aufenthalten in den Versuchsanlagen der Individualität bezeichnet starke Gründe, mit anderen zusammen sein zu wollen. Das sind zunächst die Leser oder Betrachter des als Werk verwirklichten Arbeitsplans.
Die Leser versichern dem Autor, dass er nicht allein bleibt mit seiner Schöpfung, wie die Kranken dem Arzt versichern, dass er nicht allein bleibt mit seinem Wissen um das richtige Leben. Die starke Medizin des Doktor Sloterdijk wie seiner Kollegen E.T.A. Hoffmann, Flaubert, Rilke oder Cranach, Bosch, Grünewald, Dürer oder Otto Dix, Max Ernst, Max Beckmann, Salvador Dalì, die alle Humaninseln für die Heiligen, das heißt, die generalisierten Anderen unserer selbst, entwarfen, immunisiert gegen die Verführung, das Werkkonzept aufzugeben, weil Modeärzte behaupteten, was der Teufel Adrian Leverkühn einzublasen versuchte:
„Ich bin gegen die Werke im großen-Ganzen. Wie sollte ich nicht einiges Vergnügen finden an der Unpässlichkeit, von der die Idee des Werkes befallen ist. Schiebe sie nicht auf gesellschaftliche Umstände. Ich weiß, du neigst dazu und pflegst zu sagen, dass diese Zustände nichts vorgeben, was verbindlich und bestätigt genug wäre, die Harmonie des selbstgenügsamen Werkes zu gewährleisten. Wahr, wahr, aber nebensächlich. Die prohibitiven Schwierigkeiten des Werks liegen tief in ihm selbst. Die historische Bewegung des musikalischen Materials hat sich gegen das geschlossene Werk gekehrt. Es schrumpft in der Zeit, es verschmäht die Ausdehnung in der Zeit (…) Nicht aus Ohnmacht, nicht aus Unfähigkeit zur Formbildung. Sondern ein unerbittlicher Imperativ der Dichtigkeit, der das Überflüssige verpönt, die Phrase negiert, das Ornament zerschlägt, richtet sich gegen die zeitliche Ausbreitung, gegen die Lebensform des Werkes. Werk, Zeit und Schein, sie sind eins, zusammen verfallen sie der Kritik. Sie erträgt Schein und Spiel nicht mehr, die Fiktion, die Selbstherrlichkeit der Form (…) Zulässig ist allein der nicht fiktive, der nicht verspielte, der unverstellte und unverklärte Ausdruck des Leidens in seinem realen Augenblick.“
Gegen diesen Defätismus des Teufels mobilisiert Sloterdijk die Kraft der Werkmeister, lieber scheitern zu wollen, als das Ziel der Werkvollendung mit fadenscheinigen Rationalisierungen aufzugeben, weil das den Talentlosesten auch noch eine Berechtigung zum Weiterbasteln verschaffte. Die waren nie auf der Insel, weder der von Campanella noch der von Defoe, und riskierten niemals die Versuchung durch die Macht des Geistes, die Versuchung durch den Allmachtswahn in gnadenloser Konkurrenz zu den Göttern. Also waren sie auch nie unten, im Limbus, in der Vorhölle, aus der nur zurückkehrt, wer dem dortigen diabolischen Fragmentismus und Zerstückelungsfuror seine Werkmission entgegensetzen kann, die Scherben zum Bilde zusammenzufügen, zum Epochenbild, zum Weltbild, zum Werk. Man darf eben nicht vergessen, dass das Symbol sich erst erschließt, wenn die fragmentierten Teile wieder zusammengefügt werden. Dafür schuf man in antiken Zeiten, in Alexandria, den höchsten intellektuellen Anspruch auf Weltbildlichkeit, den Begriff „synkretein“. Die Sloterdijkschen Werke eröffnen uns die Kraft solchen Synkretismus für unsere Gegenwart.