Das Überraschendste, was sich gegenwärtig über Mode sagen läßt, ist wohl die Behauptung, daß man sich bisher nicht genug mit der Mode beschäftigt hat. Natürlich gibt es eine Reihe großartiger Veröffentlichungen über Mode als kulturgeschichtliches Phänomen, und es gibt auch einige Ansätze, eine Theorie der Mode zu erarbeiten. Aber diese Untersuchungen faßten Mode und ihre sozialen Manifestationen als ein - wenn auch beachtliches - Phänomen unter vielen anderen sozialen Phänomenen auf; die bisherigen Untersuchungen konnten noch nicht voraussetzen, daß der sich bereits vollziehende Übergang unserer Wirtschaftsgesellschaften in Kulturgesellschaften >Mode< zum vorherrschenden Steuerungsmechanismus der Gesamtgesellschaft werden läßt.
In groben Zügen wiedergegeben, soll diese Behauptung etwa folgendes besagen: Kulturelle Phänomene gewinnen eine immer größere Bedeutung - nicht nur in dem Sinne, daß immer mehr Menschen in Museen strömen oder den Kulturtourismus einem Sonnenbadurlaub vorziehen. Die Kultur wird als Wirtschaftsfaktor immer bedeutsamer - in zweierlei Hinsicht: Zum einen macht etwa die Musikbranche der Bundesrepublik Deutschland mehr Umsatz als Luftfahrt- und Bekleidungsindustrie zusammen; zum anderen werden aber auch für Produkte wie Autos, Möbel und Kühlschränke Gestaltungsaspekte wichtig, die man mit dem herkömmlichen Stigma, bloße modische Spielerei zu sein, nicht mehr abtun kann. Kulturelle Phänomene werden für die Wirtschaft bedeutsam, weil der Absatz der Wirtschaftsgüter von kultureller Motivation wesentlich mitbestimmt ist. Der wichtigste kulturelle Faktor ist die Unterscheidbarkeit von Objekten (also auch von Wirtschaftsgütern) nach Gesichtspunkten, die nicht in erster Linie von ökonomischen oder funktionellen Zwängen vorgegeben werden. Insofern Mode immer schon auf Unterscheidungskriterien beruhte, die weder ökonomisch noch funktionell erzwungen wurden, sondern kulturellen Werten entspringen, kommt der Mode als einem System des menschlichen Differenzierungsvermögens Beispielhaftigkeit zu. Und von dem Differenzierungsvermögen hängt ja schließlich unsere Fähigkeit ab, dieser Welt in all ihren Gegebenheiten überhaupt Bedeutung zugestehen zu können. Bedeutung entsteht nur durch Unterscheiden.
Vgl. hierzu >Bedeutung entsteht durch Unterscheiden<
Die Mode ist nicht mehr bloß modisch. Daß man bis vor kurzem die Mode für modisch halten konnte, ist verständlich, weil die Unterscheidungskriterien des Entwurfs, des Schnitts, der Verarbeitung, des Materials von Saison zu Saison wechselten. Aber den Wechsel der Tage im Kalender hält man ja auch nicht für modisch. Tage, die wie jeder andere Tag vergehen, wechseln ab mit ereignisreichen Tagen, anhand deren wir unseren Lebenslauf strukturieren; eine solche Struktur zu entwickeln, ist um so wichtiger, als das gesamte Leben ja nur aus der ewigen Wiederholung gleicher Zeitzyklen besteht; so ist das auch mit der Mode. An den saisonal auffälligen Veränderungen bilden wir die Ereignishaftigkeit des Modewandels aus. Der Wechsel der Differenzierungskriterien setzt diesen Wandel nicht zur bloßen belanglosen Beliebigkeit herab. Er ist vielmehr die Voraussetzung für den Aufbau einer Ereignisstruktur. Daß die Modeerscheinungen wechseln, gibt ihnen gerade ihr Gewicht; denn in Kulturgesellschaften kommt es darauf an, möglichst keine unwiderruflichen Handlungskonsequenzen zu provozieren.
Die alten Wirtschaftsgesellschaften und Klassengesellschaften provozierten von Zeit zu Zeit unwiderrufliche Ereignisse wie Kriege, um eine Ereignisstruktur aufzubauen. Eine Kulturgesellschaft kann derartige Steuerungsversuche nicht mehr akzeptieren. Sie vermittelt alle Konflikte zwischen Individuen und Gruppen über die kulturellen Differenzen; das sind Unterscheidungsmerkmale im Erscheinungsbild oder in der Sprache, im Ritual oder den Verhaltensmustern und Werturteilen.
Mode machen anstatt Krieg, mit Musik die Welt für sich begeistern anstatt mit Gewaltdrohungen: Die Japaner scheinen in dieser Hinsicht am meisten gelernt zu haben; heute haben sie umfassender die Welt für sich gewonnen als je zu Zeiten der großkaiserlichen japanischen Waffenherrschaft im Pazifik. Die Kulturgesellschaft mit ihren unüberbietbaren Differenzierungsformen sichert die Zukunft, indem sie Bedeutung schaffende und Werte stiftende Kräfte freisetzt, die nicht auf die herkömmliche Weise zerstörerisch sind und dennoch Veränderungen ermöglichen!
Denn darum geht und ging es allezeit: Wie ist Veränderung anders möglich als durch Zerstörung? Eben durch Kultur, wie sie vor allem auch die Mode repräsentiert.
Immer wieder interessiert die Frage, ob man Moden machen kann. Einer weitverbreiteten Auffassung zufolge setzen sich zweimal pro Jahr führende Modemacher zusammen, um mehr oder weniger verbindlich festzulegen, was in der kommenden Saison als dominierender Modetrend zu gelten hat; ja, man glaubt sogar zu wissen, daß der Modewandel ausschließlich aus kommerziellen Interessen durch das Diktat der Modemacher willkürlich provoziert werde. Es ist aber bisher noch nie nachweisbar gewesen, daß solche Diktate durchsetzbar gewesen wären, selbst dann nicht, wenn man in diese Durchsetzung sehr viel Geld investierte (historische Beispiele, die das Modediktat eines Herrschers oder einer Gruppe belegen, können für die generelle Betrachtung heutiger Vorgänge vernachlässigt werden).
Auch eine andere beliebte Behauptung, daß bestimmte Modemacher ihren Kunden immer ein paar Monate voraus seien - daß sie also eine besondere Gabe hätten, zukünftige Entwicklungen aufzuspüren und mit entsprechenden Angeboten für ihren Geschäftserfolg auszunutzen, führt nicht weiter. Es bliebe ja bei dieser Antwort die Frage offen, wie denn solche Trends in den Erwartungen so vieler unterschiedlicher Menschen entstehen. Dafür läßt sich der Hinweis auf den vielbeschworenen Zeitgeist als Erklärung dieses Phänomens nur bedingt in Anspruch nehmen; denn was ist der Zeitgeist, und wie entsteht er, ja, wie setzt er sich durch?
Nein, Mode wird nicht gemacht, sie entsteht als ihre eigene Geschichte. Für diesen Vorgang ist in erster Linie der Neuigkeitswert der jeweils jüngsten Saisonmoden wichtig. Die künstlerisch-gestalterischen Erfindungen oder besser Setzungen von Modemachern irritieren durch ihre Neuigkeit, das heißt durch ihre Unvertrautheit, unsere Wahrnehmungen und damit auch unsere klassifizierenden Urteile. Mit jeder Neuigkeit wenden sich rückwärtsgewandt unsere Wahrnehmungen und Urteile über das, was wir nur durch Gewöhnung ziemlich sicher gekannt zu haben glauben.
Modewandel läßt sich immer nur im nachhinein feststellen. Die Mode der 50er Jahre, wie wir sie heute als typisch empfinden, weil wir sie gegen die Mode der 40er oder der 60er Jahre absetzen, sieht ganz anders aus, als sie für Menschen gegeben war, die sich in den 50er Jahren modisch kleideten. Aus der Tatsache, daß wir retrospektiv gut begründet Modetrends feststellen können, schließen wir, daß diese Trends auch prospektiv feststellbar sein müßten; denn Trends zu dominierenden Modeerscheinungen hat es ja immer gegeben und wird es deshalb immer geben. Die vielen Zeitgenossen, die sich den vielen auf sehr unterschiedliche Weise jeweils neuen modischen Setzungen anschließen, versuchen also, durch ihre Entscheidung für zumeist einen der neuen Vorschläge selber trendbildend zu wirken. Das scheinbar bloße modische Spiel von Anpassung und Abweichung läßt sich als Versuch verstehen, schon in der Gegenwart auf etwas einzuwirken, was sich erst zukünftig als das dominierende Erscheinungsbild dieser Gegenwart tatsächlich eruieren lassen wird. Die Zukunft verstehen solche Zeitgenossen gleichsam >natürlich< als das andere der Gegenwart und Vergangenheit. Das Angebot der jeweils neuesten Setzungen verstehen sie als das Potential, aus dem sich dieses andere Erscheinungsbild (aber auch Verhaltensweisen, Sprachformen, ja Lebensformen) entwickeln wird.
Jeder Mensch hat in einem gewissen Umfang an historischen Sachverhalten nur insofern Interesse, als er durch die Kenntnis historischer Prozesse glaubt, auf die Zukunft schließen zu können, also auf das, wie man in Zukunft die jetzige Gegenwart als eine Vergangenheit bestimmen wird. Auf dieses spätere Urteil will man mit seinen Entscheidungen und Handlungen Einfluß nehmen. Die jeweils neuen Setzungen der Modemacher werden als zukünftige Erscheinungsbilder der Gegenwart verstanden und ausprobiert. Hinter diesen Entwürfen einer zukünftigen Vergangenheit steckt die Erfahrung, die fast alle Menschen zumindest in den vergangenen einhundert Jahren gemacht haben: mit sich selbst übereinzustimmen, wenn sie Fotografien aus früheren Lebensabschnitten betrachten: »Wie ich da aussehe, das ist ja kaum zu glauben, weil ich damals gar nicht gewußt habe, wie ich von heute aus einmal wirken würde.«
Die Selbstkonfrontation - und das ist im Foto vor allem die Konfrontation mit dem eigenen Erscheinungsbild - verlagern wir in einen zukünftigen Augenblick, von dem wir auf unsere gegenwärtige Erscheinung zurückblicken werden. Auf das, was uns dann entgegentreten wird, wollen wir Einfluß nehmen mit unserer Entscheidung für jeweils eines gegen jeweils viele andere Angebote der Moden. Aber was wir wollen, ist eines, was daraus wird, ein anderes. Der unleugbare Wandel der Moden ist nicht kalkulierbar. Wir haben zwar die Freiheit, uns zu entscheiden, werden dann aber doch in Erscheinungsbilder vereinnahmt, von denen sich weder wir noch die Modemacher etwas träumen ließen. Das eben macht den Modewandel so interessant.
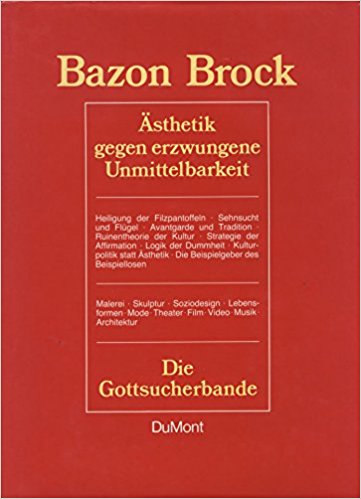 + 1 Bild
+ 1 Bild