In: Paris, Merian 12, XXXVI/C, Hamburg 1983, vgl. hierzu auch ›Erfolgszerstört‹, Band VIII, S. 331-332
Kann man eigentlich heute noch verstehen, warum es jahrelang eine so wilde Diskussion um das Centre Pompidou gegeben hat; um eine kulturelle Einrichtung also, die zu den erfolgreichsten und aktivsten der Welt gehört? Natürlich sind Besucherrekorde kein besonders gutes Argument, aber von nichts kommt nichts. Woher kam da so viel für so viele? Was hat, unterstützt auch von dem unvermeidbaren Aufschaukelungseffekt des Hin und Her von öffentlicher Empörung und Lobrede, ausgerechnet ein Museum für die Geschichte und die Aktualität der modernen Kunst - was hat eine Dépendance der Nationalbibliothek und der Cinémathèque Française zu einem Wahrzeichen von Paris aufsteigen lassen, das den guten, hundert Jahre alten Eiffelturm in der touristischen Aufmerksamkeit bereits weit überflügelt hat?
Von den Ursprüngen her, aus der Zeit heraus, in der das Konzept des Centre Pompidou entstanden ist, ließe sich für den Erfolg in erster Linie die Erklärung heranziehen, daß die Architektur des Centre dem potentiellen Besucher jegliche Schwellenangst nehme, die er vor kulturellen Institutionen hegt. Das Lieblingsthema aller Kulturdebatten der glorreichen 60er Jahre drehte sich um die Frage, wie man die Kunst verweltlichen könne, wie man aus den weihe- und würdevollen Museumskathedralen herauskomme - vom Denkmal zum »Denk-mal«, von der Kunsthalle zur Markthalle.
Die Architektur des Centre erinnert an Fabriken, Messehallen, Kaufhäuser, Lagerschuppen, Raffinerien; das sind Ereignisorte, in denen sich viele Menschen auskennen. Sie ahnen oder wissen, was ihnen im Inneren etwa begegnen wird, was ihnen an Verhaltensweisen einer lediglich unverbindlichen Kommunikation abverlangt werden wird. Kultur ist für die meisten, was die sozial Höhergestellten tun, und die kommen in Fabriken, Raffinerien, Messehallen, um zu besichtigen. Sie werden betont zuvorkommend behandelt, müssen nur hier und da mit dem Kopf nicken und dürfen alles ganz spielerisch anfassen und aufmachen oder anschalten und abdrehen. Sie spielen, wo andere arbeiten. Interesse an Kultur als Bedingung oder Konsequenz guter Positionen in der Gesellschaft zeigt sich offensichtlich in der Fähigkeit zum Spiel.
Und nun hat (so signalisiert das Centre Pompidou) die unaufhaltsame Entwicklung der Technik es uns ermöglicht, auch in den Fabriken zu spielen. Die Arbeit selbst wird zum Spiel - immer interessant, zwanglos, frei wie die freie Kunst. Wie gesagt, das war ein Erfolgsargument aus den späten 60er Jahren, und zwar von beiden Seiten, von den studentischen Systemkritikern wie auch von den ältlichen Fortschrittsfanatikern. Damals verstanden nur wenige, daß der Fortschritt darin bestehen würde, auch das Spiel zu einer Arbeit werden zu lassen, mit der Kinder gar nicht früh genug anfangen könnten. Das Centre führte als eines der ersten Museen selbstverständlich die Elektronik ein. Die Kleinen spielen mit hingebungsvollem Ernst an Kulturmaschinen, bei deren Anblick allein die verständnislosen Erwachsenen schon stolz auf ihre Mitwelt sind, die so etwas baut und bedient.
Kulturmaschinen! Das Centre ist eine Kulturmaschine oder vielmehr eine Kulturfabrik. Endlich weiß man wieder, wo die Kultur herkommt, nämlich von dort, wo alles herkommt: aus der Fabrik. Sogar die Milch kommt ja inzwischen aus der Fabrik, das Fleisch auch. Und da sollte man sich weiter vorstellen müssen, daß etwa Kunst von Künstlern aus einsamen BasteIkammern kommt? Kühe und Künstler sind etwas Altbackenes, gegen das schon Warhols Factory im New York der 60er Jahre polemisierte.
Auch in Hamburg und Berlin gab es lange vor dem Centre Kulturfabriken. Die Künstler selber verließen ihre Theater und Museen, um in Fabriken zu spielen und auszustellen. Die Fabriken schienen als offenbare Geheimnisse die allseits geforderte Gleichsetzung von Kunst und Leben zu stärken. Es sieht zwar hie und da so aus, als ob auch in Fabriken Menschen nötig seien, um zum Beispiel Musik zu machen; aber erstens spielen die ja nur, und zweitens spielen sie, damit Schallplatten, Tonbänder und Filme hergestellt werden können. Und die kommen in jedem Fall aus der Fabrik.
Und woher kommen zum Beispiel Kunstgeschichten? Sie kommen aus Maschinen, wenn man auf die richtigen Knöpfe drückt. Das ist nicht schwer zu verstehen, zumal ein liebenswürdiger Besucherdienst mit Erklärungen bereitsteht. Natürlich erklärt er nicht, wie denn die Kunstgeschichten in die Bild-, Text- und Tonmaschinen hineinkommen, sie werden eben fabriziert.
Kultur ist auch, wenn alles fraglos funktioniert, und die Technik besorgt das. So signalisiert der Bau des Centre, daß in ihm alles technisch funktioniert und deshalb sehenswert ist. Daß der Bau gerade ›rein technisch‹ nicht funktioniert, braucht ja niemand zu wissen - Hauptsache, er sieht so aus, so modern (endlich ist auch die Kultur zeitgenössisch) und so mächtig (es heißt nach dem Staatspräsidenten Pompidou, der das Zentrum für genauso wichtig hielt wie die Concorde oder wie das Staatsschiff ›France‹). Ist das nicht ein großartiges Zeichen für einen großen Kulturanspruchf? Künstliches Klima und künstliches Licht sind schließlich überall ein Problem, also gar keines. Ja, aber die Baufälligkeit schon nach sieben Jahren Betrieb, die statischen Bedenklichkeiten, die dazu führten, daß bereits Stützen in die sensationelle Konstruktion eingezogen werden mußten. Auch das sind Probleme, die es überall gibt und die deshalb nicht beachtet werden müssen. Der Bau ist so attraktiv, daß er von der Masse seiner Besucher zwangsläufig zerstört werden muß: Das ist ja gerade die Bestätigung des sagenhaften Erfolges. Der Bau ist sehr demokratisch, hört man. Die großen Glasfassaden ließen den Blick nach innen gehen und von innen nach außen – wer hätte je solche Durchsichtigkeit aller Verhältnisse für möglich gehalten? Man braucht gar nicht hineinzugehen und weiß doch Bescheid.
Von der Rue Beaubourg her sieht man »kräftige Farben der Fassaden, die ihre Funktionen symbolisieren«. Blaue Leitungen: Klimaanlage; grüne Leitungen: Feuerlöschsysteme; gelbe Leitungen: Stromsysteme; rote Leitungen: Publikums- oder Lastenverkehr. Wie ausgeweidet steht der Koloß. Die Eingeweide hängen draußen, damit im Innern saubere Verhältnisse herrschen. Es sind aber die gleichen wie draußen, nämlich ›Straßen‹ und ›Häuser‹ und viel ›Verkehr‹, der die Aufmerksamkeit der Besucher völlig in Beschlag nimmt, zumal die großen Gestänge und Gerüste sich auch ungewollt dem Besucher aufdrängen. Da ist man dankbar, wenn man nicht auch noch den zahllosen Gegenständen der eigentlichen Ausstellungen Aufmerksamkeit zu widmen braucht, zumal man sich inzwischen in den Röhren der rollenden Bürgersteige auch noch als lebendes Ausstellungsstück betätigt, als Lebendmotiv, wie der freundliche Führer das nennt.
Noch eine Erklärung für den Erfolg? Das Centre ist eine touristische Attraktion im ehemaligen Hallenviertel. 1961 beschloß man, die Großmärkte aus dem Stadtzentrum zu verlagern, wo man einst von Mitternacht bis zum Morgen zwischen Kadavern flanierte, halbnackten Herkulessen mit blutbeschmutzten Schultertüchern und Schürzen aus dem Wege sprang, schaudernd neben Ganoven und Huren eine Zwiebelsuppe pustend abzukühlen versuchte, wo ein paar Kalbsköpfe mit stieren Augenballen vor italienisch spitze Halbschuhe rollten und Ratten, sachlich-ruhig, keinen Anlaß sahen, ihre Existenz zu verheimlichen, wo bereits 1937 aus hygienischen Gründen das alte Beaubourgviertel abgerissen wurde, um Aufmarschgelände für die Lieferanten und Käufer der Hallen zu schaffen, dort herrschen nun mit staatlich-zentralistisch gestärkter Geste die kreativen Künste.
Natur im Darm, Kultur im Kopf. Da der Bauch von Paris abgetragen wurde, liegt der Kunstkopf jetzt wie enthauptet da. Aber wie man einst Blut und Hoden verwurstete, so jetzt die hygienisch einwandfreien, sauberen, über sichtlichen Gemälde, Filme, Videos, Plastiken, elektronischen Klangbilder. Die exotischen Hallentypen umlauern das Centre, bis sie auf der offiziell so genannten Piazza (eine Piazza in Paris, der Stadt der herrlichsten Plätze!) als Kleinkünstler auftreten dürfen. Das Messer, das früher das Schlachtvieh traf, wird jetzt faktisch ins eigene Fleisch gestoßen. Die Flammen, die früher Geflügel absengten, züngeln jetzt auf nackter Menschenhaut.
Oft will es aber so scheinen, als ob sie sich und ihr Paris mit Abwehrzauber und magischer Beschwörung vor dem säkularisierten Ungeheuer künstlerischer Schöpfungsmanie zu schützen versuchten. Denn dies gigantische Kraftwerk des profanen Geistes sieht allzusehr wie seine eigene Utopie aus. Der Kunstkopf, die herrischen Ideen von Künstlern und Administranten verschlingen hier das historische Paris mit Mann und Haus, um es im Neubauviertel La Défense wieder auszuscheiden.
So verwandelt sich das ruhmreiche Paris dank der imperialen Allüren seiner Herrscher in kalte merde. Und man kann wieder verstehen, warum diese pro Jahr von fünfmal so vielen Menschen wie der Louvre bestaunt wird: Sie sind glücklich, weil sie sich selbst vor allem als Merdeproduzenten erleben.
So sagt der stolze Blick aufs Selbstgemachte: »Das kann ich auch.«
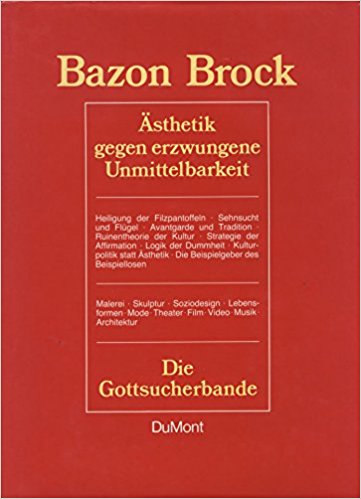 + 1 Bild
+ 1 Bild