In: Daniel Spoerri: Le Musée sentimental de Cologne. Entwurf zu einem Lexikon von Reliquien und Relikten aus zwei Jahrtausenden KÖLN INCOGNITO, (Katalog) Kölnischer Kunstverein, Köln 1979
1 Bitte einsteigen!
Wenn Daniel Spoerri und seine Studenten, Freunde, Sammler, Künstler und Bürger Kölns es nun unternehmen, den Kölnern ein »Museum der Liebe zu den Dingen einzurichten, so ermöglichen sie uns allen, einem Typus des Museums wiederzubegegnen, den es seit etwa zweihundert Jahren nicht mehr gibt; aus dem aber sich alle heute so hochgeschätzten und so leistungsfähigen Formen von Museumsarbeit entwickelt haben: den Kunst- und Wunderkammern.
Der verewigte Professor der Kunstgeschichte Julius von Schlosser aus Wien prägte mit seiner 1908 erstmals veröffentlichten Untersuchung über die Entstehung der Institution Museum den Begriff »Kunst- und Wunderkammern«, der recht deutlich aussagt, wie die Vorläufer unserer heutigen Museen angelegt waren. 1671 erschien in Dresden, neben Prag, München und Wien damals ein entscheidendes Sammlungszentrum Mitteleuropas, eine »Kurze Vorstellung der Chur-Fürstlichen Sächsischen HOHEN REGELWERKE, nehmlich: Der Fürstlichen Kunst-Kammer und anderer Seiner Chur- Fürstlichen Durchlaucht höchstschätzbaren unvergleichlich wichtigen Dinge, … auch In- und ausländischen Durchreisenden Hohen Personen zu Dienst« (weiter unten mehr über die »hohen Regelwerke«).
Der Begriff »Kunstkammer« war also etabliert; wenn Schlosser ihn um die »Wunderkammern« erweitert, dann kennzeichnet er damit präzise den Charakter der Objekte, die in den Kunstkammern angehäuft waren, und er kennzeichnet damit vor allem den Gesichtspunkt, unter dem diese Objekte damals zusammen tragen wurden. Die Objekte, »Sachen von Natur, rar und künstlich« »waren merk- und denk würdig«, und zwar wegen der Wirkung, die von ihnen einmal oder immer noch ausging. Diese »artificialia und naturalia«, also von der Natur vorgegebene oder von Menschenhand gemachte Dinge dokumentierten ein fast undurchdringliches Geflecht von ›Wirkkräften‹, das die Welt durchzieht; die Objekte selber wurden als Übersetzungen oder Manifestation der kosmischen Kraftlinien aufgefaßt, etwa so, wie heute ein Alltagsmensch das Radio oder den Fernseher auffaßt: Da kommt etwas heraus als Wort und Bild und Musik, was man nicht sehen oder anfassen kann auf seinem Wege ›Hinein‹ in das Objekt Radio. Die Radiowellen des Geistes und der Seele vergegenständlichten die Objekte der Kunst- und Wunderkammern, wobei sich eben im kleinsten und zufälligsten gefundenen Objekt genauso wie in einem Gemälde von Meisterhand die Welt und Leben beherrschenden Kräfte zeigen konnten. Die Objekte taten Wunder, indem sie das Unsichtbare und Unfaßbare jeder Wirkkraft veranschaulichten und vor allem nutzbar und anwendbar machten. Deshalb bilden in allen Kunst- und Wunderkammern die ersten mechanischen Werke und Automaten den stolzen Mittelpunkt: »Die herrlichschen kunststückh«, zum Beispiel als Kästchen mit mechanisch hervorschnellenden Schlangen, zeigten nämlich am deutlichsten, daß es Menschen gelingen kann, jene die Welt treibenden Kräfte unter Kontrolle zu bringen, ja, im ganz unmittelbaren Sinne zu manipulieren, das heißt mit Händen greifbar und formbar zu machen. Sapientia, also Weisheit haben Menschen der damaligen Auffassung zufolge, wenn sie Objekte zu sammeln und zu schaffen verstehen, die den kosmischen Kräften Gelegenheit bieten, ihre Funktion und Wirkung zu zeigen. Die Wunderkammern waren ein theatrum solcher sapientia.
Das setzt die Fähigkeit voraus, etwas als ein bemerkenswertes Objekt überhaupt erst aus der Unzahl der Dinge herauszulösen: Daß die Unzahl der Dinge als Ganzes, als der Bestand der Welt eine Bedeutung hatte, ist allen Menschen immer schon einsichtig, und dieses Wissen beherrschte vor allem das Denken im europäischen Mittelalter. Die Frage aber, wie man ein Objekt ausgrenzt, wie man seinen materialen Bestand und seinen Bedeutungsumfang als den eines Einzelobjekts überhaupt sichern kann, diese Frage steht am Beginn der neueren Wissenschaften, der deswegen auch vom Aufbau der ersten »Kunstkammern« begleitet wird. Die Frage nach dem Einzelobjekt wird heute mehr denn je wieder gestellt, wenn Künstler als »Spurensicherer«, als »objets trouvés«, Arrangeure, Entdecker der Alltagswelt tätig werden. Sie trainieren sich und uns darauf, etwas bisher kaum Bemerktes zum Objekt unserer Wahrnehmung und Erinnerung, des Denkens und Fühlens werden zu lassen. Denn zu sehr sind wir aus unseren Gewohnheiten heraus versucht, das Objekt in den Konstruktionen globaler Aussagen, Systemzusammenhängen und Wirkungsmechanismen verschwinden zu lassen, weshalb wir dann des öfteren nicht mehr wissen, wovon wir reden, wenn wir »Mechanismen der Wahrnehmung« und »systemimmanente Gesetzmäßigkeiten« konstatieren.
Schon alte Philosophenweisheit legt uns nahe, zunächst wieder das Staunen (Wundern) zu lernen, was nichts anderes meint als dazu fähig zu sein, etwas für allzubekannt Gehaltenes oder für unbedeutend Gehaltenes mit anderen Augen anzusehen und zu begreifen, also zu manipulieren. Und so dürfte denn auch ein wesentlicher Effekt der Spoerrischen Wunderkammer zu Köln der sein, den Besucher mit Staunen darüber zu erfüllen, was alles und in welcher Weise es zum Objekt unseres Begreifens der Welt werden kann.
2 Die vielen Hoden der Wahrheit!
Es gilt also erneut, aus einem mittelalterlichen Denken herauszufinden; denn von Wahrnehmungsmechanismen und Systemimmanenzen oder von ›der Geschichte‹ auszugehen und die realen Objekte unter sie zu subsummieren, wie das heute beliebte, gar als Wissenschaft verkaufte Praxis ist, setzt an die Stelle einer vollen Welt bloß leere Namen. Aus leeren Namen aber läßt sich in Wahrheit nichts ableiten oder deduzieren. Wissenschaft wie Alltagswissen gibt es immer nur da, wo anstelle solcher Deduktion das gegenläufige Verfahren der Induktion gesetzt wird, das heißt, wo man vom einzelnen, vereinzelten Objekt ausgeht. Die Spoerrische Wunderkammer wird also dann gelungen sein, wenn sie die Objekte als Ausgangspunkte und Anlässe der Wahrnehmung und des Reagierens, des Denkens und Sprechens darzustellen und zu bestimmen vermag.
Wie schwer das zu erreichen, aber immer wieder zu versuchen nötig ist, selbst oder gerade für kenntnisreiche Wissenschaftler, das zeigt jüngst ein Aufsehen erregender Vorgang: Alle Kunsthistoriker und Archäologen glaubten zu wissen, was sie sahen, wenn sie eine der vielen Statuen der Diana von Ephesus betrachteten. Es schien ganz selbstverständlich zu sein, daß man es mit einem Kultbild einer Göttin zu tun hatte, deren Erscheinung als vielbrüstige Frau einen Hinweis auf den Kult zuließe – wie auch der im einzelnen angenommen wurde, immer stand er in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erscheinung der Vielbrüstigkeit. Jeder Betrachter der Statuen konnte ja unmißverständlich und unbezweifelbar die vielen Brüste der Göttin sehen, noch heute sehen. Alle vorherigen Betrachter hatten die Brüste gesehen, und jeder neue Betrachter hatte von diesen Brüsten gehört und identifizierte nun seinerseits auch die vielen busenartigen Auswölbungen am Oberkörper der Göttin als Brüste.
Zum ersten Mal seit Jahrhunderten aber sah ein Mann aus Basel diese so eindeutigen Gebilde mit eigenen Augen, mit anderen Augen, weil ihm einfach aufgefallen war, daß Frauenbrüste normalerweise auch Brustwarzen haben. Die aber waren beim besten Willen nicht auf den ›Brüsten‹ der Diana von Ephesus zu entdecken, und zwar auf keiner der auf uns gekommenen Statuen der Göttin. Für ihn war es danach sicher, daß er die Dinger als etwas anderes zu bestimmen hatte, als wofür sie Tausende seiner Kollegen hielten.
Und das gelang ihm auch: Er konnte nach mühevollen Rekonstruktionsversuchen die Vermutung gut begründen, daß es sich bei den angeblichen Brüsten um am Kultbild befestigte Stierhodensäcke handelt.
»Und das soll eine große Leistung sein«, verlautbarte es danach; »hängen nicht heute noch z. B. im Café am großen Markt zu Brüssel Gegenstände des flandrischen Volksbrauchs, beim dörflichen Gemeinschaftsschlachtfest an einem großen Korb die getrockneten Blasen und Hoden der geschlachteten Tiere aufzuhängen? Das kann doch jeder sehen, das ist doch ganz selbstverständlich.«
Die so sich verlautbarten bekunden nur, daß sie von dem Vorgehen der Wissenschaft keine Ahnung haben, und mit Sicherheit werden sie immer erneut Opfer ihrer Objektblindheit. Selbstverständlich ist nämlich vor allem das nicht, was wir nach Augenschein und bestem Wissen für selbstverständlich halten, weil wir es eben deshalb gar nicht mehr wahrnehmen können.
Daß auch ein ausgefuchster Augenmensch wie Harald Szeemann partiell objektblind ist (wie wir alle), zeigt die Tatsache, daß er seiner Objektsicherungsausstellung ›Monte Verita‹ ausgerechnet die vielbrüstige Diana von Ephesus zur Patin gab!
›Die vielen Brüste der Wahrheit‹ sind nun zu den vielen Hoden der Wahrheit geworden, und das muß dann wohl heißen, daß die Wahrheit eben erst in die Welt gebracht werden muß, nicht aber aus ihrem Bestand bloß abgesaugt zu werden braucht, wie eben die Milch aus den Brüsten.
3 Dem Objekt auf der Spur: Amulett, Reliquie, Relikt, Fetisch
Was macht ein irgendwie gegebenes Ding zu einem Objekt? Die Antwort ist einfach und deutlich: Ein Ding wird zu einem Objekt unserer Wahrnehmung, Betrachtung und Reflexion, wenn mit ihm eine ›Geschichte‹ verbunden ist, oder aber wenn wir mit dem Ding eine ›Geschichte‹ verbinden können oder eine Erzählung oder ein Wissen. Dergleichen ›Geschichten‹ können aus der materialen Gestalt des Dinges abgeleitet sein, zum Beispiel als Gebrauchsanweisungen, die schon in der materialen Gestalt des Dinges angelegt sein können. Dann sprechen wir von dem Objekt als einem Instrument, wie der Schere, der Pille, der Zange, dem Zahnarztbohrer. Auch ein Pißbecken zum Beispiel ist ein solches Instrument, wenn auch sein Instrumentalcharakter nicht so eindeutig zu sein scheint wie der eines Messers, das kaum jemand als ein Objekt, sondern eben als ein Instrument bezeichnet. Das Pißbecken aber ist ja entstanden (und das ist zugleich die Geschichte, die man als zu ihm gehörig versteht), um als Instrument des Sammelns und Ableitens von Urin zu dienen; wir benutzen es als Instrument nur in indirekter Weise, wie wenn wir ein Messer handhaben. Dennoch kann das Instrument Pißbecken auch wieder von seinem eindeutigen Instrumentalcharakter befreit werden, um eine andere Geschichte zu haben; um als ein anderes Objekt gesehen zu werden, als es bisher notwendigerweise zu sein schien. Marcel Duchamp gab dem Ding Pißbecken seinen Objektcharakter wieder zurück, indem er es in eine Kunstausstellung steckte, wie sattsam bekannt Sein dürfte. Er hängte dem Porzellanding eine andere Geschichte an und machte es dadurch zu einem neuen Objekt unserer Wahrnehmung; und zwar zu einem leistungsfähigen Objekt, denn noch heute haben viele Betrachter dieses Duchampschen Kunstobjekts Schwierigkeiten, gegen ihre Seh- und Gebrauchsgewohnheiten das Pißbecken als Objekt einer Ausstellung und nicht als Instrument zu sehen.
Jedes Objekt aber kann andererseits auch wieder als Instrument verstanden werden, auch wenn dessen materiale Gestalt keinerlei Rückschlüsse auf die instrumentelle Nutzung nahezulegen scheint. Die ins Medaillon gefaßten Haare der Geliebten sind als Objekt der Wahrnehmung und Reflexion für denjenigen, um dessen Geliebte es sich handelt, vor allem ein Instrument der Beschwörung leiblicher Präsenz der Geliebten. Er benutzt die Haare als Amulett oder Talisman. Wer aber ein solches Medaillon mit Haaren einer Frau, die er gar nicht kannte, verwendet, um es als Instrument der Beschwörung leiblicher Präsenz einer reizvollen Frau mit unbestimmtem Gesicht zu verwenden, der macht aus dem Instrument einen Fetisch, nämlich ein Ding, dessen Kräfte weder durch seine materielle Gestalt und Beschaffenheit noch durch die zu ihm gehörende Geschichte wirken sollen. Und wenn die Schergen eines KZ ihre Opfer vor der Ermordung kahlscheren, um die Haare in Spinnereien verarbeiten zu lassen, dann sind diese Haare Material. Wenn wir solchen Haaren in einem KZ heute begegnen, werden sie von einigen Menschen als bloße Relikte, von vielen aber als Zeugnisse eines Verfahrens betrachtet, daß Menschen zu beliebigen Objekten anderer Menschen macht. Zur Reliquie würden die Haare der KZ-Opfer, wenn eine Gemeinschaft von Menschen, etwa eine Glaubensgemeinschaft, sie als kostbares Zeugnis des Lebens von Menschen betrachtete, auf deren Beispiel für das Bestehen des Lebens sich alle Mitglieder der Gemeinschaft verpflichtet haben. Die Verehrung dieser Reliquie bedeutete dann eine immer erneute Selbstverpflichtung der Gemeinschaftsmitglieder auf ihren Glauben.
4 Was leistet das Objekt?
Viele ›aufgeklärte‹ Zeitgenossen geben sich den Anschein, als seien sie erhaben über einen derartigen Gebrauch von Objekten als Amulette, Reliquien und Fetische. Aber schon Julius von Schlosser warnt davor, »voreilig (derartigen Objektgebrauch) zu verurteilen; denn selbst ein Genius gleich Shakespeare konnte nicht gänzlich solcher Dinge entraten, die wir als Geschmacksverirrungen der Zeit zu bezeichnen gewohnt sind«. Ins Heutige übertragen ist die Schlossersche Feststellung etwa so zu treffen: Sind wir sehr sicher, in welchem Sinne wir etwa: Gummistreifen unterm Auto nutzen, wenn uns doch jeder Techniker sagen kann, daß sie nicht vor Radarkontrollen schützen; oder den ersten Schuh des Kindes, den wir an den Innenspiegel des Autos hängen; oder die Familienfotos, die wir auf dem Schreibtisch im Büro plazieren; oder die Karpfenschuppe, die wir im Portemonnaie tragen; oder den Miniatureiffelturm, den wir als Souvenir kaufen; oder die Gemälde, die wir als Kunstwerke an die Wand hängen? Wissen wir so genau, was diese Objekte für uns leisten, daß wir kategorisch auszuschließen vermöchten, sie seien nicht auch Reliquien und Fetische?
Kategorisch läßt sich nur eines sagen: In allen Kulturen zu allen Zeiten waren und sind Menschen gezwungen, die Beziehungen zu anderen und zu sich selbst auf den Ebenen des Denkens, Wahrnehmens, Fühlens und Sprechens stets über Objekte der Außenwelt zu vermitteln. Für Menschen besteht prinzipiell ein Vergegenständlichungszwang: Das heißt, Denken, Fühlen, Verarbeitung von Wahrnehmungen und jede Form von Kommunikation sind nur möglich, wenn in der Welt der Objekte materiale Äquivalente gefunden oder geschaffen werden können für das, was man denkt, fühlt oder kommuniziert. Selbst das abstrakte Denken ist auf solche Formen der Anschaubarkeit angewiesen, wie uns die Wahrnehmungspsychologen bewiesen haben. Auch Einstein mußte wenigstens Formeln auf die Tafel schreiben, auch Adorno mußte schreiben und sprechen, wenn er Kritik an der Verdinglichung des Bewußtseins übte – also wenn er gegen bestimmte Formen der Vergegenständlichung von Denken und Fühlen wetterte; bösartige Schadenfreude ist darüber unangebracht, daß ausgerechnet sein Begriff von der Verdinglichung des Bewußtseins zu einem reinen Verbalfetisch geworden ist.
Worauf es ankommt, weiß eigentlich jeder Alltagsmensch, soweit er mal verliebt war, »Sag, daß Du mich liebst«, hörte er – wie jeder geliebte Mensch. Und ganz selbstverständlich sagte er: »Ich liebe Dich«, um sogleich tief zu erschrecken, als darauf die Antwort kam: »Das sind ja nur Worte, nichts als Worte; Du sollst mir richtig zeigen, daß du mich liebst.« Und dann versuchte man es zu zeigen, indem man freundlich umarmte, gemeinsam ins Restaurant und auf Reisen ging, Geschenke kaufte, Liebesbriefe schrieb oder auch Gedichte usw. Aber stets kam wieder das verletzende Maulen von dem/der Geliebten: »Gedichte, Briefe, Geschenke, was ist das schon, lauter totes Zeug; das sollst Du mir nicht zeigen, sondern zeigen, daß Du mich liebst. Du treibst ja nur Verdinglichung der Liebe in Gut und Geld!« (Sie waren beide Adornoschüler.) Nun ja, wenn sie heute noch zusammen sind, dann haben sie begriffen, daß natürlich die Worte und Dinge nicht die Liebe sind, aber daß man ohne Worte und Dinge und dergleichen überhaupt nicht in der Lage ist, als Liebender zu denken, zu fühlen oder sich irgendwie zu äußern. Für Menschen auf Erden herrscht eben Vergegenständlichungszwang, und zwar nicht nur in der Liebe, sondern allenthalben. Und das macht die Objekte für Menschen so bedeutungsvoll, verschafft ihnen Wirkung auf Menschen! (Vgl. hierzu ›Wie entsteht Bedeutung‹, S. 147-164.)
5 Die Prinzessin auf der Erbse
Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten; es sollte aber eine richtige und wirkliche Prinzessin sein! Er bereiste nun die ganze Welt, um eine wirkliche Prinzessin zu finden, aber das war viel, viel schwerer, als er sich das gedacht hatte, Prinzessinnen gab es genug, aber ob sie auch wirkliche Prinzessinnen und nicht nur solche dem Namen nach waren, konnte er nirgends herausfinden. Bald fehlte dies, bald das! Kurzum, der Prinz kam immer wieder betrübt nach Hause und hatte noch keine wirkliche Prinzessin gefunden.
Eines Abends gab es ein schreckliches Gewitter; es blitzte und donnerte ganz gewaltig und der Regen strömte hernieder. Da klopfte es ans Stadttor, und der alte König ging selbst hin, um zu öffnen. Draußen vor dem Tor stand eine Prinzessin und wollte eintreten. Aber, mein Gott, wie sah sie aus! Das Wasser rann ihr aus den Haaren und Kleidern, lief vorn in die Schuhe hinein und rückwärts bei den Absätzen wieder heraus; das Unwetter hatte ihr böse mitgespielt. Und obwohl es kaum glaublich erschien, behauptete sie doch, eine Prinzessin zu sein.
Das wollen wir gleich haben, dachte die alte Königin! Sie sagte aber nichts, ging ins Schlafzimmer, nahm alle Polster und Matratzen aus dem Bett und legte eine Erbse, nicht mehr und nicht weniger als eine einzige runde Erbse auf das mittlere Bettbrettchen. Darauf bettete sie dann zwanzig Matratzen und darüber noch zwanzig mollige Eiderdaunendecken; darin sollte nun die Prinzessin des Nachts liegen.
Am Morgen wurde sie gleich gefragt, wie sie geschlafen habe. »Ach, doch ganz entsetzlich schlecht«, sagte die Prinzessin. »Ich habe fast kein Auge zugetan. Es muß etwas in meinem Bett gewesen sein, weiß Gott, was das war. Ich bin ganz braun und blau, so hart bin ich gelegen, es war einfach entsetzlich!« Und daran konnte man erkennen, daß sie eine wirkliche Prinzessin war, die durch zwanzig Matratzen und zwanzig Eiderdaunendecken die einzige, kleine, runde Erbse gefühlt hatte. So feinfühlig konnte nur eine wirkliche Prinzessin sein. Der Prinz nahm sie daher zur Frau und wußte nun ganz bestimmt, daß er eine wirkliche Prinzessin bekommen hatte.
Die Erbse aber kam ins Stadtmuseum, wo sie noch heute zu sehen ist, sobald man annimmt, daß die ganze Geschichte überhaupt wahr ist.
Christian Andersen (deutsch von Helene Ehmann).
Also: Die Erbse ist im Stadtmuseum zu sehen, da die ganze Geschichte als Erzählung in jedem Fall wahr ist. Ob die in ihr berichteten Ereignisse tatsächlich stattgefunden haben, ist eine nebensächliche Frage; denn ein Objekt kommt in ein öffentliches oder privates Museum, wenn es eine ›bedeutende‹ Geschichte hat, und die ist mit der Erzählung gegeben. Im Museum aber liegt die Erbse nicht allein, es sind viele andere Objekte dort, weil zu jedem eine Geschichte erzählt werden kann. Wer nun die vielen einzelnen Erzählungen zu den einzelnen Objekten in einen Zusammenhang zu bringen vermag, wer sie zu einer Erzählung verknüpfen kann, der hat entweder ein kultur- oder kunst- oder naturgeschichtliches Museum geschaffen, je nachdem, welche interessanten Aspekte er gleichermaßen den einzelnen Erzählungen für seine große Erzählung entnehmen kann.
Wie alle Erzählungen müssen auch die größten Erzählungen, die wir Kunstgeschichten oder Kulturgeschichten oder Naturgeschichten nennen, eine Struktur haben, zum Beispiel einen Anfang und ein Ende, zwischen denen der Erzähler nacheinander auf die verschiedenen Objekte der einzelnen Erzählungen zu sprechen kommen muß; das heißt, der Erzähler muß sich entscheiden, welche Ordnung er seiner großen Erzählung geben will. Läßt er dem schrittweisen Voranschreiten in der Erzählung etwa das schrittweise Entstehen einer Chronologie entsprechen oder der schrittweisen Veränderung seines Verständnisses von dem, worüber er erzählt? (Immerhin sollte ja letzteres auch ein Zweck der Erzählung sein.) Welche Struktur und Ordnung er auch für seine Erzählung wählt, immer müssen sie zwei Leistungen ermöglichen: nämlich die Objekte der Einzelerzählungen zugleich in gewissen Hinsichten unterscheidbar und in anderen gleich zu machen.
Die Erbse im Stadtmuseum ist in Hinsicht auf die Wirkung, die sie Andersens Märchen zufolge gehabt hat, gleichzusetzen mit vielen anderen, ähnlichen Objekten, die sich womöglich auch im Stadtmuseum befinden; denn viele durchaus verschiedene Dinge können die gleiche Funktion erfüllen und die gleiche Wirkung haben. So hätten ja gewiß ein kleiner Kiesel oder Knopf unter den Matratzen dieselbe Aufgabe wie die Erbse erfüllt. Andererseits muß glaubwürdig, das heißt plausibel dargelegt (gar ›bewiesen‹) werden, daß es sich bei der Erbse im Stadtmuseum um genau diejenige handelt, anhand der damals die Prinzessinnenprobe im Schloß vorgenommen wurde: Es war diese Erbse und keine andere, obwohl fürs gemeine Hinschauen eine Erbse von einer anderen Erbse kaum unterscheidbar ist.
Warum aber bestehen wir alle so nachdrücklich auf der Klärung der Frage, ob nun diese oder vielleicht jene Erbse oder gar eine bisher unbekannte diejenige ist, welche? Nach dem bisher über die Leistungen der Objekte Gesagten könnte es uns doch ziemlich egal sein, ob eine Reliquie falsch oder echt ist: Hämische Einwände gegen den Milchzahn der heiligen Jungfrau aus der Sammlung des Duc de Berry um 1400 oder die Knochen der Gefährtinnen der heiligen Ursula wären eigentlich unangebracht, wenn nicht immer wieder die Besitzer solcher Reliquien ernsthaft behaupten würden, diese und keine anderen Knochen seien die der ermordeten Märtyrerinnen. Andererseits, dürfen die Reliquienbesitzer das nicht behaupten? Kann denn irgendwer den Gegenbeweis antreten? Ich habe einmal miterlebt, wie eine Runde von Kunsthistorikern von einem Kollegen zur Verzweiflung gebracht wurde durch dessen beständiges Bezweifeln der Echtheit eines Sitzmöbels aus dem 18. Jahrhundert:
Die Dokumente könnten gefälscht, das Möbel von einem Meister ersten Ranges imitiert worden sein etc.
Wie gut solche Fälschungen gelingen, zeigten ja viele Beispiele; auch die größten Experten seien vor Täuschung nicht sicher. Ja, eigentlich müsse man prinzipiell immer davon ausgehen, es mit einem gefälschten Stück zu tun zu haben oder aber ganz auf diese Unterscheidung verzichten; denn wenn jemand in der Lage ist, zum Beispiel einen Vermeer van Delft so gut zu fälschen, daß selbst Vermeer-Spezialisten sie nicht von Originalen unterscheiden könnten, wieso sollte man sie dann nicht als Vermeer-Arbeiten akzeptieren; sollte man denn nicht den Fälscher, der so gut arbeitet, für einen womöglich größeren Meister halten als den originalen Vermeer? Handele es sich um eine völlig freie Schöpfung im Sinne und Stile Vermeers, die so gelungen ist, daß selbst Spezialisten sie nicht von einem ›gesicherten‹ Vermeer unterscheiden können, was sollte dann ein echtes Werk noch anderes leisten als die Fälschung? Haftet dem Original als Objekt irgendetwas an, worüber selbst die beste Fälschung nicht verfüge? Was aber könne denn das sein, wenn es doch niemand mit Augen zu sehen, mit Händen zu greifen oder sonstwie zu erfahren vermöge?
Und umgekehrt heißt das eigentlich, daß ein Objekt, dessen Echtheit keiner bestreitet, plötzlich als etwas ganz anderes entdeckt wird, als wofür es bisher gehalten wurde? ›Die Brüste der Diana von Ephesus‹ sind tatsächlich als Hoden zu verstehen; die Knochen der Ursulagefährtinnen sind die noch viel älteren Überreste römischer Legionäre. Auch von dieser Seite betrachtet ist die Unterscheidung zwischen Original und Fälschung eigentlich höchst problematisch; wissen wir nicht, wie schwierig es sein kann, Quellen zu lesen, also zu verstehen, denn jeden Tag erleben wir es doch, daß schon unser Nächster einen Zeitungsartikel ganz anders liest und versteht als wir selbst, obwohl wir beide dieselbe Sprache sprechen, dem gleichen kulturellen Selbstverständnis verpflichtet sind, die gleichen Gewohnheiten haben etc. Was heißt es dann erst, eine historische Quelle zu verstehen, selbst wenn man deren Echtheit nicht bestreitet?
Kommen diese Schwierigkeiten nur dadurch zustande, daß wir in unzulässiger Weise unsere Alltagserfahrungen verallgemeinern? Jeder weiß, daß es durchaus einen Unterschied gibt zwischen ›echten‹ Schmerzpillen und bloß so aussehenden. Wenn uns aber ein glaubwürdiger Herr Doktor eine bloß so aussehende Schmerzpille als eine echte verabreicht, dann kann es durchaus sein, daß die Schmerzen trotzdem nachlassen. Viele Warenproduzenten verkaufen ihre ›originalen‹ Produkte mit der beigefügten Erklärung, die Waren seien nur echt, wenn sie zum Beispiel einen roten Streifen auf der Verpackung aufweisen; als ob der nun nicht am ehesten noch von einem bloßen Nachahmer gefälscht werden könnte. Sieht man, fühlt man, schmeckt man denn der Ware selbst nicht an, ob sie echt oder nachgeahmt ist? Warum aber sollte man dann noch zwischen den echten und den nachgeahmten unterscheiden? Wegen der geheimen Zusammensetzung der Einzelkomponenten? Wenn das Resultat aber das gleiche ist wie bei einer anderen Zusammensetzung?
Wie hängen denn funktionale Gleichheit vieler verschiedener Objekte und faktische Unvergleichlichkeit der bis zum Verwechseln ähnlichen Objekte zusammen? Viele verschiedene Dinge haben die gleiche Funktion oder Wirkung, und dennoch bestehen wir darauf, unbedingt etwas ganz ›Unvergleichliches‹ von dem ihm noch so Ähnlichen zu unterscheiden!
Das liegt wohl daran, daß wir nicht sicher sind, ob die Wirkung eines Objekts tatsächlich aus ihm selber hervorgeht, oder ob nicht vielmehr erst im bestimmten Handhaben des Objekts dessen Wirkung entsteht. Nur geschluckte Schmerztabletten wirken – wie schluckt man einen Vermeer, wie schluckt man eine Reliquie?
Das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse sagt deutlich, was für uns in dieser Frage der springende Punkt zu sein scheint. Nur eine wirkliche Prinzessin hat die besonderen Fähigkeiten, die Wirkungen der Erbse noch durch vierzig Auflagen hindurch zu spüren. Nur wenige Menschen scheinen die besonderen Fähigkeiten zu haben, auf ein bestimmtes Objekt zu reagieren. Wer sich selbst solche Fähigkeiten nicht zutraut, ist geneigt, die Wirkungskräfte direkt als eine Eigenschaft der Objekte anzusehen. Keiner möchte gern auf die Vorteile verzichten, die andere womöglich aus dem richtigen Gebrauch von Objekten ziehen. Dieser Verzicht wäre aber definitiv notwendig, wenn man selber nicht in der Lage ist, ähnlichen Gebrauch von den Dingen zu machen. Also erklärt man die anderen zu Dummköpfen, die auf etwas reingefallen seien, was in Wirklichkeit gar nichts sei; oder man hält sie für Schwindler, die nur so tun, als ob und die darauf hoffen, daß andere es nicht merken.
Gegenüber den in ihrer Wirkung schwierig kalkulierbaren Objekten wie Kunstwerken oder Heiligenknochen oder Napoleonhaaren im Medaillon ist eine solche Haltung offensichtlich besonders notwendig. Einzelne oder eine Gruppe von Menschen demonstrieren zum Beispiel die Wirkung eines Werkes von Beuys: Das Werk wirke auf sie. Viele andere Kunstinteressierte aber stellen an sich keine Wirkung des Beuyswerkes fest. Wegen der Art des Umgangs, den aber einige mit dem Werk offensichtlich zu ihrem sozialen und individuellen Nutzen pflegen, bleibt das Werk für die Unbeeindruckten etwas Unheimliches, das schwer zu ertragen ist. Um dem zu entgehen, sagen sie, dem Beuyswerk käme Wirkungskraft als objektive Eigenschaft gar nicht zu, da die für sie ja nicht spürbar ist; wenn aber das Werk diese Eigenschaft hätte, müßte sie ja auch ihnen zugänglich sein. Wer dennoch behaupte, das Werk habe Wirkung, ist demzufolge ein Dummkopf oder Schwindler.
Ist das so? Und inwiefern? Tausende rauchen bis ins hohe Alter, paffen auf Deubel komm raus, ohne an Lungenkrebs zu erkranken. Andererseits soll aber Tabakrauch, wenn inhaliert, die Wirkfolge ›Lungenkrebs‹ ganz unbestreitbar haben. Aber nicht nur die, sondern auch die Wirkung, Nerven zu beruhigen oder anzuregen, die Verdauung zu fördern etc. Ist das auch alles Schwindel, weil Tabakgenuß auf den einen so, auf jenen anders und auf einen Dritten überhaupt nicht wirkt? Sagt die Wirkeigenschaft des Tabaks tatsächlich und eindeutig etwas über seine Wirkung aus?
Leuten, die so ›argumentieren‹, ist schwer beizukommen; selbst ein Hinweis auf die Schwierigkeiten, die Naturwissenschaftler mit dem Nachweis der Wirksamkeit eines Medikaments haben, ist für sie wenig überzeugend. Wenn eine Gruppe von Wissenschaftlern behauptet, ein bestimmtes Medikament wirke, eine andere Gruppe aber das Gegenteil behauptet, dann könne eben nur eine von beiden Gruppen recht haben.
Auf den eigentlich naheliegenden Gedanken, danach zu fragen, was man denn unter ›Wirkung‹ zu verstehen habe, kommen solche Leute nicht. Ein Objekt, wie es auch immer materialiter beschaffen und gestaltet sein mag, wirkt auf jemanden, wenn dessen Reaktion, Verhalten, Wahrnehmen, Denken, Fühlen oder Kommunizieren durch den Umgang mit dem Objekt sich merklich verändern. Das gilt für den Umgang mit ›echten‹ Medikamenten wie mit ›Placebos‹; gilt für den Umgang mit Kunstwerken, ob original oder gefälscht; gilt für den Umgang mit Reliquien, seien sie nun gesicherte Relikte oder bloß dafür gehaltene. Die Tatsache der Wirksamkeit aber ist allein gar nicht der problematische Aspekt; vielmehr die Art der Wirkung, die sich in der Veränderung von jemandes Wahrnehmen, Reagieren etc. äußert. Daß Reliquien wirken, ob echte oder gefälschte oder irrtümlich, aber guten Glaubens dafür gehaltene, ist gar nicht zu bestreiten: Denn eine Unzahl von Menschen läßt sich immer wieder durch die Reliquien zu Handlungen veranlassen, die ohne die Reliquien so nicht zustande kämen. Was den Kritikern solchen Reagierens nicht paßt, ist doch die Art, wie Reliquienverehrer im Umgang mit etwas totem Zeug ihren Glauben vergegenständlichen. Was soll aber erreicht sein, wenn man statt Reliquien tote Buchstaben auf Papier verehrt, weil sie den Beweis dafür darstellen, daß die Reliquienverehrung ein fauler Zauber sei?
Wir müssen also akzeptieren, daß letztlich die ›Wirkungen‹ eines Objekts immer von den persönlichen Dispositionen dessen abhängen, der mit den Objekten umgeht. Das gilt für die Wirkung von Medikamenten, deren Wirksamkeit angeblich eindeutig beweisbar sein soll, genauso wie für die Wirkung von Reliquien, Amuletts oder Gemälden.
Und wir müssen akzeptieren, daß wir nicht die Objekte, sondern den Objektgebrauch zum Kriterium der Unterscheidung zwischen ›wirklichen und bloß sogenannten Prinzessinnen‹, Reliquienverehrern oder Beuysbegeisterten machen können.
6 Die Erbse im Stadtmuseum
Zwar sagt Andersens Märchen nichts darüber, aber es ist zu vermuten, daß der Prinz die Erbse erst testamentarisch dem Stadtmuseum überließ. Denn schwerlich dürfte er darauf verzichtet haben, mit seiner Frau (der wirklichen Prinzessin) immer mal wieder die Erbse zu betrachten, um sich durch den Anblick zu Gedanken über das Unterscheiden von wahr und falsch, echt und unecht zu veranlassen. Zugleich dürfte sich die Erbse als sehr hilfreich bei dem Versuch erwiesen haben, wichtige Stationen des gemeinsamen Lebens in Erinnerung zu rufen. Das wäre auch ohne die konkrete Erbse in gewissem Umfang möglich; aber erst, wenn der Prinz die Erbse in Händen hielt, kam ihm merkwürdig deutlich Wieder die ganze Situation von damals in die Erinnerung zurück: das Unwetter über dem Schlosse, seine Hoffnungslosigkeit, der Geruch der nassen Kleider, das rätselhafte Verhalten seiner Mutter, die Spannung vor der Auflösung des Rätsels am nächsten Morgen.
Wahrscheinlich hatte der Prinz noch viele andere Objekte wie die Erbse in einem kleinen Saal des Schlosses versammelt; solche, die schon seit ewigen Zeiten irgendwo im Schloß herumstanden oder die er seit seiner Kindheit um sich hatte, und solche, die er auf seinen Reisen kaufte. Oft hatte er schon überlegt, ob er nicht den ganzen Plunder einfach wegwerfen sollte, aber man hatte ihm schon früh beigebracht, es sei prinzliche Pflicht, nichts wegzuwerfen, solange es eine ›Geschichte‹ habe.
Wie die Sammlung des Prinzen tatsächlich ausgesehen hat, hängt davon ab, wann er lebte. Wäre die Erbse gleich nach dem Tode des Prinzen ins Stadtmuseum gekommen, so könnte als sicher gelten, daß er im 19.Jahrhundert gelebt haben muß. Denn in den Zeiten davor gab es keine Stadtmuseen. Wäre die Erbse erst lange Zeit nach des Prinzen Tod ins Stadtmuseum gekommen, etwa weil man im 19. Jahrhundert fürstliche Sammlungen als Museen dem breiteren Publikum öffnete, dann gäbe es verschiedene Möglichkeiten, auf die Lebenszeit des Prinzen zurückzuschließen.
Nehmen wir an, er habe in einer mittelalterlichen Stadt gelebt. Die ganze Stadt hätte dann schnell von dem Erbsereignis gehört, auch der Herr Bischof; und er hätte sich die Erbse erbeten, um sie im Kathedralenportal allem Volk sichtbar anbringen zu lassen, neben Dinosaurierknochen und der Schatztruhe des Cid, die heute noch als Besitz der Kathedralen von Wien und Burgos dortselbst zu besichtigen sind (neben vielen anderen Denkwürdigkeiten der damaligen Städte, denn die Funktion eines ›Museums‹ erfüllten im Mittelalter allein die Kirchen).
Alles Kirchenvolk hätte dann angesichts der Erbse im Kirchenportal gewußt, daß es keinen Sinn habe, etwas sein zu wollen, was man nicht ist oder nicht sein darf; denn ein ›klain dinkh, so got gab‹, bringt schließlich die Wahrheit ans Licht. In diesem Sinne hätte dann die Erbse, immer mal wieder heimlich durch eine frisch getrocknete ersetzt, bis 1806 am Portal der Kirche gehangen; dann ließ Napoleon sie rauben, um sie mit beziehungsreichen Ausrufungszeichen seiner verflossenen Josefine zu senden. Wütend hat die dann die Erbse einem gerade anwesenden Liebhaber vor die Füße geworfen, der sie …
Aber nein, so kann es nicht gewesen sein, denn hätte die Erbse am Kathedralenportal im obigen Sinne gehangen, dann würde sich die Kirche in der Zeit der Inquisition bestimmt der Erbsprobe und nicht der viel aufwendigeren Feuer- bzw. Wasserproben bedient haben. Oder hatten die Inquisitoren bloß vergessen, daß tatsächlich die Erbse, vielmehr die Erbsen als Objekte der Unterscheidung zwischen wahren Gläubigen und den bloß dem Anschein nach Gläubigen verwendet wurden? Wenn die Kirchen große Wallfahrtsfeste ausriefen und Tausende in die Städte kamen, in deren Kirchen heilige Reliquien aufbewahrt wurden, dann hatten nicht bloß die Verkäufer von Erbsen gewaltige Belebung ihres profanen Geschäfts zu erwarten; für die ganze Stadt waren Wallfahrten Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. Die Erbsen zum Beispiel wurden gekauft, weil die Gläubigen auf ihnen im Kniegang zum Wallfahrtsort sich bewegten; wer diese Tortur aushielt, war seiner wirklichen Glaubenskraft versichert.
Unsere prinzliche Erbse, als Auslöser dieses besonderen Wallfahrtsbrauchs, hätte eigentlich in das Heiligtumbuch der Kathedrale aufgenommen werden müssen; denn die Heiligtumbücher verzeichneten, was der jeweiligen Kirche an Kostbarkeiten gehörte; vor allem, was als verehrenswürdige Reliquien geerbt, gekauft oder zusammengeraubt worden war. Kriegerische Raubzüge zur Aneignung einer besonders wirksamen, das heißt attraktiven Reliquie, waren nicht selten und als Maßnahmen zur Förderung des städtischen Wirtschaftslebens auch verständlich. Noch heute bemüht sich ja jede Stadt um ein attraktives Museum vor allem deshalb, weil Tourismus das Wirtschaftsleben fördert (vielmehr kann man mit diesem Argument Stadtväter zur Investition in ein Museum leichter überreden, als wenn man den kunst-, religions- und kulturgeschichtlichen Wert der Objekte heraushebt).
Leider ist unsere Erbse bisher in keinem Heiligtumbuch des Mittelalters entdeckt worden, trotz langjähriger Forschungsaufträge, die deutsche Stiftungen großzügig und kleinmütig vergeben. Und so sind wir gezwungen, uns vorzustellen, daß unser Prinz etwa in Burgund um 1400 gelebt habe.
Dann wüßten wir ziemlich gut über seine Sammlung Bescheid. Sie hätte so ausgesehen, wie die Sammlung des Duc de Berry, die uns bis auf den heutigen Tag durch die Hinterlassenschaft minuziös ausgearbeiteter Inventarverzeichnisse vor Augen steht. Natürlich konnte unser Prinz sich nicht mit dem Duc de Berry vergleichen, denn der galt zu Recht als der bedeutendste Sammler seiner Zeit in unseren Breiten. Er war der erste wirkliche Sammler der Neuzeit, das heißt, er war besessen von der Aneignungsleidenschaft wie jeder wahre Sammler. Nicht bloße Besitzgier, sondern eben Sammlerleidenschaft zwang ihn beispielsweise dazu, aus Klosterbibliotheken entliehene Bücher seiner Sammlung einzuverleiben, ohne sie käuflich zu erwerben. Vor hohen Geldausgaben schreckte der Duc selten zurück, weshalb fast der gesamte Etat seines Herzogtums zum Anschaffungsetat seiner Sammlung wurde. Was er weder kaufen noch ›leihen‹ konnte, ließ er auf eigene Vorstellungen hin anfertigen, zum Teil von sehr bedeutenden Künstlern wie den Gebrüdern Limburg, die er an seinen Hof zog und natürlich höher schätzte als selbst seine königlichen Verwandten. Wie weit diese Künstler auch Einfluß auf das Konzept der Sammlung hatten, ist schwer auszumachen, weil von einem eigentlichen Konzept kaum die Rede sein kann. Denn auch für den Duc de Berry hieß Sammeln noch ein bloßes Nebeneinander von kostbaren und interessanten Dingen, zu denen der Kelch, aus dem Christus bei der Hochzeit von Kanaa trank, ebenso gehörte wie elfenbeinerne Einhörner und das von den Gebrüdern Limburg aufs Herrlichste gestaltete Stundenbuch. Interessierte den Duc eigentlich, ob die Einhörner tatsächlich von jenen seltenen, sich ungeschlechtlich vermehrenden Fabeltieren früherer paradiesischer Zustände auf Erden stammten, die nur von der reinsten Seele aus ihren Verstecken gelockt werden konnten, und die deshalb nur der Jungfrau Maria zugeordnet waren? Was sich so rein seit dem Anbeginn der Schöpfung erhalten hat, sollte sich ausgezeichnet dafür eignen, irdische Trübungen und Vermischungen der Dinge anzuzeigen: Die Einhörner konnten Gift in Speisen identifizieren; eine höchst nützliche Funktion in Zeiten, in denen der Giftmord oder der Giftunfall an der Tagesordnung waren.
Oder vermutete der Duc bereits, daß es sich bei den Einhörner eigentlich um das Horn von Narwalen handelt, denen man aber genauso selten, nur durch die Erzählungen anderer, begegnen konnte wie den Einhörnern? Genoß er gar seine Fähigkeit, die Dinge ganz anders anzusehen als seine Zeitgenossen? Julius von Schlosser schreibt: »So stark bei Berry sich die echt mittelalterliche Freude am Stoff geltend machte, es sind doch kleine Züge da, die verraten, daß ihm die künstlerische Form als solche wert war.« Auf die Bedeutung der Form und Erscheinung der Objekte hin wäre dann die Sammlung konzipiert gewesen; ein damals einmaliges Konzept. Wenn Schlossers Vermutung zutrifft, ließe sich auch verstehen, warum der Duc de Berry selbst vor offensichtlichen Fälschungen ›antiker‹ Bildwerke nicht zurückschreckte und seiner Sammlung den Verlobungsring des heiligen Joseph einverleibte; sie waren zwar ganz offensichtlich Fälschungen, was aber kaum von Interesse sein konnte, da im wesentlichen die in ihnen manifestierten Formgedanken ihren Wert bestimmten. Einem solchen hohen Anspruch einer Sammlerleidenschaft hätte sich unser Prinz mit der Erbse sicherlich nicht gewachsen gefühlt. Er hätte sich um die Freundschaft des Überlegenen bemüht und sie zweifellos wie andere auch gewonnen, wenn er seine kleine Sammlung von Urinalen aus Glas, Räucherpulvern, Gewürzen, Moschus und Ambra – aufbewahrt in zyprischen Käfigen (vogelförmigen Gefäßen) –, den Milchzahn der heiligen Jungfrau und die Erbse dem Duc de Berry zum Geschenk angeboten hätte. Der Zugang zum Herzog war nämlich für alle an die umstandslose Überlassung von Objekten geknüpft, die der Sammlung des Duc einverleibt werden konnten.
Nun, Milchzahn und Urinal und zyprische Käfige sind tatsächlich in den Inventaren zu finden. Unser Prinz hat sie also dem Duc abgetreten. Auch auf die Erbse gibt es Hinweise; man hielt sie allerdings für einen »seltenen Stein, dessen Oberfläche ganz auffällig ist wie bei einer getrockneten Erbse (petit pois)«!
Jetzt haben wir also eine feste Spur, die leider sogleich wieder auf lange Zeit verlorengeht. Nach dem Tode des Duc wird die Sammlung in alle Winde zerstreut beziehungsweise verkauft. Was eigentlich kein Wunder ist. Denn warum sollten Sammlungen im Laufe der historischen Ereignisse beständiger sein als Reiche, die ja – wie jüngst noch das Deutsche Reich – sehr rasch und unerwartet verloren gehen können? Und Sammlungen sind ja nichts anderes als Reiche aus Dingen gebildet, über die der Sammler herrscht. Erstaunlich ist dennoch, was sich alles an kulturellen Gütern durch Jahrtausende, trotz langer Kriege, Verwüstungen, Erdbeben und Vergeßlichkeiten der Menschen erhalten hat. Mehr oder weniger Bruchstücke, Einzelstücke, hier und da auch ganze Dingwelten, die als Kerne einstiger Sammlungen und Ansammlungen überlebt haben. Aber die Dinge haben nur überlebt, weil es sich immer wieder Menschen, aus welchen Antrieben auch immer, zur Aufgabe machten, eben diese Dinge vor der Furie des Verschwindens zu bewahren. Seit dem 15. Jahrhundert ist dieser Gedanke als Begründung von Sammlertätigkeit hier und da immer mal wieder geäußert worden; er kommt aber als systematische Begründung einer Sammlerpflicht erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts allgemein zur Geltung. Bis dahin bleibt es der Besessenheit einzelner gekrönter oder erleuchteter Häupter überlassen, sich dessen anzunehmen, was aus den verschiedensten Gründen ›kurios‹, das heißt Aufmerksamkeit erregend ist. Auch gekrönte Häupter wie Rudolf II. von Habsburg sind als Sammler eigentlich vereinzelte Privatleute, weil es ihre höchst persönliche Aufmerksamkeit ist, die bestimmt, was sie sammeln und wie sie sammeln. Seine Sammlung auf dem Hradschin in Prag kann als exemplarisch gelten für alle im 16. Jahrhundert aufgebauten – unter denen sich die in München, Dresden und Ambras zu den bedeutendsten entwickelten. Immerhin versuchte man damals schon, eine gewisse Ordnung in die Bestände zu bringen, wenn man auch noch nicht systematisch sammelte: 1598 erscheint das ›Theatrum Sapientiae‹ des Holländers Quickeberg, das mit Bezug auf die Münchner Sammlung eine Museologie zu entwickeln versucht: Handfeste Ratschläge zur Ordnung des Sammlungschaos werden ge- macht und wirken sich auch auf die Innenarchitektur der Sammlungsräume aus. (Bis zum ersten reinen Museumsbauwerk dauert es noch runde 175 Jahre; Justi errichtet es in Kassel.) Der Fortschritt in der Entwicklung des Museumsgedankens, wie ihn die Sammlung Rudolfs II. zeigt, besteht darin, daß man zwar auf engstem Raume nebeneinander, aber doch jeweils zu homogenen Objektbereichen zusammengefaßt die Sammlungsgüter unterbringt.
In Rudolfs II. Sammlung wie in den meisten anderen seiner Zeit gibt`s denn auch alles, was es gibt; aber wie von Geisterhand in Kästen geschieden (das Glöckchen seiner Geister Beschwörung ist noch lange Zeit attraktiver Bestandteil der später nach Wien überführten Sammlung). Mengen, die aus einem einzigen Element bestehen, sind kaum glaubwürdig, weshalb man nun beginnt, möglichst viel Gleiches zu Gleichem zu fügen: ein Bezoar, d. i. Magenstein der Kamele, genügt nicht mehr; es muß jetzt wenigstens ein kleiner Haufen gebildet werden. Desgleichen ›Handsteine‹, von Bergwerkknappen geschenkt; Mechaniken, Astrolabien, Kompasse, Fernrohre, Guckkasten, Automaten; Wunder des Orients und Amerikas wie »Olifante« (geschnitzte Elfenbeinzähne), besagte Eingehürne / Ainkhürne; Kokosnüsse, Kometeneier, Greifenklauen, Krötensteine, Donnersteine, Wurzeln; Mißgeburten Mensch und Tier; Haufen von Samen und Früchten exotischer Pflanzen (blaublühende Erbsen!!) und Werke von Correggio, Raffael, Tizian, Holbein, Dürer; ein Tischchen voll Kleinplastik, vor allem Bronzen des Giambologna; Religiosa wie den ungenähten Rock Christi, die Dornenkrone, den Kamm der heiligen Jungfrau; einen spiritus familiaris in einem Glas, so ehemals von einem Besessenen ausgetrieben und in das Glas gebannt worden: Das alles ist kurios, weil »bewöglich anzusehen« wie die Zapfen aus den Zedern des Libanon, die zum Bau des Tempels Salomons verwendet wurden; ein Stück Holz, das zu Stein geworden, als ein ungläubiger Bauer am Tage eines Heiligen es unter grobem Fluchen zu spalten versuchte; ein Stück vom Judasstrick; ein Hirschgeweih, das, an einem Judenhaus angebracht, an einem Karfreitag Blut geschwitzt hat; eine Serie Nägel von der Arche Noah; miniaturisierte Evangelien auf Pergament von der Größe eines Silberstücks. Genug, wir blasen auf dem Jagdhorn Karls des Großen, das er von Harun al Raschid erhalten und das sich auch in Prag befand, diese Inventartiraden ab. Doch Rudolfs ganz einzigartigen Beitrag müssen wir noch erwähnen: Arcimboldo hat für ihn jene berühmten ›Schnakenköpfe‹ gemalt, die das in Kästchen abgelegte Chaos seiner Kunst- und Wunderkammer programmatisch ausformulieren; Köpfe aus Gemüsen und Kräutern, Wurzeln und Blättern, Tüchern und Brettern gebildet. Die Kuriosität mit Erkenntniswert: Was von weitem sich zur Gestalteinheit zusammenschließt, erweist sich bei näherem Hinsehen als willkürliche Fügung. Für Rudolf und seine Zeitgenossen bekam der Wahnsinn selbst allmählich Methode, auch das wuchernde Chaos erwies sich als eine Ordnung neuer, bisher unbekannter Art.
Offensichtlich haben uns diese Entdeckungen aus den Zeiten der Kunst- und Wunderkammern wieder etwas zu sagen; allen Nutzern des Museumsgedankens, nicht nur Künstlern wie Spoerri. Gründe? Vielleicht ist es die Tatsache, daß heute viele Privatleute endlich verstanden haben, daß man auch seinem eigenen Leben und dessen Spuren so ernstlich nachzugehen hat, wie die Archäologen den Spuren vergangener Kulturen nachgehen. Vielleicht spürt man die Ähnlichkeit der Problemstellungen, die sich für jeden heutigen Privatmann angesichts der um ihn herumliegenden und stehenden Dinge, angesichts der vollen Welt ergeben: die hohen Regalwerke des 16. Jahrhunderts gleichen den hohen Regalwerken unserer Großkaufhäuser; wer braucht das meiste daraus wirklich, man kauft aus Aneignungsleidenschaft. Auch dieser Wahnsinn hat Methode, die des methodischen Verschwindenlassens von etwas, was eben noch da war. Die Mülleimerentleerung als höchster Moment der Befriedigung, den der Tag zu bringen vermag.
Mit der Unzahl der Dinge, die ihre Appelle auf uns loslassen, kann man aber weder fertig werden, indem man sie nach beliebigen Gesichtspunkten ordnet, noch indem man sie ganz ohne Gesichtspunkt zerstört. Am erfolgreichsten scheint es zu sein, die Dinge zu etwas anderem zu machen als sie zu sein beanspruchen beziehungsweise als wofür sie uns verbindlich dargestellt werden.
Der Grad der Verbindlichkeit in den heutigen Spartenmuseen ist zu hoch; nur wenn wir die Gemälde und die Schuhe, die Plastiken und die Margarinehaufen, die Manuskripte und die Schlußsteine, die Vasen und die Straßenpflastersteine, die Anschauung und den Melodieverlauf wieder in einen einheitlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stellen können, den wir selber zu entwickeln vermögen, werden uns die Dinge wieder dazu verhelfen, die Welt als bedeutsam zu verstehen. Chaos ist immer nur da, wo Beliebigkeit herrscht. Aber Beliebigkeit läßt sich nicht durch Festlegungen überwinden, sondern nur durch den Aufbau von Vieldeutigkeit, von Ambivalenz.
Die heutigen Museen haben uns der Ambivalenz der Objekte beraubt; überall herrschen Festlegungen von Kennern. Wer nicht ein solcher Kenner ist, also die vielen Möglichkeiten, sich festzulegen, kennt und damit jede Festlegung zu relativieren versteht, für den verschwindet das Objekt von der Wand. Die ganze Welt ist voller Dinge, aber wir sehen nichts. Alles scheint zum Greifen nahe, aber wir haben nichts in Händen. Zu diesem Tatbestand hat die einseitig übertriebene Entwicklung des Museumsgedankens in den vergangenen zweihundert Jahren erheblich beigetragen.
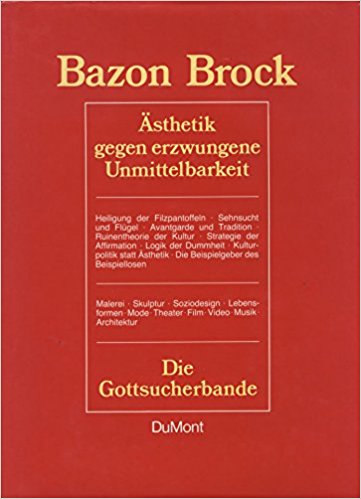 + 1 Bild
+ 1 Bild