In: Kunstforum International, Bd. 37, 1/80
In einer ungefähren und abstrakten Hinsicht bin ich dem Thema sicherlich auf die gleiche Weise konfrontiert worden wie viele andere auch:
- in der Philosophiegeschichte etwa durch Platons Tiraden gegen die bildenden Künste; durch den mittelalterlichen Universalienstreit; durch Kants Feststellungen über die wechselseitigen Bedingtheiten von Anschauung und Begriff; durch das Carnapsche Bildverbot für die Philosophen; durch Wittgensteins Kampf gegen die Verhexung des Verstandes in den Eigentümlichkeiten sprachlichen Vollzugs von Denken,
- im Feuilletonjournalismus durch die Verbreitung der Behauptung, wir lebten im optischen Zeitalter,
- in der Literaturwissenschaft durch die historischen Debatten unter dem Motto »ut pictura poesis« und andererseits die Annahmen, daß die einzelnen Gattungen völlig selbständig seien,
- in der Kunstgeschichte durch die Probleme der Illustration und die der Erschließung von Textquellen für die Rekonstruktion ursprünglicher Aussagenansprüche in »Bildern« des 13. bis 18. Jahrhunderts,
- in der Ästhetik durch die Diskussion um sinnliche Erkenntnis und anschauliches Denken von Baumgarten bis Arnheim mit unmittelbarer Auswirkung auf Probleme der Didaktik,
- in der Psychologie durch Freuds Deutung von Traumbildern,
- und schließlich in der Kunstpraxis durch die Auseinandersetzungen um das Gesamtkunstwerk, die konkrete Poesie und die scheinbare Zunahme der Fälle, in denen Künstler ihre bildsprachlichen Werke mit wortsprachlichen Aussagen begleiteten.
Ich reihe hier diese Bereiche lose aneinander, weil doch daran zu erinnern ist, daß die Text-Bild-Beziehungen immer schon die Aufmerksamkeit vieler Disziplinen fanden.
Ich habe aber die tatsächliche Bedeutung des Problems erst in ganz konkreten Aufgabenstellungen für mich entdecken können: zum einen im Zwang, selber Aussagenkonstruktionen im Kunstbereich anbieten zu müssen, von denen ich nicht sagen konnte, ob sie nun in die bildende Kunst gehörten oder zur Literatur, dem Theater oder zum actionteaching in Wissenschaft, Politik und Schule; zum anderen in der Vermittlungsarbeit, in der ich beständig den Ansprüchen der Künstler konfrontiert war, ihre Arbeiten sprächen für sich selbst, was durch die Reaktion der Adressaten dieser Künstler schwerlich bestätigt wurde. Aber selbst dann, wenn dieser Anspruch der Künstler gerechtfertigt sein sollte, war damit wenig über den Umgang mit den Werken gesagt. Denn die Menschen, mit denen ich in Galerien, Museen, Theatern, Hochschulen, im Fernsehen, auf Straßen und Exkursionen zu tun hatte und zu tun haben wollte, waren ja nicht daran interessiert, ihrerseits durch den Umgang mit den Künstlerwerken zu Künstlern zu werden. Sie wollten nicht jedem Appell der Werke gerecht werden, der etwa lautet »
Versuche, solange mit eigenen Mitteln das Werk zu kopieren, bis Du dadurch die Fähigkeiten erlangt hast, analog zum Werk ein eigenes hervorzubringen.«
Diejenigen, mit denen und für die ich arbeite, sollten den Aussagenanspruch der Werke durch Aneignung kennenlernen; indem sie in ihren Alltagsbereichen analoge Ausgangspunkte für die Problemstellung der Künstler ausgrenzten und dann die Methoden und oftmals auch die Formen der künstlerischen Bearbeitung des Problems auf die eigene Bearbeitung der Alltagssituation übertrugen. Das war und ist übrigens meine Auffassung von der Bedeutung des programmatischen Kürzels »Kunst gleich Leben«. Erst nach solchen Versuchen ging es dann um kunstimmanente Aussagenansprüche der Werke.
Aus der oben genannten ersten konkreten Aufgabenstellung versuchte ich mich zu befreien, indem ich seit 1959 auf neuen Berufsbezeichnungen bestand: »Beweger, Animateur, einer der ersten Dichter ohne Literatur, Philosoph, der nicht denkt, always doing things for you«. Die Tätigkeitsformen des so gekennzeichneten Bewegers nannte und entwickelte ich als action-teaching (auch in der Happening-Zeit). 1965 wurde mir langsam klar, daß mit diesem Ausweichen auf neue Problemnamen nicht weiter zu kommen war, wenn man nicht ganz gezielt dem zugrundeliegenden Problem der Text-Bild-Bezeichnungen zu Leibe rückte. Als Arbeiten dazu nenne ich ›Der Satz‹, 1965 in der Galerie Jährling aufgeführt (dort bereits konkrete Verwendung des Begriffs Spuren, um das Publikum zur Verknüpfung von Erzählungen mit Objekten zu veranlassen); 1967 Arbeit über und zu Jan Voss ›Narrative Malerei‹; 1967 der Film ›Das Seminar‹ mit Nekes, in dem die Differenz von Aufbau und Struktur eines erzählenden Textes einerseits und dem eines erzählenden Bildes andererseits dargestellt wurden; 1969 in der Spielvorlage ›Unterst zuoberst‹ für die Expérimenta in Frankfurt, in deren erster Einheit ›Die Bühne als Ort des Ereignisses‹ systematisch die im Theatergeschehen sonst simultanen Sprachen und ihre Medien vereinzelt und analysiert wurden; 1969 in dem Hörspiel ›Grundgeräusche und ein Hörraum‹, in welchem die gleiche Analyse beschränkt auf akustische Wahrnehmungen vorgeführt wurde; 1971 in ›Die Pfingstpredigt‹ und ›Meeresrauschen auf der Hauptwache, eine Großraumbeschallung‹.
In der zweiten konkreten Aufgabenstellung zum Thema der Vermittlungsarbeit, versuchte ich mich zu behaupten, indem ich grundsätzliche, systematische Überlegungen zum Thema anstellte. Auf Einladung von M. Jochimsen (damals Universität Kiel) und Warnke/Klotz (damals Universität Hamburg) begann ich 1973 mit solchen Übersichtsdarstellungen zum Problem der Text-Bild-Beziehungen im Anschluß an meine Arbeit fürs Konzept und die Besucherschule der documenta 5/1972. Der neue Bilderkrieg um den Wirklichkeitsanspruch der Bilder führte damals für mich noch zu der Konsequenz, daß wir Bildanalphabeten seien, d. h. ich war noch der Auffassung, daß die Eigenständigkeit der bildsprachlichen Medien für die Probleme der Bildrezeption den Ausschlag geben. Bevor ich meine danach entwickelten Auffassungen skizziere, gebe ich Hinweise darauf, wie die Probleme der Text-Bild-Beziehungen in der Vermittlungsarbeit sich stellten.
In der Konfrontation mit den Künstlerwerken wird natürlich immer wieder die Tatsache demonstriert, daß Aneignung der bildsprachlichen Aussagenkonstruktionen ohne Rückgriff auf wortsprachliche nicht möglich ist, und zwar selbst für Künstler nicht. Das sprichwörtliche "Bilde, Künstler, rede nicht" ist offensichtlich anders als sprichwörtlich zu verstehen, und dann gilt es auch für Nichtkünstler: »
Laß Dich auf kommunikative Handlungen ein, und verharre nicht bei der Klärung der Bedingungen ihrer Möglichkeit! Du kannst ja nicht erst kommunikativ handeln, wenn die Bedingungen ihrer Möglichkeit geklärt sind; betrachte das Handeln selbst als einen Versuch der Klärung!«
Wenn aber das »Bilde, Künstler, rede nicht« als die Anweisung verstanden wird, man solle malen, zeichnen, modellieren, agieren etc. und nicht über das Malen, Zeichnen, Modellieren und Agieren reden, ohne es auch zu tun, dann ist damit nur auf eine ganz konkrete Situation hin etwas ganz Banales gemeint, aber keineswegs etwas über die Selbständigkeit des bildenden, bildsprachlichen Ausdrucks gegenüber dem wortsprachlichen gesagt. In der Tat: Jedermann bemerkt die zunächst ganz verwirrenden Beziehungen von ›Bildern‹ auf Texte notwendig zumindest in folgender Weise:
- in den Titeln der Bilder. Zumindest seit vier Jahrhunderten ist es in unserem Kulturkreis üblich, Bildern Titel zu geben, seien es solche, die von Künstlern den Werken mitgegeben wurden, oder solche, die für Werke allgemein gebräuchlich sind. Nun mag man der Auffassung sein, daß diese Titel nichts anderes darstellen als Namen für die Bilder; aber sobald in den Eigennamen Begriffe enthalten sind wie »Indiskretion« (Beckley) oder auch nur Namen für Dinge außerhalb des Bildes, auf die im Bild jedoch verwiesen wird, wie z.B. »Das Pelzchen« (Rubens) oder »Stilleben mit Guitarre« (Braque), dann organisieren diese Titelbestandteile unabdingbar die Wahrnehmung des Betrachters in ganz entscheidender Weise mit. Damit wird die Beziehung von Titeln zu den betitelten Werken als eine Erscheinungsweise der Bild-Text-Beziehung klärungsbedürftig.
- in der Tatsache, daß Künstler sich erklärter- oder unbestreitbarerweise von Texten für die Konstruktion eines bildsprachlichen Ausdrucks anregen oder gar bestimmen lassen. Im letzteren Falle läge nicht nur eine ungefähre, sondern eine in die Konstruktion des Bildes eingreifende Beziehung vor. So gibt es keine bloß ungefähre Beziehung eines älteren Meisters auf »die Verkündigung« im Neuen Testament; er wird stets, dem Aufbau des zugrundeliegenden Textes entsprechend, sich entweder für die Darstellung des Erschreckens von Maria vor dem Engel oder die ihrer Erörterung mit dem Engel oder die ihres stillen Nachdenkens oder die ihres schließlichen Akzeptierens des Auftrages oder die ihrer Danksagung mit der konkreten Gestaltung des textanalogen Bildes entscheiden müssen. Selbst Fachleute haben lange Zeit dergleichen Darstellungen nur einheitlich als ›Verkündigungen‹ aufgefaßt, weil sie nicht die unmittelbare Beziehung des Bildes auf den Text berücksichtigten und das, obwohl die Bilder selbst deutlich zeigten, wie wenig sie einem einheitlichen Typus der ›Verkündigung‹ entsprachen.
Mit der Rekonstruktion der Beziehungen von Bildern auf Texte beschäftigt sich seit 70 Jahren die Ikonografie ganz ausdrücklich, und zwar nicht aus bloßem Interesse an der Rekonstruktion eines wichtigen Aspektes der Entstehungsgeschichte einer bildsprachlichen Aussage, sondern weil ein Aussagenanspruch unmittelbar durch seine Entstehungsgeschichte mitgeprägt ist. Durch diese Rekonstruktionsarbeit aber entstehen wiederum Texte, die sich auf Bilder, die von der Ikonografie untersuchten Bilder, beziehen. Dadurch wird allmählich die textlich repräsentierte Geschichte der Entstehungsgeschichte und die Geschichte des textlich repräsentierten Umgangs mit den Bildern zum Bestandteil der Aussagenansprüche, die einem Bild zugeordnet sind. Diese organisieren entscheidend die Wahrnehmung des Bildbetrachters mit, wodurch die Beziehung von Text-Bild-Text als eine Erscheinungsweise der prinzipiellen Text-Bild-Relationen klärungsbedürftig wird, soll in dem Durcheinander nicht schließlich ganz verloren gehen, wovon eigentlich die Rede ist, und zwar auf den verschiedenen Stufen der historischen Entwicklung von Text-Bild-Text-Beziehungen.
Mit der Klärung dieser Frage beschäftigt sich die Ikonologie, auf welchen Typus von Texten sich auch die Bilder beziehen: heilsgeschichtliche Erzählungen oder Geschichtsschreibung, Märchen oder kanonische Bücher, Entdeckerberichte oder Zeitungsnotizen, die Kantische Ästhetik oder Darstellung der Unbestimmtheitsrelation oder das, was ein betreffender Künstler für seine oder irgendeine Theorie hält. Insofern tritt auch nicht in der modernen Kunst, wie Imdahl schlagkräftig formulierte, an die Stelle der Ikonografie die Theorie, sondern es haben sich offensichtlich in verstärktem Maße Künstler auf Texte bezogen, die man landläufig theoretische nennt. Am ikonografischen und ikonologisthen Vorgehen ändert das nichts Prinzipielles.
Durch Arnold Gehlens Hinweis auf die Kommentarbedürftigkeit moderner Künstlerwerke wird allzu leicht der Eindruck erweckt, als seien nur moderne Werke, die sich nicht auf einen feststehenden Kanon ikonografischer und gestalterischer Programme beziehen können, kommentarbedürftig. Ikonografischer und ikonologischer Aufschluß von Altmeisterlichem sind natürlich auch solche Kommentare. Ein Rembrandt ist auf die gleiche Weise, nur in noch größerem Umfang, kommentarbedürftig wie ein Wols, weil Rembrandt seine Gemälde sehr viel differenzierter organisierte als Wols. Bekanntlich gibt es mehrere Kommentare zu Wols und noch sehr viel mehr Kommentare zu Rembrandt. Die vielen Kommentare erzwingen wiederum neue Kommentare, um jeweils zu klären, wie denn die vielen Kommentare untereinander mit Bezug aufs kommentierte Künstlerwerk in einen Zusammenhang zu bringen sind, ansonsten würden sie sich gegenseitig aufheben.
Will man nicht auch für Gehlen wie für andere voraussetzen, daß sie zu ihrer Auffassung von der besonderen Kommentarbedürftigkeit der modernen Kunst kamen, weil sie sich fälschlicherweise einbildeten, sie verstünden einen Rembrandt selbstverständlich durchs bloße Draufsehen, denn Rembrandt sei eben noch ein richtiger Künstler gewesen, während Wols beliebige Hantierungen bloß als Kunstwerk auszugeben versuche, dann wäre von einer allgemeinen Kommunikationsbedürftigkeit auch von Kunstwerken zu sprechen, die als autonome konstituiert wurden. Es ist eben nicht zu leugnen, daß Künstler mit ihren wie immer gearteten Hervorbringungen auf sich selbst als Menschen verweisen, der anderen Menschen etwas mitteilen will.
- begegnet jedermann in der Konfrontation mit ›Bildern‹ dem Problem der Text-Bild-Beziehungen, wenn er etwa bemerkt, daß gegenwärtig wieder verstärkt (wie schon einmal im Mittelalter und im Barock) Texte als Bestandteile von Bildern auftreten oder Künstler bildsprachlichen Aussagenkonstruktionen, fixiert als Bilder, sogar eine untergeordnete Bedeutung für den Gesamtzusammenhang eines Künstler-Werkes zuweisen.
Dafür kämen folgende ›Erklärungen‹ in Frage: Die Künstler wollten etwas aussagen, was sich weder in Bildern noch in Worten darstellen läßt, vielleicht aber unter Verwendung von Bildern und Worten; oder die Künstler wollten eben die Problematik der Text-Bild-Beziehungen darstellen und untersuchen, weil dieses Problem für sie als Alltagssubjekte wie auch als künstlerische Aussagenurheber bedeutsam ist; oder die Künstler wollten den Zugang zu ihren Werken erleichtern, indem sie sie ihrer Erscheinung nach dem Werktypus anglichen, der in unseren außerkünstlerischen Kommunikationsbereichen vorherrscht, und das ist eben in Fernsehen, Film, Illustrierten ein Mixtum aus Texten, Bildern, Musik, Aktion, Körpersprache; oder die Künstler wollten einer tradierten Auffassung vom Gesamtkunstwerk entsprechen; oder die Künstler wollten sich eigentlich in anderen Rollen als der des Künstlers bewegen, z. B. der des Propheten, Politikers, Sozialarbeiters. Da man ihnen aber, wenn sie in diesen Rollen auftreten, nur zuhört, weil sie Künstler sind, erhalten sie einen Rest bildendkünstlerischer Aktivität aufrecht, der ihnen aber nicht wichtig ist.
- Jedermann begegnet vor allem die Problematik der Text-Bild-Relation in außerkünstlerischen Kommunikationsbereichen. Die Werbung besteht durchweg aus Text-Bild-Gefügen, z.B. als Omo-Reklame. Da werden in der Anzeige zwei Fotos von unterschiedlich weißen Wäschestücken gezeigt zum Beweis für die wortsprachlich erhobene Behauptung, daß Omo weißer wasche. Denn die Fotos zeigten ja unterschiedlich weiß gewaschene Wäschestücke und diese Tatsache erkläre sich daraus, daß das hellere der abgebildeten Stücke mit Omo gewaschen worden sei.
In den Fernsehnachrichten werden zu einem Bericht über neueste Vorkommnisse in Nordirland Bilder gezeigt, die genauso gut vor zehn oder fünf Jahren hätten aufgenommen sein können: marschierende englische Truppen, Schwenks über irisches Land, Straßensperren.
Was besagt da noch die Zuordnung dieser Bilder zu einem Text, der gerade gesprochen wird?
Die Politiker und Journalisten geben im Hinblick auf die konjunkturelle Entwicklung mit Vorliebe die Auskunft, es gehe wieder bergauf, obwohl man es bekanntlich bergauf schwerer hat als bergab. Solche Metaphern entstehen aus der Zuordnung von Vorstellungsbildern und Texten, die in dieser Operation häufig ihren Sinn verlieren oder ins Gegenteil verkehren.
In Zeitungen werden statistische Aussagen als Schaubilder gezeigt; die Maßstäbe der Übertragung variieren und so kann man nebeneinander als optisch gleichwertig die Darstellung des Anstiegs der Löhne um 100% in zehn Jahren und den Anstieg der Preise um 3,5% in einem Jahr geboten erhalten. In welchem Umfang verselbständigen sich die bildlichen Darstellungen gegenüber den zugrundeliegenden Texten, wird nicht z.B. eine nach rechts oben ansteigende Kurve immer im Sinne einer positiven Entwicklung gelesen (mehr, größer, stärker), auch wenn der so dargestellte Sachverhalt gar nicht erfreulich ist?
Und schließlich, aber entscheidend: In die Bereiche der Unterhaltung (vergleiche die allabendlich vorgeführten Philosophielektionen der Mainzelmännchen) sind längst für ein angeblich unbedarftes Publikum die Paradigmen der Text-Bild/Begriff-Anschauungs-Relationen eingegangen, die jahrzehntelang nur Spezialisten Kopfzerbrechen und Vergnügen zu bereiten schienen. Eschers, Magrittes oder Ben Vautiers (um nur diese zu nennen) brillierende Begriffsakrobatiken werden offenbar spielend bewältigt, was darauf hindeuten könnte, daß gegenwärtig in den Massenmedien ein höherer Grad an Sprachreflexivität herrscht als noch vor kurzem in den Werken der Spezialisten. Ein beliebiges Beispiel dafür:
In einem Illustrierten-Aufmacher tritt der subkulturelle Ausdruck »Mädchen aufreißen« zusammen mit der Frage auf, wie man das mache. Durch das Bildlichnehmen des wortsprachlichen Ausdrucks wird die Frage dann beantwortet: Gezeigt wird im Bild ein großer Reißverschluß, der gerade so weit geöffnet ist, daß dem offenen Schlitz ein nackter Mädchenkörper entsteigen kann. Die Rückwirkung dieser Verbildlichung auf die ursprüngliche Wortbedeutung von »Mädchen aufreißen« besteht darin, das Aufreißen als ein Entkleiden zu bestimmen. Der Reißverschluß wird dadurch als ein Instrument dargestellt, das ein schnelles Aufreißen der Kleidung ermöglicht, ohne die Kleidung zu zerstören. Auch die emotionale Wertigkeit des Begriffs »Mädchen aufreißen« ändert sich - vielleicht ist das sogar der Zweck der Operation. Die Aggressivität des Aufreißens wird zur gewünschten, vom »Opfer« gewünschten Reaktion umgedeutet, weil das Opfer mit dem langen Reißverschluß in seinem Kleid darauf vorbereitet zu sein scheint, aufgerissen zu werden.
Die Überführung von Wörtlichkeit in Bildlichkeit und deren weitere Überführung in Wörtlichkeit mit allen daran gebundenen Problemen des Übertragens von Aussagen aus einem Medium in ein anderes umfaßt für mich der Begriff der Reflexivität der Sprache.
Durch nichts anderes als Sprachreflexivität scheint mir einerseits die Vielzahl der Text-Bild-Relationen möglich und andererseits notwendig zu sein, damit Bedeutungen sprachlicher Handlungen entstehen und entwickelt werden können.
Ein weiteres Beispiel noch von einem der besten Kenner dieser Problematik unter den Künstlern.
Magritte zeigt in dem Gemälde ›Reproduktion untersagt‹ von 1937 im unmittelbaren Bildvordergrund die Dreiviertelrückenfigur eines Mannes im dunklen Straßenanzug. Der Mann sieht sich selbst in einem vor ihm über einem Kaminsims angebrachten Spiegel.
Er sieht sich aber entgegen aller Erfahrung als eben die Rückenfigur, als die ihn auch der Betrachter des Gemäldes sieht. Auf dem Kaminsims liegt ein Buch (Poes ›Abenteuer des A. G. Pym‹), das sich im Unterschied zum Mann ›richtig‹ spiegelt. Der Betrachter beginnt damit, zum Gemälde und seinen Zumutungen einen Text zu entwerfen, um sich - ob stumm oder laut gesprochen - Klarheit über das zu verschaffen, was ihm vom Gemälde als Widerspruch zu seinen Erfahrungen zugemutet wird. Er sagt sich: »Wenn man sich eine Spiegelanlage so aufgebaut vorstellen könnte, daß sich jemand in einem vor ihm befindlichen Spiegel als Rückenfigur sehen kann, dann käme immer noch nicht jener Eindruck einer realen Situation zustande, die das Gemälde darzustellen behauptet.« Nimmt man an, daß der Titel des Gemäldes, selbst wenn er beliebig ist, einen Hinweis gibt, dann scheint die Konstellation des Gemäldes gerade sagen zu wollen, daß zwischen den bildsprachlichen Zeichen und den wortsprachlichen sowie zwischen diesen und den außersprachlichen Gegebenheiten und den davon in unseren Köpfen rekonstruierten Vorstellungsbildern keineswegs das Verhältnis besteht, das man im Begriff »Reproduktion« faßt: »Reproduktion verboten«. Diese verschiedenen Ebenen reflektieren einander, nicht wie leblose Spiegel allerdings, sondern nach der Eigendynamik der natürlichen Sprache. Sie gilt es bis zu einem gewissen Grade stillzulegen, von ihr muß man sich bis zu einem gewissen Grade befreien, um die Sprache als Instrument und Medium der Kommunikation und des Denkens einsetzen zu können. Um das zu erreichen, versucht Magritte zunächst immer, die Reflexivität der natürlichen Sprache auszuschalten, indem er sie zu Aporien führt, denen das Denken nicht mehr zu folgen vermag. So entsteht der Zwang, sprachliche Operationen und Denken zu unterscheiden, wobei stets von Magritte mit Nachdruck klargestellt wird, daß es außersprachliches Denken nicht gibt.
In der Vermittlungsarbeit (meiner Besucherschulen unterschiedlichsten Typs) gilt es, anhand der Werke, mit denen man sich konfrontiert, diese Unterscheidungstätigkeit in Gang zu setzen als Differenzierung der Sprachebenen, der Sprachmedien, der Sprachstrukturen. Die Werke bieten dafür Anlaß - ganz gleich, ob sie ein Mixtum verschiedener Medien sind oder sich monomedial präsentieren. Das Differenzieren der Sprachebenen fällt dem Publikum gegenwärtig besonders schwer, weil das Künstlerwerk sich nicht mehr als eine monolithische Einheit verstehen läßt, sondern in ihm selbst schon verschiedenste Sprachebenen in Erscheinung treten, z.B. als Basisaussagen des Künstlers, die willkürlich gewählt sein können, die aber zugleich mehrfach im selben Werk interpretiert, beschrieben, analysiert werden. Hinzu treten dann unvermeidlich die Interpretationen, Beschreibungen und Analysen der Analysen durch den Rezipienten. Den so entstehenden Verwirrungen kann man meines Erachtens am besten begegnen, indem man von den einzelnen Rezipienten möglichst komplette Analogien zum Ausgangswerk nachbauen läßt, um dann die Differenzen zwischen den Analogien zu erörtern. Diese Differenzen müssen dann ebenfalls sprachlich vergegenständlicht werden als Oppositionen zum Ausgangswerk. Erst in der gleichzeitigen Ausbildung von Analogie und Opposition erreichen die Rezeptionsappelle des Ausgangswerks ihr Ziel. Die Sprachebenen-Unterscheidung schließt so den Zusammenhang zur Erörterung der Sprachstruktur.
Das will ich hier nicht ausführen, sondern mich beim Bezug auf das Thema ›Text-Bild-Relationen‹ mit Andeutungen über die Differenzierung der Sprachmedien begnügen. Vielleicht muß ich über Andeutungen auch gar nicht hinausgehen, denn die dadurch erzwungenen Mißverständnisse bieten die Chance für den Leser, sich vom Text zu lösen. Sprachen (Wort-, Bild-, Körpersprachen etc.) sind Medien der Vergegenständlichung des Denkens. Unvergegenständlichtes Denken gibt es nicht. (Zur Unterscheidung von Verdinglichung und Vergegenständlichung siehe meine "Ästhetik als Vermittlung".) Die Frage ist, in welchem Verhältnis diese Medien der Vergegenständlichung des Denkens zueinander stehen. Für ihre Unterscheidung halte ich mich an übliche Auffassungen: Medium der Wortsprachen, der Bildsprachen, der Körpersprache, der Sprache der Musik, der Sprache der Tiere etc.
Lange Zeit herrschte die Auffassung, diese Medien seien parallele Angebote, in sich geschlossene und gleich leistungsfähige sprachliche Vergegenständlichungsmöglichkeiten. Darauf beruhte z. B. die Unterscheidung der selbständigen Gattungen in Kunst und Literatur etc. Aber bereits simple Überlegungen zeigen, daß diese Auffassung nicht stimmen kann, denn lassen sich etwa Negationen, konditionale Verknüpfungen, selbst Zeitformen bildsprachlich überhaupt ausdrücken? Es müßten ja Transformierungen von Aussagen aus einem Medium in ein anderes möglich sein, ohne die Aussagen stärker zu verändern, als wenn man einen bildsprachlichen Aussagenzusammenhang in einen anderen übersetzt. Das ist offensichtlich nicht möglich. Die unleugbare Eigengesetzlichkeit der Medien bedeutet keinesfalls schon, daß die einzelnen Medien tatsächlich autonome Sprachen sind.
Allgemein vorherrschend war deshalb immer schon die Auffassung, daß die einzelnen Medien sich additiv komplettieren zu einer einheitlichen sprachlichen Operation. Was man gerade mit Worten nicht sagen kann, sagt man eben mit Bildern oder Gesten oder mit Musik, die die Worte begleiten. Am besten sagt man alles stets zugleich mit Worten, Bildern, Gesten, Musik, wenn die Ökonomie der Kommunikation das zuläßt.
Aber diese These von der Komplettierungsleistung der Medien in der Einheit der sprachlichen Opposition übersieht die unleugbare Eigengesetzlichkeit der Medien: Die bloße Addition der heterogenen Vergegenständlichungsformen schafft keine Einheit der sprachlichen Operation.
Deshalb bin ich der Auffassung, daß erst reflexiver Gebrauch der verschiedenen Medien und Formen der sprachlichen Vergegenständlichungen in ihrem wechselseitigen Bezug aufeinander die Einheit der sprachlichen Operation ermöglicht. Im Alltag verlassen wir uns dabei auf die Reflexivität der natürlichen Sprachen; sie ist ihnen implizit. Selbst wenn diese Reflexivität der natürlichen Sprachen etwa in den Wissenschaften explizit herausgearbeitet wird, um durch Isolation eines Mediums der Vergegenständlichung des Denkens die Kommunikation eindeutiger werden zu lassen, bleibt die implizite Reflexivität der natürlichen Sprachen erhalten. Man drückt das heute so aus, daß man sagt, die Umgangssprache des Alltags garantiere auch für Wissenschaftler erst die Kommunikation über ihre hochgradige und explizit formalisierten Sprachen. Für unser Thema heißt das, erst der wechselseitige Bezug von Texten und Bildern aufeinander in ein und demselben kommunikativen Akt begründet die Leistungsfähigkeit der Sprache als Medium der Vergegenständlichung von Denken. Der wechselseitige Bezug ist als ununterbrochene Transformierung der Texte in Bilder und der Bilder in Texte zu leisten. Wegen der Eigengesetzlichkeit der Medien kann diese Transformierung nur als nicht-identische Übertragung zustande kommen, jedenfalls zu einem erheblichen Anteil. Wie ist dann aber Verstehen möglich? Oder wenigstens Verständigung, um die es ja vor allem Verstehen geht?
Was ich will, weiß ich nicht; was ich weiß, kann ich kaum sagen; was ich sage, meine ich vielleicht so, guck mal her!
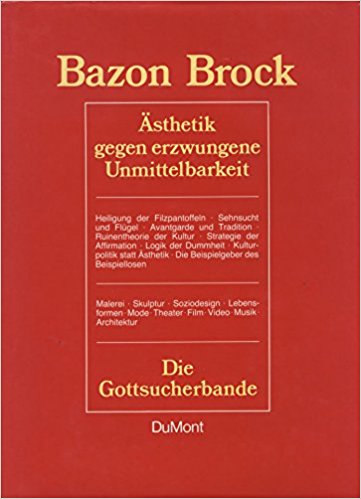 + 1 Bild
+ 1 Bild