Aus der Diskussion des 6. Internationalen Werkbundgesprächs, Darmstadt, 7./8. Juni 1980; in: Werk und Zeit, 3/1980
In den letzten zweihundert Jahren sind wir auf den Mythos des Schöpfers ausgerichtet worden, auf das schöpferische Hervorbringen von etwas, das bisher noch nicht da war, ohne daß diesem Tun eine entsprechende Betonung all jener Aktivitäten korrespondiert hätte, die etwas aus der Welt bringen, das vorher in sie hineingebracht worden ist. Der Mythos des schöpferischen Hervorbringens ergibt aber ohne sein Pendant, die Fähigkeit etwas aus der Welt zu bringen, die Konsequenz, daß die Welt langsam vollgestellt wird mit all dem, was in ihr vorher nicht existent war. Das heißt. daß der Schöpfer oder das Kollektiv der schöpferischen Menschen die Welt gerade dadurch zerstören, daß sie ununterbrochen und immer schneller die Welt mit den Produkten ihrer Schöpfungsfähigkeit verstellen. Bisher sehen wir die Zerstörungen durch kriegerische Auseinandersetzungen nicht als Pendant zur Schöpfung an. Wir haben nun zweihundert Jahre Industriegesellschaft, mit dem Pathos der ›creatio ex nihilo‹, mit dem Industriellen und dem Künstler als Industriellen in der Analogie zum Schöpfergott der Christen.
Wie nun korrespondieren Hervorbringen und Aus-der-Welt-Bringen? Man kann zur Beantwortung dieser Frage auf Überlegungen zurückgreifen, die in anderen Kulturen und zu anderen Zeiten, aber auch in unserer eigenen Geschichte immer wieder angestellt worden sind. Es gilt hier nicht zu unterscheiden zwischen Hervorbringen und Zerstören, zwischen In-die-Welt- Bringen und Aus-der-Welt-Bringen, sondern zwischen Handlungen mit irreversiblen Folgen und solchen mit weniger irreversiblen. Um diesen Aspekt müssen wir uns heute kümmern, auch im Hinblick auf eine Strategiediskussion. Problemlösungen können stets nur als das Schaffen neuer Probleme angesehen werden. Es gilt dann, die Frage zu stellen, ob die Probleme, welche durch die angebliche Lösung eines Problems neu entstehen, irreversible Konsequenzen größeren Ausmaßes haben als das Problem, welches man ursprünglich löst. Wenn man zum Beispiel das Problem mangelnder elektrischer Energie mit dem Bau von Anlagen beheben will, die Plutonium produzieren, dann sind die Folgen der Probleme, die sich aus der bestimmten Lösung von Problemen ergeben, unvergleichlich schädlicher als das anfängliche Energiedefizit. Ebenso die Umwandlung von sichtbarem in unsichtbaren Schmutz, wobei hierzu natürlich auch Unhörbarkeit. Unriechbarkeit, Untastbarkeit, Unfühlbarkeit gerechnet werden müssen.
Man kann die Folgen eines industriellen Lebens nicht aufheben, indem man aus den Bedingungen aussteigt, die zu den erwähnten Folgen geführt haben. Aber man kann wenigstens die Begründung eines solchen Resultates kritisch betrachten, also in diesem Fall das System. Es handelt sich da um Zwangsläufigkeiten, Notwendigkeiten, ja um Rationalität. Das beste wäre, den Mythos des Schöpfers, das heißt den Mythos des Entwerfens von einem Ganzen, genannt System, aufzuheben. Denn in Wirklichkeit ist es kein System, gibt sich bloß als solches aus, mit der Absicht, Kritik zu unterdrücken, indem man etwas Hervorgebrachtes als vollkommen identisch postuliert mit den Vorbedingungen, mit dem Konzept, mit dem Plan und seiner Entstehung: die vollständige Übereinstimmung zwischen dem, was wir wollen, und dem, was wir hervorbringen. Unter diesem Gesichtspunkt ist die von Maurice Culot beschriebene Misere der Industriestädte, soweit architektonische Probleme gemeint sind, weiß Gott nicht vom Kapital aufgezwungen, sondern von den Architekten selbst. Was da steht und was heute als die Scheiße der industriellen Lebensweise bezeichnet wird, entspricht vollständig dem, was Architekten als Weltenschöpfer hervorbringen. Es ist genau das, was gewollt wurde.
Es geht aber darum anzuerkennen, daß bestimmte Schwierigkeiten im Zusammenhang von Hervorbringen und Wegbringen aus unserer Anmaßung resultieren, als Industrielle oder als Künstler Weltenschöpfer nach dem Modell des christlichen Gottes sein zu wollen, was ja nichts anderes heißt, als daß wir glauben, die Fähigkeit zu besitzen, etwas Vorgestelltes, Entworfenes, Geplantes genau in dem Sinne in die Wirklichkeit übersetzen zu können, in dem wir es gemeint haben. Mir geht es um das Durchtrennen dieser Illusion einer Übereinstimmung von Konzept und Realisierung. Das wäre möglich, wenn man sich jetzt auf eine spezifische Art der Mülltheorie einließe: nämlich auf eine Ruinentheorie.
Nach wie vor hält man es für eine große Tugend, ja geradezu für ein Kriterium der Größe eines Schöpfers, daß er seinen Plan möglichst restlos zu realisieren versteht. Es gilt immer noch als Qualitätsmaßstab eines Künstlers, wenn man von seinem Bild sagt, es sei genau so, daß man nicht ein Fetzelchen wegnehmen oder hinzufügen könne. Alles stimmt, ist in sich so geschlossen, daß man den Eindruck gewinnt, dieser Künstler sei wirklich Gott persönlich, der vorausschauend alles, was in Zeichen denkbar und vorstellbar ist, genau an den Ort gesetzt hat, aus dem es, wegen seiner Bedeutung, nicht herausgerückt werden darf. Die Geschichte lehrt uns jedoch etwas anderes: Wir können nicht darauf hoffen, ein Ganzes zu entwerfen, einen Plan bis ins Letzte zu verwirklichen, die Illusion von der tatsächlich unverrückbaren Stelle eines jeden Zeichens in einem System zu realisieren, so daß Bedeutungen schließlich festgeschrieben werden könnten.
Die Ruine, der Müll sind quasi die Vergegenständlichungen dieser Differenz zwischen Entwurf und Realität, zwischen unserer Fähigkeit, Bruchstücke zu addieren, und dem schöpferischen Plan aus dem Nichts, der zuerst den Gesamtzusammenhang schafft und dann hier und da noch mit Details aufgefüllt wird. Ruinen sind Objekte, die die Voraussetzung erfüllen, uns und unserer Selbsterkenntnis auf die Sprünge zu helfen. Hier können wir in der Tat aus früheren Gesellschaften unseres Kulturbereichs lernen, zum Beispiel, wenn wir uns fragen, welche Bewandtnis eigentlich die ruinöse Architektur des englischen Gartens im 18. Jahrhundert hat, jenseits der Vorstellung, sie gäbe nur eine Art von kulissenhaft-theatralischem Hintergrund für die Selbstinszenierung einer sozialen Elite.
Wo immer ein anderer Weg gegangen wird als Ruinen zu bauen, wann immer ein Plan umstandslos verwirklicht wird, entsteht nichts anderes als ein Konzentrationslager. Im 16. und 17. Jahrhundert sind unter diesen Bedingungen Städte projektiert worden, von denen noch einige stehen. Mochten die Pläne und systematischen Konstruktionen des Ganzen dieser Siedlungen auch von noch so humanen und künstlerisch befähigten Architekten stammen – die damaligen Neugründungen vom Reißbrett weg erwiesen sich als reine KZ, die man wie Palmanova von Scamozzi (1593) nur noch als Gefängnisse nutzen konnte. Sie waren KZ, obwohl ihre Baumeister zu den fähigsten Architekten zählten, die in ihrem Schaffen alles berücksichtigten, was wir heute von einem guten Architekten zu fordern gewohnt sind. Ein guter Architekt ist aber nur jemand, der weiß, daß er nicht darauf bestehen darf, Systeme zu entwerfen, ein Ganzes hevorzubringen, sondern der weiß, daß er den bewußt fragmentarischen Charakter seiner Arbeit, jene Differenz von Vorstellung und Ausführung sichtbar machen muß. Das, was wir in die Welt hineinbringen, darf nur von der Art der Ruinen sein, als Verwandelbares ohne irreversible Folgen. Das ist schwierig zu akzeptieren, weil wir alle noch fest am Weltenschöpfermythos kleben.
Es gilt jedoch, endlich Zeitgenossenschaft zu entwickeln, damit wir an der Historie lernen können, was wir hervorzubringen in der Lage sind. Wenn ich selber zum Beispiel Mitte der 60er Jahre die Übungen des ›Wegwerftrainings‹ (1) gemacht habe, so glaubten einige Leute, ich sei einer jener Protagonisten der Plastikwelt von ex und hopp. Gemeint war allerdings ein Training gegen das Haben-Wollen; gemeint war, sich darin zu üben, auf Dinge zu verzichten, sie wegzuwerfen, sie von sich zu geben, um sie als fremde entdecken zu können. Zeitgenossenschaft zu entwickeln, heißt in dieser Hinsicht, die Entfremdung als wertendes Faktum anzunehmen.
Ohne daß wir die Entfremdung als notwendigerweise gegeben ansehen, werden uns die Dinge vollkommen bedeutungslos. Sie gingen in dem auf, was wir willkürlich mit ihnen vorhaben, was wir in sie hineinprojizieren. Wir müssen die Entfremdung akzeptieren, um die Chance zu haben, Dinge eben als etwas zu entdecken, was sich auch über uns und gegen uns durchsetzt. Gerade dann, wenn wir ihre eigenen Schöpfer sind. Das von den Künstlern produzierte Pathos des Weltenschöpfers entwickelt eine bestimmte Moral, die alte Vorstellung des Zauberlehrlings: Was ich schaffe. verselbständigt sich gegen mich, und ich habe deswegen schon während ich es schaffe dafür zu sorgen, daß dies nicht möglich ist. Die industriellen Systemdenker und -schaffer wollten ja auf Petrifizierung hinaus, auf Ewigkeitsvorstellungen aller Art.
Wenn Maurice Culot gesagt hat, wir müßten wieder hinaus auf das, was Ewigkeitswert beanspruchen kann, was nicht zeitgenössisch, kurzfristig ist, ist das die gefährlichste Forderung, die man überhaupt stellen kann. Ihr sich zu widersetzen, gilt auch in einem strategisch-aufklärerischen Sinne unser Bemühen, den Anteil der funktionsfähigen Ruinen in unserer Gesellschaft gegenüber dem Perfekten zu erhöhen. So ist meine Empfehlung: Schaffen Sie mehr Ruinen!
(1) ›Wegwerfbewegung‹; vgl. hierzu: ›Ästhetik als Vermittlung‹, S. 423 ff.
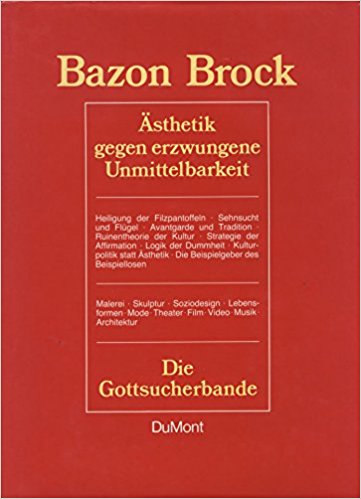 + 1 Bild
+ 1 Bild