Essay im Katalog zur Ausstellung O. Oberhuber, Museo de Bellas Artes, Bilbao 1985.
An die Aporien des Kunstmarktes scheinen wir uns gewöhnt zu haben - vielleicht deshalb, weil sie relativ harmlos sind: Hält ein Künstler über Jahrzehnte einen einmal gefundenen Formgedanken durch, dann wirft man ihm vor, daß ihm wohl nichts Neues mehr einfiele; beginnt er immer erneut wieder von vorne, stellt er sich jeweils neuen Problemen, dann bekommt er zu hören, daß er wohl auch nicht mehr der alte sei. Aber damit haben wir nun einmal alle zu rechnen.
Hinter solchen Rechnungen, die am Kunstmarkt aufgemacht werden, stehen Zweifel, die wir an uns und unserem Urteil selber haben, und diese Zweifel werden erheblich durch die immer erneute Erfahrung bestärkt, daß Künstler in ihrer Arbeit und Werkentwicklung - selbst, wenn wir sie ganz gut zu kennen glauben - nur in den seltensten Fällen unseren Erwartungen entsprechen: Wir wollen diese Arbeiten und Werke unbedingt zu kalkulierbaren Größen werden lassen, die auch für die Künstler selber verbindlich sein sollen.
Aber - nicht nur Konrad Adenauer scherte sich nach eigenem Bekunden wenig darum, was er gestern gesagt oder gedacht habe. Jeder produktive Mensch muß damit rechnen, daß Kreativität eine Funktion des schlechten Gedächtnisses ist, oder, positiv ausgedrückt, daß Vergessen zu können eine Voraussetzung für Kreativität ist. Wer Künstler auf die ihnen einmal zugeschriebene Identität festlegen will, zeigt sich als wenig kreativer Rezipient. Das gesteht man sich nicht gerne ein; wo es dennoch unumgänglich ist, rächt man sich an den Künstlern - vor allem den auch quantitativ außerordentlich produktiven -, indem man ihre Werke als uneinheitlich, unentschieden, zwiespältig, von Moden und Tendenzen hin- und hergerissen abwertet.
Dagegen glaubt man, die eisernen und konsequenten Durchhalter naturgemäß schmaler Konzepte und Formgedanken lobend absetzen zu können, bis - siehe oben - die Aporie des Marktes doch wieder sich geltend macht.
Für mich sind diejenigen Künstler am interessantesten, die - wie Oswald Oberhuber - den Vorwurf eklektizistischer Apartheit mit mattem Lächeln übergehen, und die mit leichtem Achselzucken bekunden, daß sie nicht darauf angewiesen seien, krampfhaft jede ihrer Werkäußerungen der ihnen abverlangten monolithischen Identität zu unterwerfen.
Für Oberhuber scheint es selbstverständlich zu sein, daß nicht jeder Künstler die zu seinen Lebzeiten wichtigen künstlerischen Problemstellungen selbst zu entdecken hat; sondern daß es darauf ankommt, sich den für die eigene Zeitgenossenschaft nun einmal wichtigen Fragen zu stellen - wer auch immer diese künstlerischen Fragestellungen zur Diskussion gestellt haben mag. Nicht modische Anpassung an das, was jeweils gerade künstlerisch ad hoc ist, sondern die Verpflichtung zur Zeitgenossenschaft veranlaßt einen Künstler, auf Sachverhalte zu reagieren und etwas in die Welt zu setzen.
Nach meinem Verständnis fühlt sich Oberhuber tatsächlich eher zur Arbeit als Zeitgenosse denn zur Arbeit am Sockel für das eigene Denkmal künstlerischen Genies verpflichtet. Es ist nur allzu verständlich, daß sich Oberhuber - wie andere - mitunter doch versucht sieht, sein Genie zu pflegen, indem er darauf hinweist, daß er lange, bevor sich bestimmte Problematiken als allgemein interessierende herausgestellt haben, bereits an ihnen arbeitete; selbstverständlich insofern, als kreative Künstler eben doch ein beachtliches Gespür für jene Aspekte des künstlerischen Schaffens ihrer Zeit haben, die dann auch allgemeines Interesse finden.
Ich möchte mit Bezug auf das grafische Werk von Oberhuber einige Hinweise auf eine Problemkonstellation geben, die offenbar für die künstlerische Zeitgenossenschaft von großem Interesse ist - und die Oberhuber seit dreißig Jahren beschäftigt.
Seit den 60er Jahren wird die spezifische Leistungsfähigkeit der grafischen Notation wieder diskutiert.
Ließ sich bis dahin mit der notwendigen Vereinfachung sagen, daß grafische Notate in erster Linie schnelle Skizzen eines künstlerischen Gedankens waren, der später vom Künstler aufgegriffen und angemessen ausgearbeitet werden sollte, so schien Oberhuber die Frage zu stellen, in welcher Beziehung die vielen Spontannotationen zueinander stehen. Ihm ging es nicht mehr um die Beziehung von Skizze zu späterer Entfaltung des skizzierten Gedankens, sondern vielmehr darum, inwieweit die zahllosen, von einem Künstler situationsbedingt gemachten Momentaufnahmen miteinander ein Notationssystem bilden.
Im Unterschied aber zu Notationssystemen, wie sie etwa die verschiedenen Notenschriften oder die formalisierten Sprachen darstellen, scheinen die künstlerischen Notationssysteme nicht Angebote zu sein, derer sich jeder bedienen kann, der sie zu lernen bereit ist. Die Übertragbarkeit und damit auch eine allgemeine Verwendung der einmal von irgend jemandem entwickelten Notationen schien den künstlerischen nicht gegeben zu sein.
Welches Interesse soll man dann aber an den künstlerischen Notationen haben? Wenn sie doch nur von ihren jeweiligen künstlerischen Urhebern sinnvoll genutzt werden können, dann bleibt dem Rezipienten bestenfalls der Versuch, die einzelnen Notate als Fragmente eines Aussagensystems zu betrachten, das seinerseits unzugänglich ist. Das Fragment-Puzzle kann nicht aufgehen, so sehr auch der Rezipient gewillt wäre, die Gesamtproduktion eines Künstlers für die Rekonstruktion eines systematischen Zusammenhanges zu berücksichtigen.
Ist ein Rezipient vorstellbar, der zwar eine Schrift lesen - aber nicht selber schreiben kann?
Oberhuber schien uns Rezipienten daraufhin trainieren zu wollen, jene scheinbaren Beiläufigkeiten auf die gleiche Weise zu betrachten, mit der wir von ihrer Materialität und aufwendigen Gestaltung her Aufmerksamkeit fordernden Großwerken begegnen. Sollte das als die Antwort akzeptabel sein - etwa in dem Sinne, in dem wir von Künstlern seit dem Beginn dieses Jahrhunderts darauf hingewiesen werden, auch die vor dem Winde treibenden Zeitungsseiten als Plastiken wahrzunehmen oder die Gestaltungsqualitäten eines zufällig entstandenen Abfallhaufens?
Dann hätten wir in den fragmentarischen Notaten analog zum »objet trouvé« so etwas wie ein »image trouvé« zu sehen.
Es ist bemerkenswert, daß Oberhuber nur beiläufig auf Erörterungen der künstlerischen Notationen eingeht, wie sie von Musikern - beispielsweise von Cage - angestellt worden sind. Diese Musiker fragten, wie man künstlerische Gedanken, Form- und Verlaufsvorstellungen notieren könne, ohne sie so festzulegen, daß für die Benutzer der Notationen nur noch geringe Freiheit der Realisierung, kaum aber Freiheit zur Weiterarbeit am künstlerischen Konzept bleibt.
Werden die Notationen weitgehend offen und unbestimmt gehalten, dann scheinen die Kompositionen kaum noch einzelnen Musikern als Urhebern zuordenbar zu sein: es entsteht gleichsam eine anonyme Musik.
Schreibt man andererseits die Notationen so systematisch wie in den herkömmlichen Notenschriften fest, so bleibt gerade das Gedanken- und Gestaltungspotential ausgeklammert, um das es Musikern wie Cage geht. Als Ausweg aus diesem Konflikt versuchten Musiker, unter anderem Zufallsgeneratoren in die Realisierung der musikalischen Gedanken einzubauen: Nicht nur der Musiker schoß auf herkömmliches Notenpapier, um sich Notationen vorzugeben; auch die Spieler erhielten Anweisung, während der Aufführung zufällige Notationen zu produzieren und zu nutzen.
Er scheint zu sagen, daß die fragmentarischen Einzelnotationen nicht zu einem übertragbaren Notationssystem zusammengeschlossen werden können; das Fragment kann auch als selbständige künstlerische Einheit gelesen werden. Der Zwang zum systematischen Zusammenschluß muß überwunden werden; wer ihm nachgibt, produziert bestenfalls Kuriosa, wie sie etwa der Bildhauer schaffen würde, der Michelangelos ›Sklaven‹ durch Weiterarbeit am nur fragmenthaft gestalteten Materialblock vervollständigen wollte.
Cage sieht offenbar im gewollten - und damit in gewisser Hinsicht steuerbaren - Zufall ein Mittel, die Alleinverbindlichkeit einer Lesart der Notationen zu verhindern, wodurch zugleich die Übertragbarkeit der Notate als allgemein brauchbarer Notenschrift gewährleistet werden könnte.
Ein anderer Weg, die künstlerisch selbständige Einzelnotation mit den Erfordernissen eines übertragbaren Notensystems zu vereinbaren, scheint in der Bildung von Sequenzen zu bestehen. Die systematische Notation ist nicht möglich und auch nicht wünschenswert. Das Einzelfragment hat zwar eine gewisse künstlerische Selbständigkeit, aber unser kulturelles Training hindert uns daran, dem Einzelfragment Verbindlichkeit zuzugestehen (ein großformatig und technisch aufwendig durchgearbeitetes Werk scheint uns eben bedeutsamer zu sein als schnell hingesetzte Notationen auf einem Pappdeckel). Eine Sequenz von mehreren fragmentarischen Notaten kann da eine sinnvolle Zwischenlösung ermöglichen, wobei der Zusammenhang der Einzelnotate in der Sequenz entweder in der Ähnlichkeit formaler und materialer Aspekte gegeben ist oder aus der Tatsache hervorgeht, daß die Einzelnotate sich auf die gleiche situative Ausgangslage beziehen.
Es ist kein Zufall, daß die Sequenzbildung derartig in den Vordergrund trat, als man den Fotoapparat wie einen Skizzenblock benutzte, also nicht mehr vor dem Apparat einen Bildzusammenhang inszenierte und ihn mit dem Apparat abbildete, sondern mit ihm spontan auf Wahrnehmungsveranlasser reagierte, ohne vorweg kalkulieren zu können, welche Resultate dabei im einzelnen herauskommen würden.
Die vielen so entstandenen Fotos werden bei der Auswertung zu Sequenzen zusammengeschlossen, in denen sich eine Spannung zwischen vereinzeltem, verselbständigtem Einzelbild und einem übergeordneten Gestaltungszusammenhang demonstrieren läßt.
Oberhuber hat im Laufe der Jahre in seinem grafischen Werk immer wieder die Auseinandersetzung um die Leistungsfähigkeit künstlerischer Notationen geführt. Einerseits gibt es im Werk Oberhubers Perioden, in denen er der Forderung nach künstlerischer Selbständigkeit des vereinzelten, fragmenthaften Zitats zuzustimmen scheint; andererseits entspricht er den Vorschlägen durch hinreichende Beiläufigkeit, ja Zufälligkeit, die Einzelnotate nur als Spielmaterial prinzipiell gleichwertiger Aussagenzusammenhänge anzubieten.
Zum dritten gibt es im Oberhuber-Werk immer wieder demonstrative Sequenzbildungen (die jüngste wohl in den Blättern vom "Badeurlaub" und in den "Morgendlichen Mitteilungen an meine Familie"). Der Charakter der Sequenzen ist weniger von den vor allem fotografischen und filmischen Realisierungen der zeitgenössischen Konzept-Künstler bestimmt; er scheint sich vielmehr für die spezifische Notationsleistung des Amateurduktus zu interessieren.
Oberhuber interessierte sich dafür, was ein bildender Künstler vom Amateur und Dilettanten zu lernen vermag, ohne nur in den Werken der Dilettanten einen ästhetischen Reiz befremdlicher Naivität zu genießen. An den Notationen der Dilettanten wird klar, daß ein großer - wenn nicht der größte - Teil künstlerischer Qualitäten, die wir Kunstwerken zugestehen, einem Formalismus der trainierten Hand entspringt.
Je größer die Könnerschaft der Hand, desto größer die Gefahr der Verselbständigung der künstlerischen Mittel gegenüber dem Konzept und den Gedanken. Dubuffets und Oberhubers Rückgriff auf den Amateurduktus befreit das künstlerische Werk von der Vorherrschaft professioneller Verabredungen, die eigentlich doch mehr für Künstler und weniger für Nichtkünstler interessant sind. Sie bieten dem Adressaten die Möglichkeit, seine eigenen Notationen als leistungsfähige Realisierung von Mitteilung zu verstehen.
Auf den sprichwörtlichen Einwand gegen den sprichwörtlichen Picasso: »Das soll Kunst sein? Das kann mein Kind auch«, entsteht so eine ernsthafte Antwort: »Ob es das Kind - oder sonst ein Amateur - kann oder nicht, ist belanglos. Entscheidend ist, ob das Kind - oder der Amateur - das auch tun, was sie könnten.«
Die Amateure bedürfen insofern eben der Unterstützung durch den Künstler - oder: Nur Künstler können Amateure sein, weil sie eben über lange Zcit und mit Konsequenz das tun, was zwar jedes Kind und jcder Amateur auch könnten - aber eben doch nicht tun.
Aus dieser Sicht heraus ist verständlich, daß erst professionelle Künstler die spezifische Leistungsfähigkeit der außerhalb der Kunst entwickelten Sprachcharaktere entdecken konnten. Es hieße, den menschlichen Selbst- und Fremdbezug auf die Aspekte zu reduzieren, die Künstlern wichtig sind, wollte man jene Entdeckung nur künstlerisch ausbeuten.
Dabei ginge die Beispielhaftigkeit künstlerischen Vorgehens für die Nichtkünstler verloren, ja, die Kunst hätte Nichtkünstlern gar nichts mehr zu bieten. Gerade gegenwärtig versteht man doch wohl wieder, daß die Kunst nur ein Beispiel der Bewältigung jener Probleme geben sollte, die sich prinzipiell allen Menschen stellen.
Die Positionen Oberhubers sind gerade darin für uns bedeutsam, daß er sich bereit findet, seine Arbeiten auf der Ebene wirksam werden zu lassen, auf der auch die Nichtkünstler ihre Beispielhaftigkeit erkennen können. Man hat nicht deshalb etwas zu sagen, weil man zeichnen kann - also Professionalismen beherrscht -, sondern man kann zeichnen, sobald man etwas zu sagen hat. Aber - man hat nur dann immer wieder etwas zu sagen, wenn man seine eigenen Notationen von Fall zu Fall aufzugeben bereit ist, sie also nicht zu einem geschlossenen System verfestigt. Personaler Stil ist ein Name für ein derartiges geschlossenes Notationssystem.
Oberhubers Werk macht seinen Adressaten Mut zum Widerruf.
Es ist ein Beispiel für erfolgreichen Widerstand gegen den Anspruch auf Endgültigkeit, den jede künstlerisch gelungene Arbeit selbst zwangsläufig erhebt.
Daraus begründet sich für mich auch die unglaubliche Produktivität Oberhubers und seine Fähigkeit - als Künstler gleichermaßen im Atelier und in der Galerie, in der Hochschule und in der Kulturpolitik, als Ausstellungsmacher und Ausstellender, als Entdecker im historischen Terrain und als Veranlasser des erst Zukünftigen -, präsent zu sein.
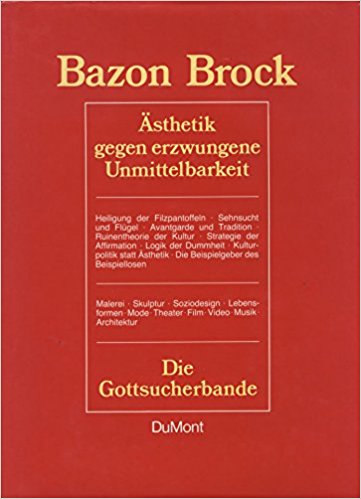 + 1 Bild
+ 1 Bild