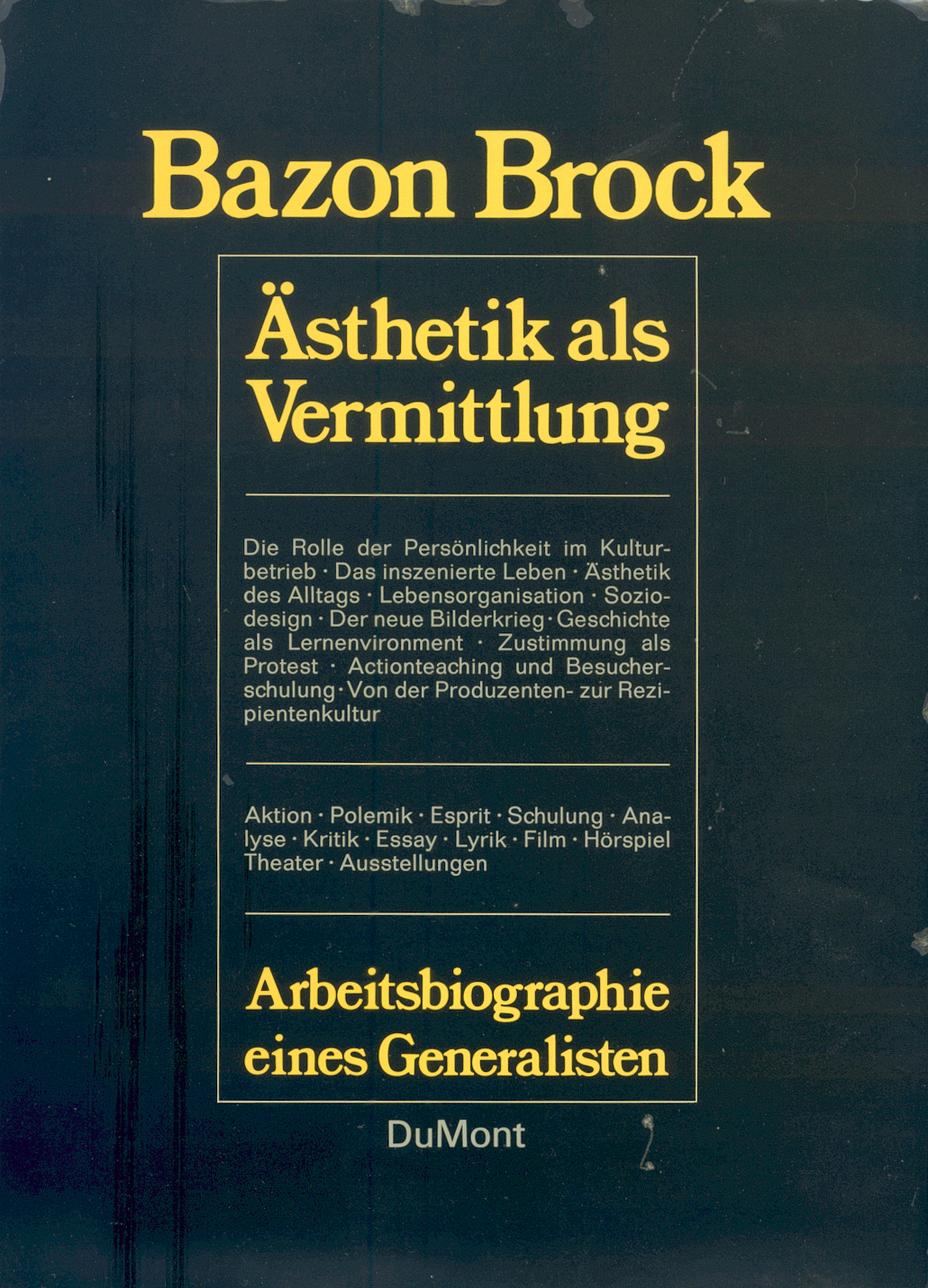Zu der Frankfurter Ausstellung „Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert“
Rezension der genannten Ausstellung im Städel, Frankfurt am Main, 1975. In gekürzter Fassung unter obigem Titel abgedruckt in FRANKFURTER RUNDSCHAU, 22.2.1975. Der Edition liegt die wesentlich umfangreichere Manuskriptfassung zugrunde (ursprünglich unter dem Titel ‘Ein Triumph,des Unbestimmten’). Zum hier aufgegriffenen Bilderkriegthema; vgl. auch ‘Zur Geschichte des Bilderkriegs um das Realismusproblem’ (in diesem Band, Teil 3.8).
6.1 Der realistische Maler
“Treu die Natur und ganz” – Wie fängt er”s an: .
wann wäre je Natur im Bilde abgetan?
Unendlich ist das kleinste Stück der Welt! –
Er malt zuletzt davon, was ihm gefällt.
Und was gefällt ihm? Was er malen kann!
Friedrich NIETZSCHE
6.2 Das unsichtbare Königreich der einen Kultur
Man könnte den Gedanken favorisieren, daß wir Deutschen uns gegenwärtig derart auf das 19. Jahrhundert stürzen, weil in ihm durch die Schaffung des Deutschen Reiches das Deutschsein als politischer Machtanspruch dingfest gemacht wurde; weil man endlich zu wissen glaubte, wovon man sprach, wenn man von Deutschland sprach. Inzwischen ist dieser verständliche Anspruch in Trümmer gegangen, und wir stehen wieder so da, wie die Deutschen ohne Deutschland vor 1871.
Zwar hatte man immer schon vorgebeugt angesichts realer politischer Ohnmacht, indem man einerseits für die Deutschen auf den Nationalstaat verzichten wollte, um sie gleich den nächsten Schritt hin zum Weltbürgertum machen zu lassen (GOETHE) und andererseits, indem man selbstbewußt Deutschsein als eine Frage nach dem Wesen des menschlichen Daseins auslegte, das immer schon mehr in Richtung auf das Reich Gottes und der Freiheit tendiert habe als auf ein noch so mächtiges und blühendes irdisches Staatswesen. Schließlich hat es ja auch nach 1871 nicht ein deutsches Reich als tatsächlichen Zusammenschluß der Deutschen gegeben, sondern als eine Ausweitung des Machtbereichs des preußischen Staates auf die vielen deutschen Teilstaaten.
Es überrascht kaum, daß die Deutschen sich nach 1945 nur zeitweilig in der Gefahr glaubten, mit dem Verlust des Deutschen Reiches auch die Grundbedingung fürs Deutschsein verloren zu haben. Denn schließlich blieb ihnen ja noch die deutsche Kultur, fein säuberlich unterteilt in die deutsche Philosophie, die' deutsche Musik, die deutsche Literatur und, mit erheblichem Abstand, die deutsche bildende Kunst und Architektur aus fünf Jahrhunderten.
An diesen scheinbar kriegs- und chaosresistenten Werten orientierte sich denn auch, was in jüngsten Jahren an Ausstellungen zum 19. Jahrhundert, speziell zur Zeit des Kampfes gegen NAPOLEONs Europaidee, zur Zeit der 48er Revolution und ihrer Demokratieforderung und zur Gründerzeit mit ihrem Fortschrittsglauben zusammengestellt und von einem überraschend großen Publikum überraschend positiv aufgenommen wurde.
Die auffälligste Tendenz all dieser Ausstellungen lag darin, daß die Ausstellungsmacher sich bemühten, das 19. Jahrhundert als einen Zeitnamen und Datenrahmen zu bestimmen, was ihnen nicht gelingen konnte, weil sie immer noch, um dem Publikum die Orientierung im scheinbar Vertrauten zu erleichtern, Stilbegriffe wie Romantik, Klassizismus, Biedermeier, Naturalismus, Realismus, Impressionismus und Akademismus plakatierten. Für das Deutsche an der Kunst in Deutschland wurde entweder reklamiert, was, wie die Romantik, von Deutschen inauguriert wurde oder aber, was als deutsche Variante französischer, respektive englischer Kunst sich sehen lassen konnte (z.B. als Variante des Impressionismus).
Nur sehr selten konnten in diesem doppelten Sinn ‘deutsche’ künstlerische Leistungen übernationale Geltung erringen. Sortiert man jedoch die raren Spitzenleistungen zum Beispiel der bildenden Kunst in Deutschland zwischen 1804 und 1914 (also der Krönung NAPOLEONS und dem Zusammenbruch des europäischen Staatengefüges) aus, die im Gefolge gesamteuropäischer Entwicklungstendenzen entstanden sind, so bleibt als ein allerdings sehr umfangreicher Restposten übrig, was die gegenwärtig in Frankfurt gezeigte Ausstellung ‘Deutsche Malerei im 19. J ahrhundert’ an Bildern präsentiert.
Man soll sich davor hüten, diesen überständigen Rest, der quantitativ gesehen die größere Partei darstellt, zu schnell als provinziell abzutun.
6.3 Geschichte als Erkenntnis
Es läßt sich nämlich sehr gut begründen, warum wir heute bei unserer Bemühung um die Aneignung der Vergangenheit auf Lebensäußerungen angewiesen sind, die etwas ganz Bestimmtes darstellen, etwas Eingeschränktes, Schmales mit kaum über sich selbst hinausgehendem Geltungsanspruch. Ja, man könnte geradezu sagen, daß uns Geschichte tatsächlich nur in dem konkret vor Augen kommt, was uneinholbar ist; was trotz aller Anstrengung zur Rekonstruktion des Gewesenen als Gegenwart fremd bleibt; und uns so zur Anerkenntnis der historischen Differenz treibt.
Mit anderen Worten, man hat sich leider angewöhnt, bedeutende künstlerische Leistungen von weniger bedeutenden dadurch zu unterscheiden, daß die bedeutenden über Zeiten und Räume hinweg zum Menschen sprechen, als seien sie zeit- und raumgenössisch. Selbst wenn das so wäre, was bezweifelt werden muß, kämen für die Erfahrung von Geschichte eben jene überzeitlich und überräumlich geltenden Werke weniger in Betracht. Denn an dem immer Gegenwärtigen und Immergeltenden läßt sich Geschichte nicht erfahren, soweit man unter geschichtlicher Entwicklung eben nicht nur die Wiederkehr des im Grunde immer gleichen Problembestandes und der immer gleichen Fähigkeit zur Problembewältigung mit allerdings unterschiedlichen Mitteln versteht, sondern die Entstehung von etwas Neuem, anderem und unkalkulierbar Fremdem, das im Verlauf der Zeit zugleich entsteht und untergeht. Auch das ist im Grunde selbstverständlich, da die Vorstellung von durchgängigen Entwicklungstendenzen von vornherein bedeutet, daß bei weitem nicht alles, was in der Zeit entsteht, in die Zukunft mitgetragen wird, worin aber keinesfalls ein Urteil über die Bedeutung des Untergegangenen für die bestimmte historische Situation liegen kann. Geschichte wird zumindest gleichwertig bestimmt von den durchgängigen Entwicklungstendenzen (möglicherweise Entwicklungsgesetzmäßigkeiten) und den konkreten Erscheinungsweisen des Lebens, die ihre Bedeutung als gewesene daraus gewinnen, daß sie nicht in den großen Entwicklungstendenzen aufbewahrt werden; da sie einmalig, unwiederholbar sind. ln diesem Sinne sollten wir uns angewöhnen, mit den überlieferten Lebensäußerungen früherer Individuen und Gesellschaften so umzugehen, daß wir etwas über die historische Distanz erfahren, die uns von ihnen ein für allemal trennt; daß wir sehen lernen, inwiefern nicht alles gleich ist, bloß weil es von konkreten Menschen in konkreten Lebenssituationen geäußert wurde. Wir müssen verstehen lernen, daß Entwicklung eben nicht bedeutet, es setze sich eine vorher programmierte Maschinerie in Gang, die alles auswirft, was es auf der Welt gibt und das demzufolge auch samt und sonders auf gleiche Weise bedingt ist, sondern daß die Entwicklung eine quasi gesetzmäßig ablaufende Veränderung unserer Einstellungen und Handlungen gegenüber dem vorgefundenen Weltbestand darstellt.
Wenn wir von Entwicklung in der Geschichte sprechen, reden wir über unsere Fähigkeit, Zusammenhang und Disparität von Erscheinungen zu erfassen; bei der Entwicklung solcher Konstrukte, man kann auch sagen, bei der Entwicklung von Sinn im Weltgeschehen, unterliegen alle Menschen diesen als einzelnen nicht veränderbaren Gesetzmäßigkeiten, die als Logik der Kommunikation, als Logik des menschlichen Handelns und als die der Naturgesetze beschreibbar sind. Nur diese Logiken, diese Grundbedingungen zur Erzeugung von Zusammenhang und Sinn gelten über das historisch konkrete Phänomen hinaus; aber selbst die gesamte Kultur einer Gesellschaft geht niemals mit ihren konkreten Erscheinungen in diesen Logiken auf. Viel weniger die Werke einzelner Menschen. In diesem Sinne können wir sagen, daß die Bedeutung der Ausstellung darin liegt, daß sie Werke zeigt, die in herkömmlichem Sinn für die künstlerische Entwicklung der vergangenen 200 Jahre mehr oder weniger bedeutungslos sind und die sich gegenüber den großen Entwicklungstendenzen als unbestimmbar erweisen, ja als beliebig, bestenfalls als mehrfach gebrochene Reflexe auf jene. Aber gerade als solche konfrontieren uns diese Werke mit dem, was wir in einem historisch konkreten, d.h. einmaligen und eingeschränkten, also genauesten Sinne als ‘Malerei des 19. Jahrhunderts in Deutschland’ bezeichnen können. Diese Bilder triumphieren gegenüber den generellen Entwicklungstendenzen durch ihre Unbestimmbarkeit.
Unbestimmbarkeit der Bilder gegenüber den generellen Entwicklungstendenzen bedeutet nicht, daß man mit ihnen nichts anfangen kann. Wir müssen mit ihnen eben das bestimmen, was ‘19. Jahrhundert’ tatsächlich war. Wir müssen an ihnen die historische Differenz bestimmen, was insofern schwierig zu sein scheint, als das Fremde ja nicht mehr fremd ist, sobald man mit ihm in bestimmter Weise umgehen kann. Diese Schwierigkeit wurde im 19. Jahrhundert selbst schon verstanden, wenn etwa versucht wurde, eine ‘Ästhetik des Häßlichen’ zu schreiben, was soviel hieß wie die Beschreibung der im damaligen Urteil qualitätslosen Nichtkunstwerke mit genau der gleichen Fähigkeit zur ‘logischen’ (siehe oben) Begründung von Urteilen, wie man sie auf die nach damaligen Kriterien als bedeutsam angesehenen Kunstwerke anwandte. Für uns bedeutet das im einzelnen zu verstehen, warum die Maler beispielsweise sich zwar gegen die akademisch-höfische ‘Mode’-Kunst wandten, sich aber nicht zum Ziel ihrer Tätigkeit die Veränderung sozialer Zustände wählten, was die Wahl ihrer Bildgegenstände (Fabrikarbeit, Armenhaus, Waisenschicksal) nahelegen könnte.
An zwei Bildbeispielen wollen wir unseren Versuch zur Erzeugung der historischen Differenz anlehnen:
6.4 Alles zeichnen: das Chaos der Beliebigkeit
(Adolph MENZEL: Das Balkonzimmer)
Abb. 1 zeigt ein 58 x 47 cm großes Ölbild auf Pappe, genannt ‘Das Balkonzimmer’, das Adolph MENZEL 1845 malte. Ginge man in die Ausstellung mit der Frage “Was haben denn deutsche Maler beigetragen zu den europäischen Entwicklungstendenzen im 19. Jahrhundert?”, so würde dieses Bild als eines der wenigen qualitätvollen Beispiele herausgehoben werden müssen.
Indessen, das Bild ist gar kein Bild, es ist ‘nur’ eine Studie. MENZEL hat eine Unzahl von Studien zu jedem seiner größeren Bilder gemacht, wobei sich selten herausfinden läßt, ob er tatsächlich Studien, d.h. gezielte Formulierungsversuche zu einem Detail eines bereits feststehenden Zusammenhangs, betrieb oder ob ihm einfach aus der Realität ein Formulierungsangebot auffiel, das er dann später mit anderen in einen Zusammenhang komponierte. Man könnte diese beiden Vorgehensweisen unterscheiden als Detailstudie und als ‘Skizze’, die vorläufige Formulierung einer Bildidee. Für MENZEL scheint aber seinem vielzitierten programmatischen Ausspruch “Alles Zeichnen ist gut, alles zeichnen ist besser” zufolge das Problem ganz anders zu liegen. Zwar bekennt er sich nachweislich zur Studie, etwa für seine Illustrationen zur KUGLERschen ‘Geschichte Friedrichs des Großen’ oder zur Vorbereitung großer Gemälde wie dem ‘Eisenwalzwerk’; aber es muß ihm sehr schwer geworden sein, diese Studien abzuschließen und zum intendierten Werk überzugehen, weil ja die Möglichkeiten, Studien für ein Werk zu betreiben, unendlich groß sind, d.h. er hätte über eine prinzipiell unbegrenzte Zeit weiter Studien verfertigen können, ohne jemals zu einem Werk zu kommen, und zwar nicht aus Unentschiedenheit, sondern weil tatsächlich “alles”, was vor die Augen kommt, potentiell studienwürdig ist. Damit wird aber auch der Begriff des Ganzen, des intendierten Werkes fragwürdig, weil ein Werk aus einer der Möglichkeit nach unbegrenzten Anzahl von Detailstudien zusammengesetzt werden könnte; Studien des einzelnen Konstraststrichs in einer farbigen Grundfläche, beispielsweise des Schattens eines Stuhlbeines auf einem abgedunkelten Fußboden. Definitiv gemeintes Werk und die Art seiner Entstehung treten bei MENZEL in einen unüberbnückbaren Gegensatz, der nur kaschiert werden kann unter dem Zwang, Werke produzieren zu müssen. Inhaltlich und formal läßt sich zwischen einem intendierten Werk und einer Studie wie dem ‘Balkonzimmer’ kein Unterschied feststellen.
Wir würden heute ohne weiteres die MENZELschen Studien und Skizzen als komplette Werke ansehen, zumal wenn sie so durchformuliert sind wie das ‘Balkonzimmer’. Ja, wir können uns kaum vorstellen, daß man ein solches Bild nur als kleinen Bestandteil eines größeren betrachten soll. Es gelingt nämlich, die Studie von ihrem formulierten thematischen Aspekt her als fertiges Werk zu verstehen: Ein leichter Luftzug bewegt in einem Zimmer die über die offenstehenden Fensterflügeltüren herabhängenden Voilegardinen; durch das feine Gardinengewebe wird der von außen schwach hereinziehende Wind zu einem gegenständlich ausgrenzbaren Körper, der sich auch als Bestandteil eines Geschehens bemerkbar macht, indem von seiner bewegten Oberfläche Lichtreflexe gebildet werden, die in den Raum abstrahlen.
Für uns wäre das die Schilderung eines Zustandes, den wir im Lauf unserer sommernachmittäglichen Aufenthalte in Balkonzimmern erlebt haben, als wir uns bemühten, die Flügeltüren so zu öffnen und den Faltenwurf der Gardine so zu organisieren, daß der eben geschilderte Zustand eintreten konnte, als etwas Andauerndes, immer Wiederholbares, das, indem wir es organisieren, unsere angenehmen Eigenwahrnehmungen vergegenwärtigbar macht: das Erlebnis, auf dem Stuhl vor den Balkontüren zu sitzen, leicht seitlich so gedreht, daß das Licht auf die Seiten unseres Buches fällt und der Windkörper mit seiner Oberfläche sich zeitweilig um unser ausgestrecktes Bein wölbt.
Uns würde kaum in den Sinn kommen, daß ein in seiner Farbigkeit derart ausgewogenes Bild nur Bestandteil eines größeren sein könnte, in dem eben gerade diese kalkulierte Beziehung von nußbraunen Schattenzonen und windfarbenen Lichtzonen verloren gehen müßte.
‘19. Jahrhundert’ in dem oben beschriebenen Sinn dokumentiert dieses Werk, indem es die völlige Disparität von Teilen und Ganzem darstellt. Denn das Ganze als das Werk kann weder durch das Summieren von Einzelheiten zustande kommen, noch rechtfertigt das Werk jene Manie, alles zeichnen zu wollen. LEIBL hat dieses Dilemma der ‘Malerei im 19. Jahrhundert’ am deutlichsten erfahren, wenn er sich für die Lösung des Problems keinen anderen Rat mehr wußte, als das Werk zu zerschneiden und rückwirkend wieder in lauter Detailstudien aufzulösen (‘Das Mieder’), die wir, voraussetzungslos betrachtet, heute durchaus als komplette Bilder verstehen. Dem Künstler selber aber blieben sie Dokumente seines Scheiterns; eines zwangsläufigen Scheiterns, da aus der Bemühung, die Wirklichkeit zu studieren, resultiert, daß alles Gegenstand dieses Studiums sein kann, weshalb die Einzelstudien gegenüber dem Bildgedanken völlig beliebig werden. Das Chaos der Möglichkeiten wächst in dem Maße, in dem man mit der Erstellung des Bildes voranschreitet. Das ist eine glatte Umkehrung der üblichen Realisierung eines Bildgedankens, bezeichnend für jenes 19. Jahrhundert.
6.5 Joseph und Maria unterwegs: die Welt ist braun
(Fritz von UHDE: Schwerer Gang)
Zu den großen durchgängigen Entwicklungstendenzen wird in Deutschland in der hier in Frage stehenden Zeit durch die Ausweitung des Geschichtsbegriffs und der Fähigkeit, Geschichte zu verstehen, Entscheidendes beigetragen. Das Überraschende, nach obigen Erörterungen aber wohl Einleuchtende ist, daß die bildenden Künstler des 19. Jahrhunderts davon weitgehend unberührt blieben bzw. zu genau entgegengesetzten Auffassungen tendierten, und zwar sowohl im Gebrauch ihrer Gestaltungsmittel wie in der Wahl der Bildgegenstände.
Auf der formalen Ebene werden sie völlig ahistorisch, indem sie aus dem Studium der Werke von REMBRANDT und Frans HALS jene Braunsoßentonigkeit entnehmen, die ihnen die rechte Möglichkeit der Wiedergabe von Farbigkeit der sichtbaren Umwelt zu sein scheint. LIEBERMANN rechtfertigt die Übernahme mit der vermeintlichen Verifikation, die Welt sei eben “braun, grau und einfarbig“. Zwar mag das Leben in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa zu ähnlichen Reaktionen der Wahrnehmung der Umwelt verleitet haben wie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber das Sichtbarmachen dieser Reaktion dürfte nicht über Jahrhunderte hinweg auf gleiche Weise versucht werden, geschweige denn gelingen. Dieses Ahistorischwerden im Zeitalter der Geschichtsschreibung kennzeichnet das 19. Jahrhundert der deutschen Kunst überall dort, wo man nicht in der Lage ist, völlig neue Sehweisen zu entwickeln, wie das die lmpressionisten taten.
Auch in der Wahl der Bildthemen begegnen wir diesem Absacken in Geschichtslosigkeit, etwa, wenn LIEBERMANN den Hamburger Bürgermeister PETERSEN in der Art porträtiert, wie das im 17. Jahrhundert als vorbildlich galt, obwohl LIEBERMANN damit nicht sagen wollte, daß die sozialen Attitüden des Dargestellten und seiner Lebenswelt historisch überkommen seien. Oder wenn Adolph MENZEL den im 18. Jahrhundert lebenden Malerkollegen CHODOWIECKI auf der Jannowitzbrücke darstellt, um MENZELs eigene Art der Konfrontation mit der Umwelt durch Verweis und Übernahme des historischen Musters zu rechtfertigen.
Ein erstklassiges Dokument dieses 19. Jahrhunderts ist Fritz von UHDEs 1890 gemaltes Ölbild ‘Schwerer Gang’ (Abb. 2). Vom Bildvordergrund in die Tiefe des Zentrums verläuft ein unbefestigter, morastiger Weg entlang eines baumbestandenen Grabens, rechts, und eines Zauns bzw. der Fassadenfront dreier Häuser, links. Aus dem Bildvordergrund schreiten in die Bildtiefe ein Mann und eine Frau; die Frau kann sich offensichtlich nur schwer fortbewegen, weshalb sie von dem Mann gestützt und geführt wird. Beide sind nicht gerade stattlich gekleidet; durch das aufgeschulterte Gerät läßt sich der Mann als Tischler identifizieren. Er wendet sich, uns im halbverdeckten Profil sichtbar, der Frau zu, um sie auf einen hölzernen Milchkannentisch am Wegrand zuzuführen. Die Atmosphäre ist düster. Die Darstellung verzichtet auf klare Linien. Es dominieren abgestufte Grau-Braun-Tonwerte.
Nun, an den willkürlichen Umgang mit historischen Konstellationen durch gegenwärtige Theater- und Filmemacher gewöhnt, gelingt es uns auf Anhieb festzustellen, daß hier der Tischler Joseph mit seiner Frau Maria der Niederkunft entgegenzieht: eine rührend naive Aktualisierung von geschichtlichem Geschehen. Kein Betrachter würde daraus eben jene spezifische Aussage zum Heilsgeschehen entnehmen können, die noch Maler des 14. und 15. Jahrhunderts darstellen konnten, auch wenn sie die beteiligten Personen in Kostümen und Örtlichkeiten, die im Stil ihrer Zeit gestaltet waren, darstellten. Das ist schon deswegen verständlich, weil der Künstler selber nicht mehr an die Heilsgeschichte glaubt, bestenfalls noch kritisieren will, daß sich andere der Heilsgeschichte bedienen, um die alltäglichen Daseinsprobleme für prinzipiell gelöst ansehen zu dürfen.
Das heißt kurz, tiefstes 19. Jahrhundert ist es, die Bedeutung von Ereignissen auf ihre Darstellbarkeit zu reduzieren; vor ihnen starr fixiert zu bleiben; wahrzunehmen, ohne zu reagieren. Die Menschen scheinen sich (daraufhin schaue man sich die Porträts der Ausstellung genau an) in einer unüberwindbaren Apathie zu befinden. Die Welt scheint kaum Hintergrund zu haben, wessen sie ohnehin nicht bedarf, da niemand mehr in ihr handelt. Welch ein extremer Gegensatz zu den generellen, internationalen Tendenzen, auch dort, wo diese Tendenzen sich in selbstzerstörerischen Aktivitäten manifestieren, wie sie von GOYA bis ENSOR auffindbar sind.
Die Ausstellung zeigt kaum Stilleben, was dem Besucher nur deswegen auffällt, weil er vermuten könnte, daß die Stilleben im Vergleich zu dieser Galerie von braun eingebackenen Lehmklößen möglicherweise einige Aspekte von Lebendigkeit vermitteln könnten; daß präparierte Bücklinge und angefressene Schinken wenigstens indirekt auf Menschen zu verweisen vermöchten.
Wer dem wirklich unbeschönigten Ausdruck des 19. Jahrhunderts entfliehen möchte, hat im Städel-Museum die Möglichkeit, einige vorzügliche Beispiele jener Kunstäußerungen zu betrachten, die die große Entwicklungstendenz repräsentieren: COURBET, RENOIR, MONET, SISLEY. Wem das nicht ausreicht, um sich in seine bisherigen Vorstellungen vom 19. Jahrhundert zurückzuflüchten, der nehme die am Eröffnungstag der Sonderausstellung erschienene Studienausgabe von Werner HOFMANNs Darstellung des 19. Jahrhunderts zur Hand: ‘Das irdische Paradies’. Man ist dankbar für die neue Auflage von HOFMANNs Werk, da an ihm volle Zustimmung nicht in die Irre geht, in der man unweigerlich landet, wenn man die ihrem Bestand nach so eindeutige Sonderausstellung des Städels unter dem Begriff ‘Realismus’ sieht, wie das von den Ausstellungsorganisatoren, an ihrer Spitze Städel-Direktor GALLWITZ, vorgeschlagen wird.
Irre werden muß man, wenn man im Katalog Äußerungen der Veranstalter liest wie die folgende: “Die gezeigte Auswahl umgreift nur knapp Zweidrittel der Epoche, ist unter dem wie auch immer zu definierenden Stilbegriff ‘Realismus’ ausgewählt worden und hält sich auch beim einzelnen Künstler nur an diesen einen Begriff.” (SCHÜMANN)
Die Frage ist, wie man mit Verweis auf einen Begriff auswählen kann, ohne diesen Begriff zu definieren bzw. wenn es gleichgültig ist, wie man den Begriff definiert. Folgerichtig halten sich die Veranstalter denn auch für entschuldigt, wenn sie den Ausstellungsbesuchern sagen: “So mag denn der Betrachter das Recht für sich in Anspruch nehmen, sich für einen Moment den Argumenten zu entziehen, nur um Bilder zu sehen, einen Ausspruch DÜRERS leicht variiert vor Augen: ‘…was aber Realismus ist, das weiß ich nicht’.” (SCHÜMANN)
Es gibt im gesamten Katalog kein einziges Argument für den Begriff ‘Realismus’, mit dem Bilder ausgewählt wurden, es sei denn die Aussage, die Künstler hätten “die Dinge, wie sie sind, darstellen” wollen.
Die Texte zu den einzelnen Bildem im Katalog sind in ihrer unfreiwilligen Naivität für die Erörterung des Realismus-Problems weiß Gott keine Hilfe; oder sollte das Problem des Realismus damit hinreichend kennzeichenbar sein, daß man Namen von dargestellten Personen mitteilt, noch dazu in einer Formulierung, die selbst dieses einfache Geschäft mißlingen läßt? “Die Dargestellten sind die drei Töchter des Künstlers, am Fenster die älteste Anna, mit der Puppe Amalie, und stehend die jüngste Sophia” (Schreibweise des Katalogs). Das ist der ganze Kommentar zu UHDEs “Kinderstube” von 1889, wobei erwähnt sei, daß sowohl Amalie wie auch Sophia mit einer Puppe spielen und es neben der jüngsten Sophia keine ältere Sophia zu geben scheint.
Solche Fehlleistungen der Ausstellungsmacher sind leider keine entschuldbaren Ausnahmen. Sie werden durch die Entstehungsgeschichte der Ausstellung erklärlich, bleiben aber nichtsdestoweniger inakzeptabel. GALLWITZ war es gelungen, nach dem deutsch-sowjetischen Kulturabkommen die sowjetischen Partner für ein Unternehmen auf Gegenseitigkeit zu gewinnen; da für die Partner offensichtlich der Realismusbegriff in beliebiger Weise zu jeder Art von staatlich tolerierter Kunstäußerung gehört, ob nun vergangener oder gegenwärtiger, wollte GALLWITZ auf jeden Fall demonstrieren, daß auch für uns Bundesdeutsche der Realismusbegriff Tradition hat, indem er eben die von ihm zusammengestellte Ausstellung unter dem Titel ‘Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts’ in Moskau und Leningrad zeigte.
Allerdings kamen die in Berlin beheimateten Realistenwerke gegen die Realitäten des Kulturabkommens nicht an, weshalb die Berliner Bilder für Beispiele jener deutschen Realisten erklärt wurden, auf die man durchaus verzichten könnte. GALLWITZens Katalogaussagen zufolge hätte man eigentlich völlig auf die Ausstellung verzichten müssen, weil, wie er schreibt, es deutsche Realisten in dem Sinne gar nicht gibt, wie er sie als Pendant zu den russischen dennoch ausgewählt hat. Es liegt die Vermutung nahe, daß GALLWITZ im Hinblick auf den sowjetischen Partner das Wort ‘Realisten’ als Lockwort und als Geste der Anpassungsbereitschaft verwendete.
Diese Vermutung ist berechtigt, da der Titel der Ausstellung in Frankfurt in den beliebigen ‘Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert’ verändert wurde. Solches Vorgehen kann nicht gutgeheißen werden, unabhängig von diesem konkreten Fall von Kulturaustausch, da Museumsarbeit völlig ihren Sinn verlieren muß, wenn dem Publikum mit dem Begriff ‘Realismus’ ein Kriterium der Unterscheidung großzügig angeboten wird, dieser Begriff aber sofort wieder kassiert wird mit dem Hinweis darauf, es komme hier gar nicht auf Unterscheidungen an, man könne sich getrost damit zufriedengeben, “Bilder zu sehen”. Es scheint nur ein Interesse zu geben, so mit Werken und Publikum umzugehen, nämlich vorzutäuschen, daß Beteiligung an ‘kulturellem Leben’ möglich sei, ohne sich der Anstrengung der Unterscheidung und der Arbeit des Begriffs zu unterziehen. Kulturfeindlichkeit oder, was aufs gleiche hinausläuft, Unfähigkeit zur Teilnahme an dem, was Voraussetzung verlangt, läßt sich gar nicht schärfer äußern als in der Aufforderung “sich … den Argumenten zu entziehen, nur um Bilder zu sehen”.
Bilder sehen heißt, über die Bilder mit anderen Menschen sich zu verständigen. ja diese Bilder werden geradezu das Medium der Kommunikation. Folgerichtig meldet sich das Verlangen nach Unterscheidungen und bestimmenden Aussagen, sobald das eben noch mit dem Hinweis auf bloßes Sehen herbeigelockte Publikum vor den Bildern steht.
6.6 Realismus als Begriff
Es ist doch klar, daß niemand mit dem Finger auf das zeigen kann, was ‘Realismus’ ist, weil Realismus eben nur ein Name ist für einen konstruierten Zusammenhang und Sinn, den man in der oben angedeuteten Weise bei der Konfrontation mit Lebensäußerungen von Menschen entwickelt. Sinnvolle Aussagen zum Problem ‘Realismus’ gibt es, wobei es keine Rolle spielt, daß diese Vorschläge zur Verständigung sich widersprechen. Sie erfüllen aber ihre Aufgabe, daß wir uns über Sachverhalte verständigen können, wenn wir unter wechselseitiger Anerkennung grundlegender Regeln (‘Logiken’) der Kommunikation den Begriff verwenden. Dabei ist es wenig sinnvoll, wenn auch durchaus möglich, völlig willkürlich den Begriff einzuführen.
Die Chance der Verständigung steigt, wenn wir in unser Bemühen auch die Aussagen von Menschen einbeziehen, die vor uns über dieses Problem nachgedacht haben. Versuchen wir kurz, dem Katalog einige Unterscheidungen zum Realismus-Begriff nachzutragen: In unserer unmittelbaren kulturellen Tradition beginnt eine sinnvolle Vorgabe in der Philosophie des späten Mittelalters, für die das Realismus-Problem das wichtigste aller philosophisch-theologischen Probleme darstellte. Danach galten als Realisten diejenigen, die an die reale Existenz von Abstrakta wie Gott, Liebe, Schönheit usw. glauben. Auf die bildende Kunst hin gesprochen hieße das: Realisten wären diejenigen, die die künstlerischen Darstellungsweisen, Sehweisen, für eine eigenständige Realität gegenüber dem Dargestellten ansehen. Wer die Abstrakta, wer die künstlerischen Stile und Auffassungsweisen nur für etwas willkürlich Erfundenes hält, nur für Markennamen oder Unterscheidungssignale, ist nicht Realist, sondern Nominalist.
Im 19. Jahrhundert ist trotz gegenteiliger Aussagen von KANT unter Berufung auf KANT dieses Verhältnis umgedreht worden, wobei nunmehr die alten Realisten als ldealisten bezeichnet wurden, die Hirngespinste und Spekulationen für real existierende Dinge nähmen, während die alten Nominalisten, die sich der Begriffe und Auffassungsweisen immer nur als ganz willkürlich gewählte Unterscheidungsnamen bedient hatten, als Realisten bezeichnet wurden, die sich kein X für ein U vormachen ließen; die die Wirklichkeit darstellten, wie sie sei, unabhängig von Benennungen und Markenetiketten.
Diese Auffassung ist von allen beteiligten Wissenschaftlern als völlig unhaltbar bewiesen worden, insofern nämlich, als kein Mensch auch nur auf die Realität verweisen könnte ohne Zuhilfenahme von Sprachen, seien es nun Wort-, Bild- oder Tonsprachen. Es mag eine Wirklichkeit jenseits unseres menschlichen Bezuges auf sie zwar geben, wir können aber über sie nichts aussagen. Da es aber sinnlos ist, in einer Welt zu leben, auf die man sich nicht beziehen kann, bleibt nur, als Wirklichkeit eben jene Einheit von gegenständlich realer Welt und unserer Art der Beziehung auf diese Welt zu sehen. Dann kann man auch sinnvollerweise von unterschiedlichen Wirklichkeiten sprechen, weil Menschen sich in unterschiedlichen Lebensumgebungen, historischen wie gegenwärtigen, in unterschiedlicher Weise auf die Welt beziehen. Allerdings wird uns alltäglich klar. daß die Welt nicht einfach dadurch eine andere wird, weil wir sie anders bezeichnen. Es bleibt also nach wie vor zu unterscheiden zwischen dem, was die Welt ist, und unseren vielfältig sich entwickelnden Sprachen und anderen Instrumenten der Weltaneignung.
Die moderne Kunstwissenschaft hat diese Auffassung nachdrücklich widerlegt. Zusammengefaßt ist heute etwa so zu definieren: Es ist sinnvoll, jemanden als Realisten zu bezeichnen, der mit seiner Arbeit ständig darauf verweist, daß die Welt und unsere Aneignungsformen nicht dasselbe sind. Ein Maler, der also sich zur Aufgabe macht, einen bestimmten Stil oder, besser, seine bestimmte Sehweise zu entwickeln, ist Realist, wenn er zeigt, worin der Unterschied zwischen seiner bestimmten Sehweise und anderen liegt. In diesem Sinn sind Künstler wie Caspar David FRIEDRICH oder SEURAT als Realisten zu bezeichnen, da ihre Arbeit der demonstrativen Unterscheidung zwischen Abbild und Abgebildetem, zwischen Dargestelltem und Darstellung, zwischen Zeichen und Bezeichnetem gilt.
Die in Frankfurt gezeigten Künstler bilden zwar ab, was für sie Wirklichkeit ist; das aber tut schließlich jeder Künstler, insofern seine Werke Vergegenständlichungen dessen darstellen, was für ihn die Wirklichkeit ist. Realisten sind diese Künstler deshalb noch nicht. Sie verstanden sich auch nicht als solche trotz Darstellung von Fabrikarbeitern und Armenhäuslern.
Wenn man sagte, Realist sei, wer das Leben der Menschen ohne Beschönigung und ohne Verstellung einfach so darstelle, wie es nun mal ist, kommt in die Schwierigkeit, dieses “das Leben, wie es nun mal ist” wiederum mit Zeichen, mit Ausdrucksmitteln bestimmen zu müssen. Er würde auch wiederum nur sprachlich vermittelt auf “das Leben, wie es ist” hinweisen können. Womit sich für ihn wiederum das Problem der Darstellung, d.h. der Unterscheidung zwischen Zeichen und Bezeichnetem, zwischen Bild und Abgebildetem ergibt. Wer fordert, das Leben so darzustellen, “wie es ist”, müßte ein Idealist genannt werden, da er es für möglich hält, die Welt jenseits unserer sprachlichen und instrumentellen Aneignungsweisen erfassen zu können.