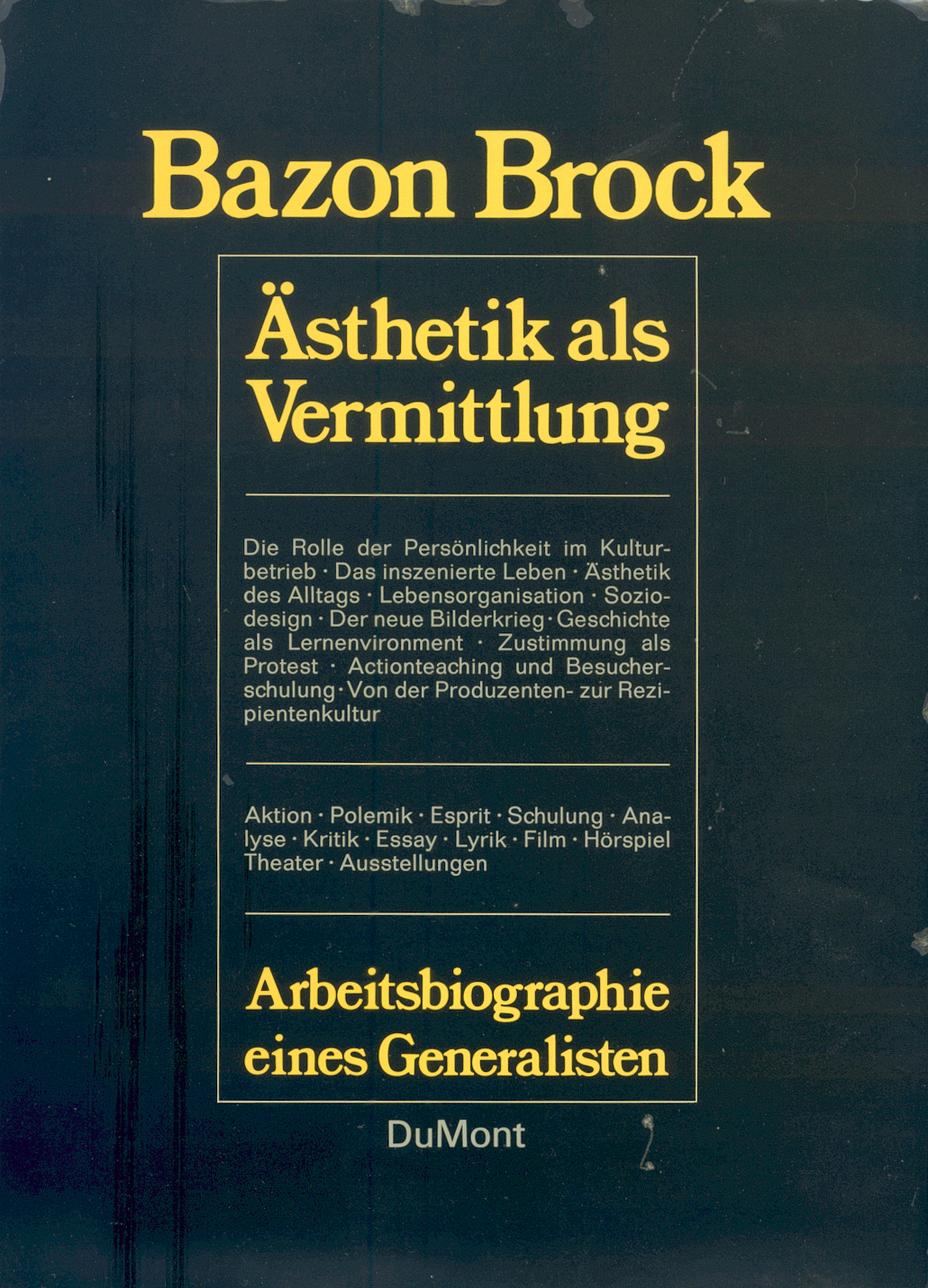Funksendung für den Sender Freies Berlin, 1974. Der 1. Abschnitt ist allgemeiner Natur, der 2. Abschnitt, der sich auf eine Aufführung von EURIPIDES' ‚Backchen‘ an der Berliner Schaubühne am Halleschen Ufer bezieht, erschien auch im Sonderheft THEATER HEUTE, 1974.
7.1 Begründete Vermutungen über den Versuch, ein geschichtliches Vorbild der bürgerlichen Gesellschaft erneut sich anzueignen
Etwas Bedenkenswertes geht vor: die griechische Antike stößt vermehrt auf das nachhaltige Interesse von jungen Künstlern, Theatermachern, Literaten und Wissenschaftlern.
Dieses Faktum ließe sich aus der allgemein zu beobachtenden Zunahme des Interesses für die antike ‚Geschichte‘ erklären, wäre nicht in allen neueren Beispielen der Hauptgesichtspunkt des Interesses so eindeutig vom Begriff des Ästhetischen geprägt. Auch ein so dezidierter historischer Materialist wie Friedrich TOMBERG, dessen vor einiger Zeit veröffentlichte Arbeit über griechische Polis und Nationalstaat wir anschließend noch etwas ausführlicher beiziehen wollen*, verzichtet nicht, kann offensichtlich nicht darauf verzichten, in die Analyse der aristotelischen Polis-Theorie den Begriff des Ästhetischen einzubeziehen: nicht etwa, weil ARISTOTELES' Text das erzwingen würde, sondern weil sich damit ein Fluchtpunkt der vergleichenden Analyse historisch späterer Gesellschaftsformationen ergibt. Als ästhetische Leistung und Funktion der Künste wird dabei allgemein angenommen, was man heute mit einer Formulierung von Rudolf ARNHEIM als „Sichtbarmachen der Welt“ bezeichnen könnte. Auch wenn in den historischen Gesellschaften jeweils nur eine, mehr oder minder umfangreiche Gruppe von Menschen direkt mit ästhetischen Vergegenständlichungen dessen, was die Welt und das gesellschaftliche Leben jeweils zusammenhielt, konfrontiert war, also tatsächlich die Orientierung in der Lebenswelt als ganzer nicht anhand von ästhetischen Vergegenständlichungen vorgenommen wurde, so scheinen doch, wenigstens rückblickend, aus dem Bereich des Ästhetischen Aussagen über Totalitätsvorstellungen jener Gesellschaften entnehmbar zu sein.
Wie es sich damit nach meiner Auffassung bei den Griechen des 5. Jahrhunderts, des Goldenen Perikleischen Zeitalters, verhält, soll nachher dargestellt werden. Hier nur soviel: auf keinen Fall läßt sich der Begriff des Ästhetischen auf jene Gesetze des Schönen reduzieren, die MARX als gleichsam überzeitliche Bestimmungsgrößen unserer Orientierung in der Welt ansah. MARX mußte diesem Argument so große Bedeutung beimessen, weil er sonst überhaupt nicht hätte erklären können, wieso denn bei radikal veränderten ökonomisch-politischen Lebensbedingungen eine klassische griechische Tragödie oder eine Statue über zweitausend Jahre hinweg noch rezipierbar seien, und zwar als Ausdruck des Schönen.
Die Erklärung, daß MARX selbst noch zu sehr in der bürgerlich-humanistischen Bildungstradition gestanden habe und ihm deshalb gleichsam am Rande noch Relikte dieser Tradition mit untergerutscht seien, ist oberflächlich. Er sah sich vielmehr einem für seine Theorie nicht erklärbaren Problem gegenüber, das in seiner Zeit am besten und radikalsten durch die Sprachwissenschaften vorgetragen wurde: bei der Untersuchung der indogermanischen Sprachen beispielsweise hatte sich herausgestellt, daß es offensichtlich Gesetze der Sprachentwicklung gibt: z.B., jedermann aus Schulzeiten verhaßt, das Gesetz der Lautverschiebung. Diese Gesetze ließen sich beim besten Willen nicht mit der MARXschen Theorie in Übereinstimmung bringen. (Wie bohrend dieser Widerspruch nach MARX und eigentlich bis auf den heutigen Tag blieb, zeigt die Tatsache, daß selbst STALIN sich als Sprachtheoretiker versuchte, obwohl es, weiß der Teufel, wichtigere Probleme für ihn gab als die Sprachtheorie.)
Schon zu Lebzeiten von MARX gab es Hinweise auf die Frage, ob nicht auch für die Ausdrucksformen der bildenden Kunst solche Entwicklungsgesetzmäßigkeiten anzunehmen seien, wie sie für die Wortsprachen entdeckt worden waren; MARX nannte sie die Gesetze der Schönheit, nach denen der Mensch eben auch formiere. Auch, sagte MARX – ohne indessen angeben zu können, welches Gewicht diesen Gesetzen im Vergleich zu denen der ökonomischen Formation zukomme.
Das heute verstärkt zu beobachtende Interesse an der Kunst der griechischen Antike, vor allem an der klassischen Zeit, könnte dadurch erklärt werden, daß die Autoren annehmen, in jener Kunst hätten sich diese Gesetze der Schönheit besonders eindeutig und durchgehend zur Geltung gebracht. Diese Auffassung geht weit in die Geschichte der Kunstgeschichte zurück, wenigstens aber bis zu WINCKELMANN. Dabei fällt WINCKELMANNs Irrtum, hellenistische, also spätgriechische Kunst für die Kunst der griechischen Klassik zu halten, kaum ins Gewicht. Entscheidend ist, daß sich für WINCKELMANN aus dem Material eben jene Gesetzmäßigkeiten des Schönen abzuleiten schienen, die dann für Künstler als normative Ästhetik, als eine eindeutige Handlungsanleitung künstlerischen Arbeitens zu gelten hätten. Die griechische Kunst wurde gleichsam zum Urmeter aller Urteile über das Schöne.
Interessanterweise entwickelte WINCKELMANN diese Auffassung zur gleichen Zeit, als etwa BAUMGARTEN und MEYER in genau entgegengesetzter Weise sich auf griechische Vorstellungen von der Kunst beriefen, nämlich auf Ästhetik als aisthesis, als Wahrnehmung.
Selbst wenn man annimmt, daß BAUMGARTEN und Nachfolger anstelle des „Gesetzes der Schönheit“ nur das „Gesetz der Wahrnehmung“ einführten, ist das doch eine entscheidende Erweiterung insofern, als sie immerhin Entwicklungsgesetze der Wahrnehmung annahmen und vor allem Bedingungen für diese Entwicklung, d.h. sie sahen die griechische Kunst nicht als höchste Entfaltung der Gesetzmäßigkeiten, sondern als eine unter anderen. Wie sich historisch die Wahrnehmungsmöglichkeiten veränderten, so änderten sich eben auch die künstlerischen Vergegenständlichungen dieser Wahrnehmung.
Die HEGELsche Ästhetik hat diesen BAUMGARTENschen Ansatz leider völlig zurückgedrängt und zudem noch ins Gegenteil verkehrt. Da MARX im wesentlichen von HEGELschen Überlegungen ausging, blieben für ihn Gesetz der ökonomischen Formation und Gesetz der Schönheit beziehungslos, ja eigentlich widersprüchlich.
Darüber hinaus haben HEGEL und MARX die Entwicklung der Gesellschaften im vorderasiatischen und europäischen Raum als exemplarisch für alle menschlichen Gesellschaften aufgefaßt, was bei den heute vorliegenden Kenntnissen über afrikanische, indische, indianische und fernöstliche Gesellschaften nicht mehr vertretbar ist.
Wer sich heute der griechischen Kunst zuwendet, um gleichsam eine weitere Lücke im Weltbild von MARX zu schließen, also die Gesetze der Schönheit näher zu bestimmen, wird sich mit den Gesetzen der Wahrnehmung und ihren Vergegenständlichungen befassen müssen. Die Antworten indes, die ihm von der Wahrnehmungsforschung erteilt werden, sind kaum geeignet, den konstatierten Widerspruch bzw. die Unvereinbarkeit von Gesetz der ökonomischen Formation und Gesetz der Wahrnehmung aufzuheben.
Auf die Entwicklung der griechischen Kunst bezogen, sind die fatalsten Ungereimtheiten die folgenden: wie hat es zu einer so ungeheuer beschleunigten Entwicklung der Kunst kommen können, wie man sie für die wenigen Jahrzehnte zwischen 480 und 430 in Attika nachweisen kann? Selbst wenn man annimmt, daß die Siege über die Perser und die Verfügung über die Bundeskasse den Athenern günstige Startchancen zur Entwicklung der Volkswirtschaft gaben, würde das bestenfalls verstehbar machen, daß sich die Entwicklung beschleunigen konnte, würde aber nicht erklären, warum diese Entwicklung in genau die Richtung gegangen ist, die wir anhand der überlieferten Zeugnisse zu kennen glauben. Im übrigen ist diese Entwicklung gar nicht so eindeutig und geradlinig, also nicht eindeutig beziehbar auf die ökonomische Grundgegebenheit. Und es waren bei gleicher Ausgangslage, gleicher Klassenzugehörigkeit und gleicher Parteienzugehörigkeit nicht alle Individuen gleichermaßen von dieser Entwicklung erfaßt (als Künstler nicht und nicht als Literaten-Philosophen – und schon gar nicht als Heerführer, Politiker, Mediziner).
Kurzum, die Sache liegt in argem Dunkel, wenn man ökonomische und ästhetische Entwicklung zueinander in Parallele setzen will. Die einleuchtendste Erklärung für die Entwicklung der ästhetischen Produktion in der klassischen Zeit erhält man, skandalöserweise, wenn man annimmt, daß für jenen Zeitraum ökonomische und ästhetische Entwicklung mit Anstrengung und willentlich voneinander abgekoppelt wurden; daß die ästhetischen Findungen und Setzungen in Schulbildungen und lokaler Zentrierung absichtsvoll, ja bewußt verselbständigt wurden – weshalb sie noch etliche Jahrzehnte den Untergang der klassischen Polis überleben konnten, ja eigentlich sogar sich immanent folgerichtig weiterentwickelten.
Verselbständigung des Ästhetischen gegenüber der ökonomischen, ja sogar politischen Entwicklung hieße, daß in jenen Jahren eine hohe Immanenzbildung statthatte, daß also die verschnellte Entwicklung der bildenden Kunst sich der Möglichkeit verdankt, innerhalb der künstlerischen Praxis in verstärktem Maße bloß ästhetische Problemstellungen zu berücksichtigen.
Wie gesagt, diese Erklärung kommt einem Kopfstand gleich, obwohl bei dem auf dem Kopf Stehenden weiterhin der Kopf oben bleibt und nicht nur deshalb schon mit den Füßen gedacht wird, weil sie sich oben befinden. Aber: läßt sich nicht in dieser Lage ganz gut begreifen, warum wir uns derart interessiert zeigen an den griechischen Zuständen von Kunst und Leben im Goldenen Zeitalter? Treibt uns da nicht die Vermutung, in der Zeit der klassischen Polis hätten wir eben ein Beispiel für die völlige Übereinstimmung der ökonomisch-politischen mit den Formen des Bewußtseins? Für das Leben in der Polis ginge unsere Erklärung noch auf? Und hieße das nicht, daß das MARXistische Axiom von der Korrespondenz zwischen Sein und Bewußtsein im Grunde von uns gar nicht als Bestandteil der Erklärung historischer Entwicklungen verstanden wird, sondern als Ziel, als erst zu erreichende Voraussetzung für ein befriedetes Leben? Denn seiner Daseinsbedingungen völlig bewußt zu sein, also keinerlei Ideologien mehr zu verfallen, ist doch erst der Beginn der sozialen Freiheit, die Voraussetzung für planvolles Handeln aller. So wäre die Forderung, Kunst habe die Welt sichtbar, lesbar, verstehbar zu machen, erst sinnvoll.
Wer aber diese Forderung gerade in der griechischen Klassik für erfüllt ansieht bzw. sich von der Vermutung treiben läßt, damals sei sie erfüllt gewesen und verdiene deshalb unser Interesse, der geht völlig an den empirisch erschließbaren Aussagen über das Goldene Zeitalter vorbei. Und zwar nicht nur dann, wenn er sich, wie TOMBERG, an die Analyse der Polis macht, indem er aristotelische Texte studiert. ARISTOTELES geht mit der wenigstens achtzig Jahre vor seiner Zeit bereits zugrunde gegangenen klassischen Polis um wie TOMBERG mit ARISTOTELES. Das ist rationalisierende Philosophie über den Gräbern falscher Hoffnungen, nachträgliches Erklären des Scheiterns; wobei so getan wird, als ließe sich aus dem Scheitern erst das richtige Verständnis entnehmen, als eine normative Theorie für den Wiederholungsfall, der aber der gleichen Auffassung zufolge niemals eintreten kann. Warum dann also eine Theorie der Polis durch ARISTOTELES, nachdem es keine Polis mehr gab und geben konnte? Friedrich TOMBERG verfährt ganz aristotelisch, wenn er sagt: „Nun ist es zwar nicht so, als ob ARISTOTELES die ökonomischen Determinanten nicht gesehen hätte, die Ebene, auf die er alle Bestimmungen rückbezieht, ist aber von vornherein schon die politische. Wir mußten daher die aristotelische Theorie, bevor wir sie transformierten, schon historisch-materialistisch ergänzen, um feststellen zu können, ob und in welchem Maße sich die von ARISTOTELES selbst herangezogene Realität in seinen Gedankengängen widerspiegelt. ARISTOTELES war natürlich, trotz seiner überragenden Denkkraft, an die Schranken gebunden, die dem griechischen Stadtbürger der antiken Epochen durch den Verstehenshorizont der Zeit gesetzt waren. MARX hat diese Schranken sehr genau bezeichnet.“**
Ja, du liebe Logik, ist denn MARX nicht an solche Schranken gebunden, die selbst überragende Denkkraft nicht zu überschreiten vermag? Und dann erst wir und TOMBERG, die wir nicht über solche Denkkraft verfügen!
Wie aber sind dann die Aussagen einzuschätzen, die MARX oder TOMBERG oder gar unsereiner über den beschränkten Verstehenshorizont des ARISTOTELES machen? Was sind dann diese Aussagen wert, wenn auch MARX trotz seiner überragenden Denkkraft beschränkt ist? Wieso sind dann die Überlegungen des ARISTOTELES zu einer idealen Polis anders zu bewerten als die Überlegungen von MARX zur kommunistischen Gesellschaft? Und die Überlegungen von ARISTOTELES werden in ihrem Beharren auf Sklavengesellschaft und Klassengesellschaft als Voraussetzungen für die Autarkie des Polislebens von TOMBERG nachdrücklich auseinandergenommen. Kommt man dadurch aus der Beschränktheit der Verstehensschranken heraus, daß man den Fehler von ARISTOTELES und allen seinen Nachfolgern in der Staatstheorie vermeidet – das hieße also schlicht, wenn man sich nicht auf die Gegebenheiten der historischen Zeiten einläßt? lst man aus der Beschränktheit heraus, wenn man also an die Stelle der Sklaven Maschinen setzt und an die Stelle der Klassenmitglieder die nur von ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten motivierten Klassenlosen?
Zumindest die MAOistischen Chinesen scheinen das zu meinen. Sie polemisieren zwar immer mal wieder gegen altzeitliche Philosophen, sind aber dennoch gute Aristoteliker, gehören also in die Gruppe derer, die sich auffällig für das antike Griechenland interessieren. Mir scheint, den Aussagen zufolge, die ich zum heutigen Zustand des Lebens in China kenne, als praktizierten sie genau das, was sich ARISTOTELES in seiner Beschränktheit so ausgedacht hat. Zumindest die Grundforderungen an das Polisleben sind Bestandteil der chinesischen sozialen Organisation: nämlich Autarkie, Koinonia und Polis – oder auf chinesisch:
– erstens Selbstversorgung und Selbstgenügsamkeit der Ziele menschlichen Lebens bzw. des Glücks, das eben nicht jeweils wieder auf die Frage gespießt werden kann, was denn Glück sei außer Selbstgenügen;
– zweitens Koinonia, auf chinesisch: in der Gesellung mit anderen vermag ein Mensch sich menschlich zu verhalten, zu äußern, entwickelt er Gefühl und Sinnlichkeit, Phantasie und Energie;
– drittens Polis, chinesisch Kommune: nur in bestimmten Organisationsformen des sozialen Lebens sind Unabhängigkeit von der Willkür anderer und Selbstevidenz der höchsten Ziele garantiert und die Möglichkeiten gegeben, menschliche Gefühle, Vorstellungen und Tatkraft zu entwickeln.
ARISTOTELES und die Chinesen nehmen an, daß eine solche Polis-Kommune nur eine beschränkte Zahl von Mitgliedern haben darf, damit sie sich untereinander kennen, Belastbarkeiten und Fähigkeiten kennen, die Ausübung der Ämter nach dem Gesetz kontrollieren können, d.h. feststellen, ob eine Krisis herrscht, ob also gerichtlich entschieden werden muß, worüber die Auffassungen auseinandergehen (wir sollten uns doch diese Auffassung von Krisis als Bedürfnis nach einer gerichtlichen Entscheidung merken).
ARISTOTELES und die Chinesen nehmen also nicht an, daß alle eines Bewußtseins sind, da für alle die gleichen ökonomischen Daseinsbedingungen herrschen; und sie nehmen auch nicht an, daß sich je die Beschränktheiten überhaupt aufheben lassen werden, da es immer die Zeithorizonte geben wird. Vor allem meinen ARISTOTELES und die Chinesen nicht, daß bestimmte ökonomische Formationen zwangsläufig bestimmte politische Organisationsformen bedingen, daß man also eine autarke, koinonistische Polis, eine sich selbst versorgende, höchsten menschlichen Lebenszielen, dem menschlichen Glück verpflichtete Kommune auch jenseits rein agrarischer Gewinnung von Lebensmitteln verwirklichen kann.
Ich sage, die Chinesen glauben das, wie ARISTOTELES das geglaubt hat – glauben heißt dabei durchaus, etwas mit ganz rationalen Begründungen für sinnvoll zu halten. Denn was sinnvoll ist, das läßt sich nicht wissen, sondern glauben. Die Differenz an Verbindlichkeit, die wir so leichthin zwischen Wissen und Glauben zu sehen geübt sind, ist ein Konstrukt: schließlich muß auch ein Mathematiker glauben, daß er von seiner Haltung als Wissenschaftler nicht ablassen darf, wenn er Pressionen ausgesetzt ist – schließlich muß auch ein MARXist glauben, daß es besser ist, daß Menschen eher zu essen haben sollten als zu verhungern: wissen kann man das nicht. Es ist sowieso das Überzeugendste an MARXisten, daß sie ‚das Glauben‘ zeigen, indem sie diesem Glauben entsprechend sich verhalten, indem sie Zeugenschaft ablegen (hoffentlich ohne Märtyrer zu werden, aber wenn es nicht anders geht, auch das ganz so, wie ARISTOTELES es fordert und wie vor ihm die tatsächlichen Mitglieder der klassischen Polis es geleistet haben, und nach ihnen die frühen Christen).
Und das scheint mir einen weiteren Grund abzugeben für unser gewachsenes Interesse an der griechischen Antike: wenn auch die Menschen sich damals objektiv über ihre gesellschaftliche Lage täuschten, waren sie doch bereit, das letztmögliche Argument in den Entscheidungen über menschliche Angelegenheiten tatsächlich zur Geltung zu bringen: das Opfer des Lebens für die Polis – eben nicht für Volk und Führer, nicht für die Zukunft und den Reichtum, nicht für die Weltherrschaft. Jedermann wurde danach eingeschätzt, in welchem Umfang er für dieses letzte Argument einstand.
Eine gute Einschätzung war zugleich der höchste Lohn, den man vom Leben in der Polis erwarten konnte, und zwar, das ist entscheidend, über den Tod hinaus. Solange die Lebenden selber noch täglich den Toten jenen Dank abstatteten, waren die Lebenden bereit, ihren Glauben zu dokumentieren.
Aus dieser Auffassung des Totenkults haben noch die Römer entscheidende Motivationen für das Durchstehen der schlimmsten Anforderungen an ihre Leistungsfähigkeit bezogen, obwohl sie nicht das Polisideal verfolgten; nach den Zeiten des CINCINNATUS ging die Selbstevidenz der höchsten Ziele verloren. Ich weiß übrigens nicht, was für einen Totenkult die aristotelischen Chinesen haben. Wahrscheinlich haben sie den familiären Ahnenkult den kommunalen Lebensformen entsprechend erweitert.
Wenn ich eingangs sagte, daß die heute an der griechischen Antike Interessierten deutlich auf den Begriff des Ästhetischen verweisen, dann würde das hier heißen: Sichtbarmachen der Beziehung zwischen den Mitgliedern der Polis im Ritual, im Grabmal, Denkmal, Tempel – obwohl wir wissen, daß die Entwicklung etwa der dorischen, jonischen und korinthischen Ordnungen am Tempelbau nicht aus prinzipiell veränderten Einstellungen zu den Mitmenschen ableitbar ist: die Ordnungen haben sich nämlich nicht logisch folgerichtig auseinander entwickelt, sondern nebeneinander bzw. ohne Verweis aufeinander.
Mit diesen Vermutungen über das anwachsende Interesse an der griechischen Antike befinden wir uns in der Tradition des Bürgertums und seiner Antikenrezeption. Gesetz der Schönheit, bei den Griechen am höchsten entfaltet und damit verpflichtend, hieß die erste Begründung.
Kulturelle Zeugnisse für die Entwicklung unserer Wahrnehmungsformen, aisthesis, hieß die zweite Begründung.
Ästhetische Vergegenständlichung der idealen Polis in der Einheit von Autarkie und Koinonia, hieß die dritte Begründung.
Wie sieht die Aneignung der Antike in gegenwärtiger künstlerischer Praxis aus? Das spektakulärste Beispiel liefert in diesen Monaten die Schaubühne am Halleschen Ufer mit der Aufführung ihres ‚Antikenprojekts‘.***
7.2 ‚Antikenprojekt‘: Die Hybris beim Umgang mit historischem Material
(Die ‚Bakchen‘ des EURIPIDES an der Berliner Schaubühne)
Ich muß mich zurückhalten, wenn ich die Arbeit einer Gruppe anhand zweier Aufführungen beurteilen will, in denen selbstverständlich nur ein Bruchteil der mühevollen und langanhaltenden Vorbereitung sichtbar werden kann. Und ich muß zurückhaltend sein, weil die generellen Aussagen zur Tätigkeit anderer immer auch auf die eigene anwendbar sein sollten.
Wenn ich behaupte, daß die Antikenrezeption der Schaubühne uns dazu zwingt, die künstlerische Praxis der Schaubühne auf ihre Voraussetzungen und Ziele hin zu befragen, dann ist damit gesagt, daß ich mich selbst von einer solchen Befragung nicht ausnehmen kann. Wenigstens ein gemeinsames Ziel läßt sich angeben, das für alle künstlerische Praxis gelten kann: wir wollen die Adressaten unserer Aktivitäten, das Publikum, in Handeln und Verhalten beeinflussen, und zwar so, daß die Adressaten größere Handlungsfähigkeit und Verhaltensdifferenzierung gewinnen. Dabei gilt, daß das Ziel der Beeinflussung dann annähernd erreicht ist, wenn die Beeinflußten in der Lage sind, sich selbst genau den Urteilsformen und Auffassungsweisen zu unterwerfen, die sie anderen Menschen in ihrer unmittelbaren oder mittelbaren sozialen Umgebung gegenüber anwenden. Erst in der Beförderung dieses Ziels hat künstlerische Tätigkeit unmittelbare gesellschaftliche Wirkung.
Jede Verständigung und jede Gemeinsamkeit im Handeln ist von solchen wechselseitigen Vorgaben abhängig. Man kann diese Vorgaben als Erwartungen bezeichnen. Künstlerische Praxis, beispielsweise das Theater, arbeitet mit den Erwartungen des Publikums, wodurch die Erwartungen selber verändert werden können. Heruntergekommenes Theater düpiert bloß die Erwartungen des Publikums: die Theaterarbeit wird gänzlich sinnlos, wenn das Publikum infolge solcher Düpierung überhaupt keine andere Erwartung an das Theater mehr hat als amüsante Erwartungstäuschung.
Daß einige, bloßen privaten Verwurstungsinteressen folgende Kritiker durch das ‚Antikenprojekt‘ „alle Vergleiche aus dem Feld geschlagen“ sehen, heißt schlicht: sie haben keine Vergleichsmaßstäbe und keine Fähigkeit zum Vergleichen. Diese Kritiker sind bereits theatergeschädigte Zuschauer, weil sie vom Theater nur noch die Sprengung von Erwartungen verlangen können. Die Logik der Sache ist doch, daß etwas „jeden Vergleich Sprengendes“ gar nicht als solches erkannt werden könnte ohne Vergleich.
Die Mitglieder der Schaubühne haben beispielhaft für viele Kollegen immer darauf bestanden, daß das Theater selber Erwartungen auszubilden hat, die als Korrektiv gegen die zerstörerische Praxis bloßer Erwartungstäuschung anzusehen sind. Eindeutige künstlerische Positionen zu vertreten, heißt, sich selber auf die Vorgabe von Erwartungen festzulegen. Auf die vollständige Erfüllung der Selbstfestlegung kann niemand pochen, weil sie auch von Bedingungen abhängt, über die wir nicht nach Wunsch verfügen können. Deshalb sind unser aller Handlungen nicht in erster Linie nach den Handlungsresultaten zu beurteilen, sondern danach, wie konsequent wir uns an unsere eigenen Erwartungsvorgaben halten. Sowohl an der Vorgabe wie an der Konsequenz ihrer Befolgung scheint es uns heute in einem Maße zu mangeln, daß wir in Gefahr geraten, die Möglichkeit völlig zu verspielen, auf das Handeln und Verhalten von Menschen außerhalb der Kunstpraxis noch einzuwirken. Wir haben unsere Bereitschaft, die Voraussetzung für Verständigung und Handeln mit anderen vorzugeben, einer unnachsichtigen Kritik zu unterwerfen. Wie wir tatsächlich miteinander umgehen, widerspricht in eklatanter Weise dem selbstbewußt zur Schau gestellten Ziel.
Eine solche Kritik läßt sich am ‚Antikenprojekt‘ der Schaubühne ansetzen. Denn da die Mitglieder der Schaubühne besonders befähigte Theatermacher sind und sich Arbeitsbedingungen geschaffen haben, die im weitesten Sinn als beispielhaft angesehen werden, haben die Aktivitäten der Schaubühne Signalcharakter für die Kunstpraxis. Es wird uns allen mit dem ‚Antikenprojekt‘ nichts Freundliches signalisiert.
Denn das ‚Antikenprojekt‘ zeigt: wir plündern bedenkenlos die Arbeiten anderer aus; wir verfahren in totaler Willkür mit dem, was wir aus der Entstehungsgeschichte unserer Gesellschaft und ihres Selbstverständnisses, aus den Erscheinungsformen der Natur und der Geschichte der Menschen als etwas Objektives herausarbeiten müßten, um dem Chaos des Bedingungslosen zu entkommen. Wenn dieses Verfahren gerechtfertigt sein soll, weil es den Praktiken der bürgerlichen Gesellschaft entspreche, und wir diese Praktiken zu kritisieren vorgeben, indem wir sie ‚nachvollziehen‘, so leugnet diese Rechtfertigung bewußt die tatsächlichen Leistungen der bürgerlichen Kultur; Leistungen, wie sie die bürgerliche Kultur beispielsweise mit der Begründung der Geschichtswissenschaft erbracht hat.
Chaos des Bedingungslosen, also Willkür der Schaubühne wird sichtbar, wenn wir den im Programmheft dokumentierten Umgang mit der Archäologie, der klassischen Philologie, der Theater- und Kulturgeschichte einer Stichprobe unterziehen. Das Schaubühnenteam kennzeichnet seinen Umgang mit wissenschaftlichem Material als „Suche nach Anregung“. So wird BURKERTs ‚Homo necans‘ einer weitergehenden Benutzung als dem bloßen Abgrasen nach Anregungen nicht für würdig gehalten, weil „BURKERT seine Argumentation immer wieder mit Hilfe fragwürdiger Analogien aus der Verhaltens- und Aggressionsforschung“ absichere. Solche Analogiebildung aber wird von dem Schaubühnenkollektiv geradezu als Aufgabenstellung ihrer eigenen Arbeit bezeichnet. „Der Zuschauer muß gezwungen werden, ein Wesen zu betrachten: die ins Klinische gedrückte Selbstbehauptung eines Schizophrenen, der ein bestimmtes Bewußtsein seiner eigenen Krankheit entwickelt (…). Die Chance, ein Klinikbett zu zeigen, das sich gleichzeitig als kosmischer Raum definiert. Die Reise wird sprachlich gestaltet, das Gestammel wird zur Fahrt. Die Klinik, in der Dionysos sich befindet, ist so beschaffen, daß sie nicht mehr aushaltbar ist. Entweder die Klinik muß sich verändern oder Dionysos muß sich verändern.“ Wenn das keine fragwürdigen Analogien sind, dann gibt es wohl keine sinnvolle Vorgabe für Verständigung über den Wort- und Begriffsgebrauch.
Nun sagen zwar die Schaubühnenmitglieder, daß es ihnen auf „Phänomene mit einer irren Logik“ ankomme, „auf ungeheuer spannende Aspekte“, darauf, „einmal einen Typ zu zeigen“ – solche Sprachformeln sind in der Tat nur Leerstellen jenes „Gestammels, das zur Fahrt wird“ – dennoch soll das Programmheft dokumentieren, in wie weitem Umfang von den Schauspielern ein Anspruch auf diskursive Argumentation erhoben wird. Niemand verlangt, daß solche Arbeit von Theaterleuten geleistet wird; die Schaubühne aber verlangt das von sich selbst. Den Fachleuten für solche Argumentation, den von ihnen reichlich, allerdings nur auf „Anregungen“ hin zitierten Wissenschaftlern, wollen sie nicht folgen, obwohl sie damit kokettieren, daß sie als „Schauspieler der einen oder anderen Theorie bei ihrer Beschäftigung mit primitiven Gesellschaften folgen, um sich der Ursprünge des eigenen Metiers zu versichern“. Aber dieses Hinweisen auf die eigene Kenntnis wissenschaftlicher Theorien enthüllt sich sehr schnell als eine theatralische Geste, wenn die Schauspieler kurz angebunden erklären, daß sie die „text-archäologischen Rekonstruktionen“ der Wissenschaftler „bewußt mißachten“ wollen. Das heißt, die Berufung auf die wissenschaftlichen Theorien dient nur als Alibi dafür, sie als Korrektiv und Kritik der eigenen Willkür nicht akzeptieren zu müssen. Denn schon zu Anfang ihrer Selbstaussagen stellen die Schaubühnenleute fest: „Aus der Tatsache, daß keinerlei authentische Überlieferung vorhanden ist, wurde das Recht abgeleitet, den Stoff mit eigener Problematik zu füllen.“
Bei einer solchen Auffassung von „authentischer Überlieferung“, die das wissenschaftliche Arbeiten völlig verkennt, nimmt es nicht wunder, daß überlieferte Texte und ihre soziokulturellen Hintergründe als Requisitenkammer benutzt werden, aus der man sich nach eigenem Gutdünken bedient, um „innovative ästhetische Qualitäten der Tragödie hervorzuheben“.
Handelt es sich dabei um solche Qualitäten der griechischen Tragödie, so lassen die sich als ästhetisch innovative außerhalb wissenschaftlicher Rekonstruktion überhaupt nicht erkennen. Ist hingegen die innovative ästhetische Qualität der Tragödie gemeint, die die Schaubühne aufführt, dann ist es mit den Innovationen nicht weit her, da sie samt und sonders sich anderen Künstlern verdanken. Nun gilt zwar heute mehr denn je: „Das Theater theatert alles ein“ (die Wissenschaft so gut wie die bildenden Künste), aber daß der Satz gilt, bedeutet noch nicht, daß er gerechtfertigt ist.
Die einzelnen Elemente des Bühnenbildes zum ‚Antikenprojekt‘ lassen sich vollständig aus jeder Materialsammlung zu den Prozessen der bildenden Kunst der vergangenen acht Jahre zitieren; diese Bilder zusammengestellt zu haben, bedeutet nicht die geringste Erweiterung, da die ohne Namensnennung verwendeten Künstler selbst die Raumkonstellationen in der Dimension, wie sie die Schaubühne benutzt, bereits berücksichtigt haben. Auch der Einsatz des Lichts und der monochromen Farbigkeit statischer Raumelemente ist ausdrücklich Thema einer ganzen Reihe bildender Künstler in den vergangenen Jahren gewesen bzw. ist es weiterhin.
Was die Verbindung bildend-künstlerischer Mittel mit der theatralischen Szene anbelangt, so ist ebenfalls keine Erweiterung durch Regisseure und Bühnenbildner der Schaubühne erreicht worden. Die Abteilung ‚Individuelle Mythologien‘ der documenta 5 hat ja bereits eine rückblickende Zusammenstellung von solchen Findungen und Verwendungskontexten gegeben. Das gilt sowohl für die aus Kollektivmythologien abgeleitete Verwendung von Bestandteilen aus der Dingwelt der Fetische als Attribute der Handelnden (Kleidung) wie auch für deren Verwendung als Spielmaterial. Direkt nachweisbar ist, daß Regisseure und Bühnenbildner sich bei ihren Übernahmen auf Abbildungen der Arbeiten anderer Künstler aus den vergangenen acht Jahren verlassen haben, denn sonst hätten sie über die aus Abbildungen genommenen Bildvorstellungen hinaus auch die Handlungsverläufe übernommen, die die Bilderfinder an das Material knüpften. Hätten Regisseure und Bühnenbildner die Inszenierungen von BRUS oder NITSCH, PALERMO, GRAVES, MARTIN, RAINER, SCHWARZKOGLER, THEK, ACCONCI, BEUYS, HORN, PENONE, RINKE, WALTHER, HESSE, KOUNELLIS, NAUMAN, SERRA, BUTHE, VOSTELL, GOJOWCZIK, LA MONTE YOUNG/ZAZEELA, ZORIO, KIENHOLZ, STEVER in loco und nicht nur anhand von Ausstellungsdokumenten zur Kenntnis genommen, so hätten diese Zitate ihren authentischen Anspruch nicht so ohne weiteres aufgegeben. Allerdings reicht die Brutalität der Schaubühne im Umgang mit den Arbeiten anderer hin, auch noch den gerechtfertigtsten Selbständigkeitsanspruch von Werken zu zerstören – eine Brutalität, die bei dem vorgegebenen Selbstverständnis der Schaubühne unverständlich ist. lm allgemeinen Kulturbetrieb nennt man vergleichbare Praktiken richtigerweise nackte Ausbeutung.
Das vorgegebene Selbstverständnis könnte Selbsttäuschung oder zeitgemäße Verbrämung kalkulierter Karrieremacherei sein. Daß ein sozialistisches Selbstverständnis zum Marketing-Konzept herunterkommt, ist eine heute vielfältig belegbare Erscheinung. Ich nehme nicht an, daß die Mitglieder der Schaubühne sich bewußt solcher Verbrämung bedienen. Daß Selbsttäuschung wahrscheinlicher ist, belegen die Schwierigkeiten, die das Schaubühnen-Ensemble mit der Formulierung seiner Aussagen hat. „Diese Gegensätze sind sozusagen die Hälften einer magnetischen Kraft, die immer zusammenstreben und mit äußerster Anstrengung auseinandergehalten werden müssen, so daß ein ungeheures Spannungsfeld entsteht. In dem Moment, wo diese Gegensätze zusammengehen würden, würde die Spannung, auch physikalisch gesehen, zusammenfallen.“ Hier wird deutlich, wie die Worte sich in sinnzerstörender Weise von dem lösen, was sie bezeichnen, denn zugleich kennt der Schaubühnentext einen „Spannungstod durch Kurzschluß: würde das geschehen, würde die Spannung, die das Stück ausmacht, in sich zusammenfallen, weil die beiden äußersten Pole bereits so zusammengehen, daß im Grunde keine Weitererzählung möglich ist.“
Diese Beispiele der Selbsttäuschung durch Sprach- und Gedankenohnmacht sind relativ leicht aufzuschließen. Gefährlicher ist die Selbsttäuschung, wenn im Programmheft zum ‚Antikenprojekt‘ Aufgabenstellungen des Ensembles mit Worten formuliert werden, die nicht als Begriffe entfaltet sind: „Interessant wäre zu fragen, wie wir heute auf die Konfrontation mit dem Tod reagieren (…). Was wir normalerweise praktizieren, ist lediglich der Vorgang des Verhüllens, während der mit dem Vorgang des Aufdeckens verbundene Mut bei uns zu kurz kommt. Das konnten wir aus der Beschäftigung mit dem Material lernen.“ „Über solche Fragen mußten wir uns Rechenschaft ablegen, was durchaus auch vor dem Publikum geschehen kann.“ „Der ganze irrationale Komplex des Entstehungsprozesses von Theater kommt an einem Punkt an, wo er sich mit äußerster Präzision und Ökonomie verbindet, d.h. mit äußerster Bewußtheit.“ „Unser Interesse an dieser Unternehmung: die Untersuchung unserer eigenen Tätigkeit, der Frage nach der Theaterspielerei, ihren Voraussetzungen, ihren Möglichkeiten bzw. Unmöglichkeiten.“ „Die Identitätsfindung des Dionysos (…) muß für uns begreifbar gemacht werden.“ „Der Zuschauer muß gezwungen werden, ein Wesen zu betrachten…“ „Im Stück hat die Tatsache, daß Dionysos von außen kommt, einen stark projektiven Charakter, der heute nachvollziehbar ist. In dem Dionysoskult werden bestimmte menschliche Dispositionen vergegenständlichbar.“ „Von hier aus können wir bestimmte Dinge, die zu dem Chor oder so etwas wie Theaterspielerei geführt haben, für uns wieder verstehbar machen. Allerdings wollen wir, über EURIPIDES hinausgehend, die Anstrengung, die es kostet, um einen derartigen Vollzug möglich zu machen, mitzeigen.“
Daß mit den Inszenierungen des ‚Antikenprojekts‘ diese Aufgaben nicht im geringsten erfüllt wurden, soll der Schaubühne nicht vorgeworfen werden. Daß aber die Theatermacher nicht einmal versuchten, sich selbst an diese Aufgabenstellung zu halten, obwohl sie dies sich selbst gegenüber vorgeben, ist nicht zu akzeptieren, weil das Publikum bei seiner Rezeption veranlaßt wird, sich an diesen Vorgaben zu orientieren. Wahrscheinlich resultiert dieses Verhalten der Schaubühne nicht aus kalkuliertem Düpieren von Erwartungen, sondern ist Folge nicht ausgehaltenen Reflexionsdrucks bzw. eine Überforderung beim selbstbewußt dekretierten Umgang mit Aussagen der Wissenschaftler zur Antike, die das Umfeld der euripideischen Bakchen erst für uns sichtbar machen.
Das Programmheft zitiert FREUD: „In der Sprache findet der Mensch ein Surrogat für die Tat, mit dessen Hilfe der Affekt ebenso ‚abreagiert‘ werden kann (…). Wenn solche Reaktion durch Tat, Worte, in leichtesten Fällen durch Weinen nicht erfolgt, so behält die Erinnerung an den Vorfall zunächst die affektive Betonung.“ Meinen die Schauspieler, daß eine derartige Leistung der Sprache nur erbracht wird, wenn Sprache ein angemessenes Surrogat für die Tat ist? Oder genügt irgendeine sprachliche Artikulation?
Das Programmheft sagt, es gebe einen Punkt, „wo Realität nur durch Theatralität wieder zur Realität führen kann“. Ist gemeint, daß eine Vorstellung von der Realität in eine andere überführt wird, oder ist gemeint, daß ‚die Realität‘ durch Theaterspielen verändert werden kann? Kommt es nur darauf an, mit ‚Theatralität‘ irgendeine andere Vorstellung von der Realität zu gewinnen? Dann wäre ‚Theatralität‘ nur verselbständigte Reaktionsweise, die sich blind von jeder gerade vorliegenden Vorstellung der Realität zu einer anderen treiben läßt? Die in der Aufgabenstellung verwendeten Worte „äußerste Bewußtheit“, „begreifbar machen“, „verstehbar machen“, „zeigen“, „aufdecken“, „Rechenschaft ablegen“ scheinen einer solchen Auffassung von der Theatralität als spontaner und affektiver Reaktion, die ihre Berechtigung hätte, zu widersprechen. Den Widerspruch aufzudröseln, heißt den Theatermachern der Schaubühne entgegenzuhalten, was Pentheus dem Dionysos: „Für das leere Spiel mit Worten sollst du Buße leisten.“
Allerdings sagen die Schaubühnenformulierer, daß für ihre Arbeit die Frage erst geklärt werden müßte, „ob sich die Schauspieler so verhalten, ‚wie sie es können‘, ob wir darstellungsmäßig eine erhellende, erklärende Vermittlung anstreben oder eine schockartige Wirkung, ein direktes Erlebnis, in das die Zuschauer hineingezwungen werden, einen Zustand, in dem nicht mehr alles selbstverständlich ist“.
Diese Frage sollte offensichtlich zugunsten eines „direkten Erlebnisses, in das die Zuschauer gezwungen werden“, beantwortet werden. Die Inszenierung hat das gar nicht leisten können, weil die Schauspieler selber formulieren, daß „für ein realistisches Nachvollziehen zum Beispiel eines Opferganges Identifikation mit dieser Handlung vorausgesetzt werden muß“. Zugleich aber wurde in den ‚Übungen für Schauspieler‘ gezeigt, daß die Voraussetzungen für eine solche Identifikation offensichtlich nur durch bewußte, also „erhellende, erklärende Vermittlung“ erreicht werden können. Sonst wären ‚Übungen‘ nicht möglich. Wie soll der Zuschauer Identifikation leisten, wenn er nicht mitübt? Also wird ihm die Identifikation der Schauspieler vorgeführt. Um sie als Identifikation erkennen zu können, muß sie dem Zuschauer „erhellend, erklärend vermittelt werden“. Das heißt, es muß vermittelt werden, womit sich die Schauspieler „identifizieren“.
Die Fähigkeit zum „realistischen Nachvollziehen“ muß durch bewußte Übung erworben werden – was aber nachvollzogen wird, läßt sich ohne ebenso bewußte Rekonstruktion nicht sagen. Solche Rekonstruktionen liefern für die griechische Antike wie für unsere unmittelbare Vergangenheit die Wissenschaften: theatralisch könnte nur die Rekonstruktion nachvollzogen werden.
Was kann vernünftigerweise der von der Schaubühne konstatierte Unterschied zwischen „distanziertem Nachstellen“ (also Rekonstruktion) und „realistischem Nachvollziehen“ bedeuten? Heißt „realistisches Nachvollziehen“, daß die Schauspieler den Vollzug als real erleben? Dann werden aber vor allem nicht die von EURIPIDES behandelten Rituale nachvollzogen – dann wären die Handlungen der Schauspieler selber als Ritual aufzufassen. EURIPIDES würde dann nur willkürlich für die Konstitution eines Rituals ausgeschlachtet, da die Theatertruppe selbst nicht zu einer solchen Begründung des Rituals fähig ist (Rituale lassen sich weder von Schauspielern noch von Hippies oder Parteisekretären nach Belieben konstituieren). Heißt aber „realistisches Nachvollziehen“: es wird etwas unbestimmt Vorgegebenes im Nachvollzug sichtbar, so wäre eben das eine Rekonstruktion; allerdings eine bedeutungslose, solange nicht durch das Nachvollziehen jene unbestimmten vagen Voraussetzungen als bestimmte erkannt werden.
Meinen die Schauspieler vielleicht ‚Einfühlung‘? Es ist erwiesen, daß man sich immer nur in sich selber ‚einfühlt‘, wenn man sich in andere einzufühlen versucht. Die Einfühlung eines Analytikers in seinen Patienten oder die Einfühlung eines Philologen in die Literatur der griechischen Klassik haben fatale Konsequenzen, wenn die Einfühlung nicht in eine Rekonstruktion des anderen, Fremden überführt wird – wenn das andere und Fremde dem Einfühlenden nicht als Objekt gegenübertreten kann. Ein derartiges ‚Wissenschaftlichwerden‘ ist gerade der Kunstpraxis heute abzuverlangen, wenn anders nicht gerade die Künstler vollständig ihrer Handlungsobjekte entraten sollen, ‚0bjektverlust‘ lautet die Diagnose. Konstitution des Objektcharakters wird durch Rekonstruktion erreicht: gerade Theater kann solche Rekonstruktion optimaler darstellen als die einzelnen Wissenschaften, die für die Darstellung ihrer eigenen Rekonstruktionen (Erkenntnisse) nur über magere Mittel verfügen. In der Übernahme der Darstellungsverpflichtung könnte Theater die Wissenschaften, die in erster Linie Erkenntnisverpflichtungen haben, als Formen sozialen Handelns komplettieren und weiterentwickeln.
In solcher Darstellung des Erkannten schließen sich „schockartige Wirkung“ und „erhellende Vermittlung“ nicht aus – wie die Schaubühnenmitglieder meinen. Entsprechen schockartige Wirkung und erhellende Vermittlung einander, dann wird Evidenz erzeugt.
Obwohl die Schaubühne die Möglichkeit zur Rekonstruktion der euripideischen Antike leugnet, stellt sie andererseits dem Chor, der aus nachvollziehenden Schauspielern besteht, die Aufgabe, das Handeln der Protagonisten mit „Kausalitäten des Handlungsgeschehens, Korrespondenzen zur Geschichte, zur Mythologie, zur Genealogie etc.“ zu begleiten und damit den Fortgang des Spiels zu ermöglichen. Gehen solche Kommentare des Chors aus dem Text des EURIPIDES hervor, dann sind sie nicht Leistungen nachvollziehender Schauspieler, sondern Darstellungsaufgaben. Wenn die Theaterleute diese Kommentare zur Kausalität des Handlungsgeschehens, der Korrespondenzen zur Geschichte, Mythologie und Genealogie nachvollziehen wollen, dann müssen sie jene Kausalitäten usw. zunächst anhand des tradierten Materials rekonstruieren bzw. auf die Rekonstruktion der Wissenschaften zurückgreifen. Um diese Rekonstruktion kommt man nicht herum. EURIPIDES wendet in den ‚Bakchen‘ dieses Verfahren selber an, sowohl inhaltlich als auch formal. Inhaltlich als Rekonstruktion der genuin griechischen Vorstellung von der Beziehung zwischen Menschen und Göttern, also der Ordnung der Welt, die es zu erreichen galt; formal als Rekonstruktion des Dionysoskults, also der kulturellen und sozialen Praxis aus der Entstehungsgeschichte seiner Gegenwart, die es zu verstehen galt.
Zu den Zeiten des EURIPIDES praktizierten die attischen Griechen den Dionysoskult nicht mehr in der ursprünglichen Form. Der Kult hatte sich längst in ein Weihespiel verwandelt, zu dem man Delegationen entsandte. Einem Athener war um 406 der ursprüngliche Dionysoskult genauso fremd wie uns heute. Seine Rekonstruktion auf dem Theater war demzufolge genauso schwierig wie heute.
Es gibt eine lange Tradition des gewollten Mißverständnisses, Dionysos als griechischen Vorläufer des Gottmenschen Jesus anzusehen: man beabsichtigte mit einer solchen Konstruktion, die unübersehbar bedeutsamen kulturellen Leistungen der Griechen noch nachträglich unter den Anspruch des Christentums zu verfügen. VERGIL wurde sogar in diesem mittelalterlichen Versuch der Aneignung der griechischen und römischen Kultur durch die Christen zu einem direkten Verkünder der Ankunft des Christos. Die Schaubühne schließt sich mit ihrer formulierten, wenn auch nicht realisierten Konzeption dieser Tradition des Mißverständnisses über die griechischen Göttervorstellungen an. Da sie aber, wie bekundet, über EURIPIDES hinausgehen will, wird das Mißverständnis doppelt. Sie sieht einerseits in Dionysos die Menschwerdung des Gottes. Da das offenbar heute kein behandlungswürdiges Thema mehr ist, wird mit Dionysos die „psychologische Kurve eines Menschen bezeichnet, als Metapher für die Selbstfindung, die Identifikationsschwierigkeiten eines Individuums, das sich nur entfalten und selbst finden kann in der Auseinandersetzung mit anderen“.
Die Dionysos-Tragödie als Drama der Gottestötung, sozusagen als Karfreitag der Griechen aufzufassen, ist nicht sinnvoll, seit man unter Aneignung nicht mehr, wie das christliche Mittelalter, Vereinnahmung verstehen kann, sondern die Rekonstruktion des Gewesenen als des nicht mehr Gegenwärtigen, aber dennoch für die Entstehung des Gegenwärtigen Bedeutsamen. Die mittelalterliche Praxis wird heute beispielsweise in der DDR bei der Aneignung des kulturellen Erbes insofern fortgesetzt, als aus der bürgerlichen Kultur nur jene Bestandteile gefeiert und der Übernahme für würdig befunden werden, die gegenwärtige Auffassungen nur in einer historisch anderen Gestalt darzustellen scheinen.
Gerade historischen Materialisten verbietet sich ein solches Verständnis von Aneignung. Für die Griechen hieß das Messen und Bewerten des anderen mit der bloß eigenen zeitgemäßen Elle Hybris.
Die Schaubühnen-Aufführung legte auf ‚Hybris‘ als Fang- und Reizwort größten Nachdruck, sah aber verständlicherweise davon ab, den eigenen Umgang mit dem historischen Material unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. Sie hätte es sich dann nämlich verbieten müssen, in dem Stück des EURIPIDES nur ein Beispiel für gegenwärtige Auffassungen von den „ldentifikationsschwierigkeiten“ eines Individuums zu sehen. Wer historisches Material nur darauf befragt, inwiefern es unsere gegenwärtigen Fragestellungen abhandelt, müßte doch eigentlich von selbst darauf kommen, daß das gar nicht möglich ist, da sich die historisch-materialistisch herausarbeitbaren Bedingungen für die Entwicklung einer Fragestellung und ihrer möglichen Beantwortungen beständig verändern. Es ist eben Hybris zu meinen, daß die historischen Zeugnisse unserer Kultur ausschließlich dann noch ein Recht auf Rezeption hätten, wenn sie uns etwas zu unseren gegenwärtigen Problemstellungen so sagen, als seien sie heute verfaßt worden. Das ist nur die Fortsetzung der Erörterung der ewigmenschlichen Probleme.
Von solcher Hybris wird man verschont, wenn man anhand der Rekonstruktion des historisch Gewesenen erfährt, daß unsere gegenwärtigen Probleme durchaus nicht ewigmenschliche sind. Erst daraus nehmen wir eine Ahnung von dem, was möglich war und für Menschen möglich wäre, die nicht im Gefängnis ihrer eigenen Vorstellungen und Auffassungen eingesperrt bleiben. In dieser Weise hat EURIPIDES seinen Mitbürgern den Dionysoskult rekonstruiert. Denn diese Mitbürger erlaubten sich bacchantische Praktiken im Bereich des politischen Handelns, die sie mit Hinweis auf althergebrachte Kulte zu rechtfertigen versuchten. Diesen Tatbestand macht THUKYDIDES deutlich, wenn er den kollektiven Blutrausch attischer Soldaten in Korkyra 427 und in Melos 416 ausführlich schildert, obwohl diese Ereignisse politisch gesehen kaum bedeutsam waren. THUKYDIDES schreibt mit Verweis auf jene Ereignisse: „Fanatische Begeisterung war das Kennzeichen eines echten Mannes; einen politischen Gegner mit völliger Willkür zu behandeln, galt als durchaus akzeptabel. Wer nur extreme Ansichten äußerte, dem durfte man vertrauen, und wer dagegen etwas einwandte, machte sich verdächtig. Selbst familiäre Bindungen waren schwächer als die Parteizugehörigkeit, da die Parteimitglieder bereit waren, aus beliebigen Gründen die extremsten Handlungen zu begehen. Diese Parteien bildeten sich nicht, um neue Ordnungen in Geltung zu setzen und mit ihnen das Leben besser nutzen zu können, sondern sie entstanden nur, um die jeweils gerade bestehende Ordnung zu stürzen, um dadurch selbst an die Macht zu gelangen. Die Mitglieder solcher Parteiungen hatten nicht deshalb Vertrauen zueinander, weil sie die gleichen Vorstellungen von dem gesellschaftlichen Leben hatten, sondern weil sie gemeinsam Verbrechen begingen.“
Mit der Rekonstruktion der ursprünglichen Kulte wollte EURIPIDES zeigen, daß der kollektive Machtrausch sich nicht mit Berufung auf sie legitimieren konnte. Aus den Werken und dem Leben des EURIPIDES ist eindeutig nachweisbar, daß er sich solchen Legitimationsversuchen durch die Wiederaufnahme der Kulte der Frühzeit widersetzte. Er war insofern Atheist, als diese Kulte mit den genuinen griechischen Auffassungen von der Religion nichts zu tun hatten. Die ‚Bakchen‘ sind kein Widerruf eines Atheisten, sondern die Fortsetzung seines Kampfes gegen die Pseudoreligionen, die von politischen Karrieristen nach Belieben ausgenutzt wurden.
Schon die Eleaten haben die Vorstellungsinhalte der in den Kulten auftretenden Figuren, zum Beispiel den Satyr, analysiert als das, was wir heute als vorDARWINsche Abstammungslehre bezeichnen würden. In diesen halb menschlichen, halb tierischen Figuren wurden sich die Menschen ihres eigenen Ursprungs aus der NaturevoIution bewußt, ohne die Gesetze dieser Evolution im DARWINschen Sinne erkennen zu können. Die Entstehung des Menschen im naturevolutionären Prozeß konnte von Griechen deswegen so früh erfahren werden, weil sie einen Schöpfergott nicht kannten. Die Griechen hatten keine Religion, wenn wir darunter etwa das verstehen, was jüdische oder christliche oder mohammedanische Traditionen bezeichnen. Sie kannten keine heiligen Texte von der Art der Bibel oder des Koran, es gab keine institutionelle Verwaltung von Religion in der Form einer Kirche.
Auf diese genuin griechischen Vorstellungen hebt EURIPIDES auch in den ‚Bakchen‘ ab, wenn er die Pseudoreligion eines Dionysos rekonstruiert. Was für einen athenischen Zeitgenossen des EURIPIDES Religion hieß, ist der Hintergrund, vor dem die ‚Bakchen‘ gesehen werden müssen. Das Stück entfaltet den Hintergrund nicht selber, da er für das athenische Publikum noch unmittelbar wirklich war.
Der Kern dieser Auffassung von der Religion als einer Beziehung zwischen Menschen und Göttern kann sehr knapp dargestellt werden, wenn man sich etwa auf PlNDARs Texte beruft: die griechischen Götter sind die zu höchster Entfaltung des Lebendigen aufgestiegenen Menschen, vorausgesetzt, daß es je Menschen möglich wäre, sich so vollkommen zu entfalten. Eins ist das Geschlecht der Götter und Menschen, sagt PINDAR, aber uns trennt in allem anders geartete Kraft. Höchste Entfaltung dessen, was Menschen zu sein wünschten, würde bedeuten, daß sie von Alter und Tod verschont blieben. Die griechischen olympischen Götter repräsentieren die aus den Bedingungen von Zeit und Wirkungskraft befreiten Menschen auf der damals höchsten denkbaren Entwicklungsstufe. Im übrigen bleiben aber auch die Götter den Gesetzen der Natur (anonke) und den Gesetzen des sozialen Lebens (agon) unterworfen. Ehestreitigkeiten, Machtrivalitäten usw. konnten deshalb ganz selbstverständlich von den Griechen auch als göttlicher Lebensalltag verstanden werden. Religion als Bezug auf die Götter hieß also für den Griechen, sich beständig seiner höchsten Entfaltung verpflichtet zu fühlen. Die Heroen waren Leitbilder dieser Anstrengung höchster Entfaltung, weil sie es geschafft hatten, sich göttlichen Gestalten anzunähern. Die in hellenistischer Zeit belegten Vergöttlichungen von politischen Führern wurden lange als Verfallserscheinungen der klassischen Auffassung von der Religion angesehen, sind aber tatsächlich nur deren selbstverständliche Äußerung.
Wenn ich sagte, daß EURIPIDES diese inhaltliche Dimension von Religion in den ‚Bakchen‘ rekonstruiert, so ist das im Sinn einer Verpflichtung des Menschen zur Verwirklichung seiner Gottähnlichkeit zu verstehen. Obwohl den Athenern die eben skizzierte Auffassung noch ganz gegenwärtig war, bedurften sie bei der zunehmenden Willkür im politischen Handeln um so stärkeren Ansporns. Etwas nie oder kaum zu Erreichendes dennoch immer versuchen zu sollen, ist eine Handlungsanleitung, der sich mehr und mehr Griechen nicht gewachsen fühlten; und es ist nur allzu verständlich, daß sie ihr Versagen vor dieser Verpflichtung durch die Vorstellung von der Beziehung Götter – Menschen und ihr damit begründungslos gewordenes Handeln mit dem Hinweis auf andere Gottvorstellungen, beispielsweise den Dionysoskult, zu rechtfertigen versuchten. Dagegen haben sich EURIPIDES wie andere Aufklärer gewandt.
Wenn die Schaubühne in den Aufgabenstellungen für das ‚Antikenprojekt‘ fragt, was denn an den ‚Bakchen‘ für heutige Problemstellungen noch interessant sei, um dann die Geschichte eines Gottmenschen als Prozeß der Heilung eines Schizophrenen zu inszenieren, dann verfällt sie der Kritik an ihrem falschen Aneignungsbegriff. Eine gelungene Aneignung wäre gewesen zu versuchen, anhand der ‚Bakchen‘ ein Modell jener griechischen Auffassung von der Beziehung zwischen Göttern und Menschen sichtbar zu machen.
Es hat eine Zeit in Europa gegeben, in der solche gelungenen Versuche unternommen wurden, allerdings weniger innerhalb der Theaterpraxis als vielmehr im Bereich der Literatur und Wissenschaft. Die Spannweite der damaligen Rekonstruktionsversuche wird durch die Namen HÖLDERLIN und ROBESPIERRE angedeutet.
Man hat sich oft gefragt, wie es zu erklären sei, daß um 1800 so plötzlich eine so große Zahl von Genies auftreten konnte. Die landläufige Erklärung verweist auf die Befreiung der Menschen vom Druck gesellschaftlicher Ideologien durch die Französische Revolution. Ich würde sagen, daß in dieser Erklärung auf eine bisher nicht beachtete Weise Richtigkeit steckt. Die Freisetzung der Arbeitsenergien um 1800 verdankt sich der Rekonstruktion griechischer Religion. Das hieß vor allem die Befreiung von der Vorstellung eines Schöpfergottes. Die sehr ähnlichen Ausbildungswege und Erziehungsformen, die jene Genies durchliefen, haben durch die Betonung des Studiums der klassischen Philologie eine solche Rekonstruktion der griechischen Göttervorstellungen befördert.
In der Französischen Revolution wurde zwar unmittelbar nicht von den griechischen, sondern von den römischen Lebensformen ausgegangen, dennoch war für einen ROBESPIERRE oder SAINT-JUST das Leerräumen des christlichen Himmels eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Befreiung des gefesselten Bürgers. Was SAINT-JUST und ROBESPIERRE als Göttin der Vernunft, als höchstes Wesen inthronisieren wollten, entspricht weitgehend griechischen Vorstellungen. Die Griechen haben Abstrakta wie Vernunft, Liebe, Stärke, Schönheit nur gebunden an menschlichen Ausdruck und menschliches Verhalten verstehen können. Deswegen drückten sie diese Abstrakta in menschlichen Gestalten aus. Daß sie ihren Göttern menschliche Gestalten gaben, ist deshalb keine primitive Anthropomorphisierung, sondern die Erkenntnis, daß alle Aussagen über solche Abstrakta nur in Verbindung mit dem Menschen Bedeutung haben. HARDER hat darauf hingewiesen, daß auch für uns heute noch eine solche Ausdrucksweise verständlich ist: wenn wir vom Tod sprechen, so haben wir zumeist die Vorstellung des Sensenmannes, des Vetter Hein.****
Solche Vorstellungen für die Abstrakta Liebe oder Schönheit oder Gemeinschaft möglich zu machen, wäre eine Aufgabe der Rekonstruktion griechischer Göttervorstellungen. Natürlich können wir die griechischen Vorstellungen nicht übernehmen. Das geschichtlich Gewesene erhält seine Bedeutung daraus, daß es nie wieder gegenwärtig sein kann. Aber das Beispiel der Griechen könnte als eines der Muster erkannt werden und als ein mutmachender Hinweis auf die Möglichkeit, das Spiel mit leeren Worten zu beenden. Die Willkür unseres Umganges mit den Abstrakta zerstört jede Kommunikation. Sie wird erst wieder gelingen, wenn wir die möglichen Bedeutungen solcher Abstrakta mit dem Ausdruck menschlichen Verhaltens in direkte Beziehung bringen können. Insofern heißt die Aufgabe: die griechische Antike als eine Zukunft einzuholen.
Anmerkungen:
* TOMBERG, Friedrich, ‚Polis und Nationalstaat. Eine vergleichende Überbauanalyse im Anschluß an ARISTOTELES‘, Luchterhand-Verlag, Darmstadt und Neuwied, 1973.
** op. cit., S. 236 f.
*** Schaubühne am Halleschen Ufer, Berlin, Antiken-Projekt, Erster Abend: Übungen für Schauspieler, Zweiter Abend: EURIPIDES, ‚Die Bakchen‘, Regie Klaus Michael GRÜBER, Premiere 6. und 7. Februar 1974.
**** Vgl. HARDER, Richard, ‚Eigenart der Griechen. Einführung in die griechische Kultur‘, hrsg vor Walter MARG, Herder-Bücherei, Verlag Herder. Freiburg i.Br., 1962, besonders S. 104.