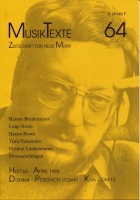Liebe Brüder und Schwestern im Zeitgeist, liebe Genossen, die sich zu Zeitgenossen wandelten - spätestens ab 1989 -, liebe wahrhafte Polemiker, geniale Dilettanten, gepflegte Apokalyptiker, trainierte Body-und-Soul-gebildete Selbstentfesselungskünstler, streunende Herrchen, Bauchtänzer, Fragmentaristen, Abfallverwerter - die wir ja als Künstler alle sind - objektive Zyniker und vertrags treue "condottieri", das ist der historische Begriff für den gestandenen Landsknecht.
Captatio benevolentiae
Erster Satz meines kleinen Kammerspiels einer rhetorischen Oper zur Selbsterregung oder zur Erzwingung der Gefühle von Zeitgemäßheit: Captatio benevolentiae, oder zeitgemäß: "always fis hing for complications". Ins Thema wurde ich heute eingestimmt auf dem Bahnhof in Frankfurt am Main. Zur Erzeugung einer Erlebnisweltkulisse tönt auf diesem Bahnhof aus allen Geräuscherzeugungsquellen der Bahnsteige etwas, was mich heute an Furtwänglers zweiundfünfziger Interpretation der Ersten Sinfonie von Brahms mit den Wien er Philharmonikern erinnerte, vielleicht als Huldigung an die ewig Gestrigen. Denn wenn Sie mit der Bahn fahren, haben Sie seit Jahren das Erlebnis der verspäteten Nation, Unzeitgemäßheit durch systematische Verspätung. Dann wanderte ich ins Künstlerhotel, wunderbare Anlage, aber eben im Bordellviertel, vielleicht auch das eine verspätete Huldigung an die Boheme, also die fatale Ideologie romantischer Verrücktheit und exzessiver Freiheit zur Selbstzerstörung des künstlerischen Genies. Man wird förmlich eingeladen, die alten Erzwingungsstrategien des Absoluten zu beobachten - bekanntester Fall aus der Musikbranche, falls Sie ihn überhaupt als Musiker werten, ist Friedrich Nietzsche - damals machte man das nicht durch Aidsinfektion, sondern durch simple Syphilis. Das reichte auch damals hin, um entsprechenden Wirklichkeitsanspruch in sein eigenes Leben zu bringen.
Wem meine Ausführungen etwas altbacken erscheinen mögen, etwas bourgeois, etwas unzeitgemäß, dem möchte ich gleich ein Motto meiner Forscherfamilie "bildende Wissenschaften" oder "fine sciences" vorausstellen. Unser Motto heißt "Der Schnee von gestern ist bekanntlich die Lawine von morgen." Und das müssen Zeitgenossen heute kapieren. Es liegen nämlich die alten Geschichten nicht nur historisch hinter uns, sondern auch vor uns, und das gilt für alle entscheidenden Bereiche unseres Lebens, also etwa für das Politische, an dem Sie s.ehen, daß in Jugoslawien oder in Sri Lanka oder in Rußland die alten Geschichten als historisch wirksame Lawine sich wieder in Gang setzen. Rußland ist heute da, wo es 1764 auch schon mal gewesen ist. Das setzt sich durch im Sozialen und Wirtschaftlichen. Wieder diskutieren wir "Standort Deutschland" oder was die technische Rationalisierung von Arbeit mit Millionen Freigesetzten für einen Sinn haben soll, wenn es keine Käufermassen gibt, die genügend Einkommen haben, um die in immer größerer Zahl produzierten Produkte kaufen zu können. Das war bereits eine zentrale Diskussion des neunzehnten Jahrhunderts, bis jemand aus dem Umfeld von Herrn Marx - nämlich der Kaiser von Österreich - im Jahre 1870 auf die Idee kam, daß es eigentlich darum gehe, den potentiellen Käufer mit hinreichenden Mitteln auszustatten. Diese Theorie war bezogen auf die künstlerische Entwicklung, vorgeschlagen nämlich anläßlich der Gründung der Hochschule für angewandte Künste in Wien. Es sei also wenig sinnvoll, etwa Arbeiter nur mit soviel Lohn zu entlassen, daß sie sich gerade physisch selbst erhalten konnten; denn ihre wichtige Rolle sei nicht die des Arbeiters, sondern die des Konsumenten. Nachlesenswert, was da so ein alter spinnerter Herr Programmatisches - bis heute Programmatisches - zur Entwicklung von Künsten in einer modernen Gesellschaft, damals in der willentlichen Konkurrenz zu England und Frankreich, die industriell dem deutschsprachigem Raum, k. u. k. Österreich und Deutschland, weit überlegen war, gedacht hat. Und im künstlerischen Bereich ist "der Schnee von gestern die heutige Lawine" etwa in dem Sinne, daß wir, seit Wagner Werke vor allem als Kalkül ihrer Wirkung geschaffen hat, dem Einschaltquotenkalkül unterworfen sind. Hoffentlich gelingt es uns ähnlich bravourös wie Wagner, mit dem Kalkül umzugehen.
Deshalb zunächst ein kurzer Blick auf die konsensfähige oder konsensgetragene Auffassung von Zeitgemäßheit, und dieser konsens getragene Begriff der Zeitgemäßheit heißt allenthalben Opportunismus, und zwar eben nicht Opportunismus der kleinen Leute, sondern Opportunismus der großen Meister, ein Blick also auf unseren eigenen Opportunismus. Dieser Opportunismus als Ausprägungsform der Zeitgemäßheit empfiehlt sich als historische Erfahrung. Und dafür möchte ich ein paar Beispiele geben, die für die künstlerische Ausbildung und für die Wirkungs absichten ganz außerordentlich entscheidend sind.
Also seien Sie beispielsweise bedenkenlos Maoist mit Andre Glucksmann, wenn Sie mit diesem Bekenntnis Gehör finden, und genieren Sie sich nicht, als zweifelsfrei urteilssicherer Durchschauer sozialistischen Totalitarismus' aufzutreten, wenn Sie damit ein paar Jahre später sogar die F AZ überzeugen können, Sie als Leitfigur der philosophischen Zeitzeugenschaft zu feiern. Glucksmann war einer der wildesten Maoisten der siebziger Jahre. Feiern Sie mit den Mercedes-Chefs ruhig die allmachtsphantastischen Zukäufe von DASA, AEG, Focker und, und, und. Und zwar als großartige Strategie, die Zukunft des Unternehmens nun endlich zu sichern, und feiern Sie dann mit visionärem Pathos zehn, fünf, zweieinhalb Jahre später die Zerschlagung eben dieser zugekauften Unternehmen ebenso als bombenstarke Sicherung einer erfolgreichen Zukunft Ihres Unternehmens. Kassieren Sie Staatspreise und Bayreuth-Angebote, Auszeichnungen und tagtägliche Pressemeldungen selbst über die privatesten Dinge, wie Ihren späten Entschluß, sich doch auch noch genetisch reproduzieren zu wollen. Und sorgen Sie vor, daß man Sie am Grabe als armes Opfer, krebskrank durch das Leiden an Deutschland, feiert, ein Opfer des reaktionären Mutwillens derer, die Ihnen die kapitalsatten Huldigungen zukommen ließen. Niemand wird Sie und Ihre Huldiger der politischen Pornographie zeihen, etwa wegen Schändung derer, die in diesem Jahrhundert tatsächlich in Lagern saßen, gefoltert oder exekutiert wurden.
Zeitgenossenschaft als radikalem Opportunismus redeten etwa am Grabe Heiner Müllers Hunderte deutscher Stellvertreter höchsten künstlerischen und intellektuellen Anspruchs das Ehrwort. Welche gelungene Aufklärung über ihre und damit auch unsere Selbstdefinition als künstlerische Zeitgenossen. Kapitales Stück - etwas Radikaleres als politische Pornographie habe ich, glaube ich, seit RAF-Zeiten nicht mehr erlebt. Nennen Sie - das muß man künstlerisch ernstnehmen - auch Ihre künstlerische Rüstung "Nachrüstung", zu der Sie gezwungen seien, weil alle anderen aufgerüstet haben. Nennen Sie Ihre künstlerische Gewalt nur "bloße Gegengewalt", dann sind Sie aus dem Schneider. Lassen Sie sich mit bestens gemeinten Wirtschaftsförderungen hinreichend bewaffnen, massakrieren Sie dann, wen immer Sie wollen, rauben und zertrümmern Sie das Seil, und nennen Sie das ganze "revolutionären Befreiungskampf" im Namen der Rettung Ihrer kulturellen, ihrer nationalen Identität. Man wird Sie hinreißend interessant finden für jedes Friedensfest und Ihnen als Genius von historischem Format huldigen, vor allem, wenn Sie auch noch künstlerische Ambitionen als Architekt - hoffentlich fallen Ihnen die Herrschaften dazu ein -, Lyriker - das ist die Spezialität des bosnischen Serbenführers -, Literat oder Musikliebhaber vorweisen. Wenn Sie tatsächlich ein künstlerisches Genie sind, wie der Stammvater der musikalischen Modernität, Richard Wagner, dann wird man Ihre Aufrufe zum "künstlerischen Terrorismus", zum "Niederbrennen der verjudeten Musikhurerei mitsamt deren Kapitale Paris", Ihren Aufruf zur "endgültigen Erlösung Ahasvers" durch dessen Vernichtung für ein großes mysterisches Künstlergeheimnis halten, und nur ein paar ab strafbare Kulturwissenschaftler wie diese Kasperfigur Herr Zelinsky aus München werden in spaßig anzusehender Verzweiflung ans öffentliche Licht zu stellen versuchen, worum es Ihnen wirklich ging, nämlich Welt errettung mit musikalischer Überwältigung, Erlösung dem Erlöser, also eigentlich Erlösung von sich selbst und vor allem von der unbeherrschbaren Schöpfungslogik Ihrer genialischen Künstlernatur. Goethe - der einzige, der Ihnen dabei hätte Paroli bieten können -, rotiert in der Glorie der goldgelben Gnade. Deshalb nur zu, junge Kollegen, wollen Sie als Große anerkannt werden, dann sind sie zu herostratischem künstlerischen Terrorismus geradezu verpflichtet. Das ist nicht weniger brisant als der politische oder sonstige Terrorismus, in der Auswirkung meiner Ansicht nach viel bedeutender als der entsprechende Terrorismus in den anderen Bereichen.
Wem das zu negativ klingt: warum feiern wir denn sonst vor allem unentwegt die Titanen der Überwältigung mit radikalen künstlerischen Mitteln, eben die Furien der Selbstentfesselung? Sollte es also noch Künstler geben, denen diese Kennzeichen zu negativ erscheinen, dann möchte ich Ihnen als letztes Argument der Logik unserer natürlichen Denkart, also unserer Naturlogik des evolutionären Organs Gehirn - unserer natürlichen Dummheit also - erzählen, was gestern in unserem Kreis da oben - Solingen, Remscheid, Wuppertal - ein sechzigjähriger Radiologe dem Richter sagte, vor dem er wegen leichtfertiger Dosierung von Bestrahlung krebskranker Patienten angeklagt ist. Er sagte, nach all dem Negativen, das hier die Experten über seine Bestrahlungspraxis vorgetragen hätten, sollte man doch auch das Positive werten. Es könnte nämlich sein, daß die Überdosierung gerade zur Zerstrahlung der Krebsgeschwülste geführt habe. Leider könne man das nicht mehr beweisen, weil die Patienten sich entzogen hätten - sie liegen im Grab. Also in diesem so überzeugenden Sinne halte ich mich auch an die Positivität der Programmatik künstlerischer Moderne. Soweit die Empfehlung im ersten Satz, künstlerisch zeitgemäß zu sein, durch bestens honorierten, herrlich verklärbaren Opportunismus, die wahre Musica caelestis contemporanea.
Contemplatio
Zweiter Satz - Contemplatio. Einer der Großprogrammatiker dieser Moderne gab folgenden Satz vor: "Wir wollen die Welt verändern, verändern und verstehen, verstehen aber nur, um sie zu verändern." Das ist wirklich von künstlerisch-philosophischem Tiefsinn, der unüberbietbar bleibt: verändern und verstehen, aber nur verstehen, um sie zu verändern. Das führt uns auf eine zentrale Feststellung gegenüber Zeitgemäßheit in der programmatischen Moderne, und insofern bemüht man sich auch seit gut hundert Jahren um Zeitgemäßheit durch Modernität. Es erinnert daran, daß die gesamte Phalanx der Moderne von heiligem missionarischen Eifer der Durchsetzung abstrakt gefaßter Programme erfüllt war. Das gilt für die großen Vertreter der Lebensreformen ebensogut wie für die Bauhäusler, das gilt für die Werkbündler, das gilt für die Gestalter fürs Existenzminimum, das gilt für die großen Designer, die sich endlich den industriellen Fertigungsweisen anpassen wollten, für ihre Gestaltung, um nicht mehr nur vereinzelt aus ihren Ateliers heraus in die Öffentlichkeit verändernd zu wirken, sondern mit Hilfe der entscheidenden neuen Produktionstechnologien. Sie alle sind Missionare gewesen.
Sixten Ringbom, ein schwedischer Historiker der Moderne, hat 1982 aus Anlaß der Ausstellung "Kandinsky in München" zum Beispiel die haarsträubende Orientierung der sogenannten modernen Rationalisten an Steinerschen oder Blavatzkyschen anthroposophischen Theorien nachgewiesen, wobei das Erschreckende war, daß der sogenannte rationale Anspruch der Moderne sich vollständig mit dem deckte, was die Nichtmodernen als Irrationalität fassen wollten, als Widerstandskraft eben gegen diese technische Rationalität. Und es ist erschreckend zu sehen, daß auch diese Rationalität innerhalb der Entwicklung der positiven Wissenschaften auf diese Orientierung hinauslief. Es läßt sich bis auf das Niveau von Nobelpreisträgern für empirische Physik zeigen, daß sie, wie die Künstler insgesamt - Musiker, Literaten, Architekten - und wie alle anderen, die sich als Speerspitzen dieser Modernität ansahen, nie darüber erstaunt sind, daß sich das, was sie anderen entgegenhielten, bis in die letzte Rechtfertigungsargumentation als vollständig mit dem kompatibel erwies, was sie angeblich ablehnten. So kann man zu der merkwürdigen Feststellung kommen, daß die Kennzeichnung als "wahrhaft zeitgemäß" im Sinne einer radikalen Orientierung an der Modernität eigentlich nichts anderes ist als die Ausbeutung eines Naturmechanismus unserer Bewußtseinsmaschine und ihrer Operationen. Wenn ich mich modern nenne, ist damit ausgeschlossen, daß die, gegen die ich mich wende, ihrerseits modern sind. Sie sind durch die bloße Tatsache, daß ich mich als Moderner gegen sie wende, als Zeitgemäßer, als Avantgardist, ihrerseits reaktionäre Traditionalisten und unmodern. Oder wie die Anfangsbeispiele zeigten, wenn ich meine Rüstung als Nachrüstung bezeichne, oder wenn ich mich als Humanisten bezeichne, dann sind alle die, gegen die ich mich wende, folglich nicht Humanisten oder einfach nicht ernstzunehmen.
Wenn wir heute das Pathos der Funktionalität, das Pathos der Rationalität retten wollen gegenüber den kleinen Begeisterungsgemeinschaften, die hinter solchen komischen Gurus wie dem Koreaner Mun und anderen stehen, müssen wir uns schon sehr anstrengen, um überhaupt noch etwas zu retten. Denn wenn man sich die Programmatiken ansieht, dann sind die Argumente dieser Irrationalisten mindestens auf dem Anspruchsniveau, dialektisch oder nicht, das ihre Gegner ihnen als nicht erreicht vorhalten. Die Modernen waren Missionare im Sinne solcher lebensreformerischen Anstrengungen, solcher W eltveränderungs-Programmatiken, und sie haben das Wichtigste innerhalb dieser Programme ausschließlich aus dieser Entgegensetzungslogik, aus der Abgrenzungslogik gewonnen. Man brauchte eben nach diesem Muster - wenn ich Humanist bin und du mein Feind, bist du keiner - nur die ganze Palette der verschmocktesten Begrifflichkeiten durchzubuchstabieren, und dann schrieb sich das Programm der Moderne von selbst, inklusive so merkwürdiger Übereinstimmungen, daß beispielsweise im Dritten Reich gen au das programmatisch exekutiert wurde, was man offiziell ideologisch als "verjudete Modernität" und "Avantgarde" ablehnte, so ein Programm höhepunkt aller Kreativität am Bauhaus wie "Schönheit der Arbeit" ist von den Ideologen des Dritten Reiches ausgeführt worden. Und es macht wohl kaum einen Unterschied, ob wir uns selbst Kraft durch künstlerischen Frevel zugestehen wollen und den anderen Kraft durch Freude: was da faktisch passiert auf dem Luxusdampfer nach Madeira oder USA war dasselbe. Das Erschrecken darüber, daß die Ministerrunden, die Professorenrunden, die Expertenrunden nicht anders ablaufen als jeder normale Stammtisch, hat die Moderne leider nie erreicht. Und das sieht man ihr an: es fehlt ihr an durchschlagender Selbstdisziplinierung. Es ging um Macht, Begriffsdefinitionsmacht, Sprache, Besetzung von kommunikativen Medien, und in der praktischen Darstellung dessen, was da wirklich der Sache nach gemeint wahr, gab es nicht die geringste Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Traditionalisten und Avantgardisten, zwischen Konservativen und Avantgardisten, weswegen sie sich auch so gut verstanden. Sie konnten technisch rationaler Avantgardist im Dritten Reich sein und zugleich Blut und Boden programmatisch vertreten. Heinrich Klotz hat diesen Sachverhalt, als er noch Direktor des Architekturmuseums in Frankfurt war, mit der treffenden Kennzeichnung belegt, daß es in der rationalen Moderne genausoviel röhrende Hirsche im Design und der Kunst gibt wie unter den Kitschiers der Gemütskultur.
Man sieht die Fehlentwicklungen im Selbstverständnis der künstlerischen, wissenschaftlichen, technologischen Avantgarde heute viel klarer als je zuvor, wenn man sich vor Augen führt, welchen Mißverständnissen man in der Verwendung des Begriffs Utopie aufgesessen war. Denn wenn es darum ging, die Welt zu verändern, und sie nur insofern zu verstehen, daß man sie verändern konnte, dann deckte der Begriff Utopie eben genau dieses Programm der Veränderung. Also die Utopie, die Marx schon in aller Radikalität kritisiert hat - nur seine Anhänger haben das nie gehört -: das schön ausgemalte Bildchen einer paradiesisch traumhaften Zukunft, in der man dann nach Belieben schalten und walten konnte, unter Ausschaltung, unter Absehung von dem, was die Welt ist und als was sie verstehbar wa~, sondern nur noch im Hinblick auf solche Omnipotentenzphantasien der Avantgarde, die nur unter gewissen Bedingungen totalitärer Macht ihre Wirkung zeigen, wie in diesem Jahrhundert in Rußland und Deutschland, Italien oder anderswo, und die darauf angelegt sind, die Verschwisterung mit der Macht zu suchen. Daß also auf diesen Begriff der Utopie bereits das gesamte Elend der künstlerisch- technisch-wissenschaftlichen Entwicklung in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts und erst recht jetzt in der computerisierten Zeit bildend geworden er Wissenschaften - und wir haben ja als Künstler nicht mehr das Monopol - hinausläuft. Dabei lag es doch nahe, sich gen au den Utopiebegriff zunutze zu machen, der auf eine vernünftige Weise, und zwar unabhängig von den Schranken links - rechts, Traditionalist - Avantgarde, Rationalist - Gemütskulturler - oder Regionalist - Universalist, vorgegeben war. Utopien sind nur in einer Hinsicht wirklich leistungsfähig für die Künste, für die Wissenschaften: wenn sie als Begründung von Kritik an dem jeweiligen Wahrheitsanspruch irgendwelcher Aussagen genommen wurden. Die Utopien kritisierten die Wahrheit; eine Denkfigur, die es vorher nicht gegeben hat, denn inwiefern sollte man die Wahrheit kritisieren, wenn sie doch unüberbietbar in ihrem Charakteristikum als wahr gewesene verstanden worden ist? Die Kritik der Wahrheit, das war die Kritik an der Natur - dazu kommen wir im dritten und vierten Satz -, unter anderem auch der Natur des Menschen, und vor allen Dingen der Natur unseres Weltbildapparates, unserer Mechanik des Denkapparates, der uns in diese vielen Fallen, diese vielen Annahmen lockte, nämlich zu meinen, es reiche hin, sich abzugrenzen von etwas, indem man ausgrenzt: ich Humanist, du Antihumanist, ich Humanist, du Faschist, ich fortschrittlich, deshalb du reaktionär. Und auf dieser Ebene der Kritik der Wahrheit hat die Moderne total versagt, schlimmer als jedes reaktionäre Regime, das immerhin mit der Wahrheit politischer, wirtschaftlicher Instabilitäten rechnen mußte, um sich selbst an der Macht zu halten. Es gibt keine Kritik der Wahrheit der Moderne in den positiven Wissenschaften, nicht einmal dann, als ein Nobelpreisträger für experimentelle Physik, ohne mit der Wimper zu zucken, die "verjudete" Physik in die Argumentation einführen konnte. Der Mangel an Durchschlagskraft dieser künstlerisch-wissenschaftlichen Avantgardeansprüche im Sinne der Veränderung war die Unfähigkeit der Protagonisten, sich selbst zum Gegenstand dieser Kritik zu machen; denn nicht nur im modernen sprachwissenschaftlichen oder kunsttheoretischen, ästhetischen oder philosophischen Sinne sind Aussagen nur dann etwas wert, wenn der Aussagenurheber auch unter sie fällt. Aussagen, die immer auf die Distinktion, auf die Unterscheidung von innen und außen, von wir und sie, von ich und du, also nach diesem Kartenschema der Logik der Dummheit ausgerichtet sind, sind vollständig leer und phrasenhaft. Die Kritik an den eigenen Wahrheitsansprüchen, ja was wir noch weiter sagen müssen, an der tatsächlichen Wahrheit von Operationen, sei es wissenschaftliche Definition von Naturgesetzen, seien es großartige Planungen von Veränderungen im Städtebau oder in der Industrie, fand nicht statt. Erst da, wo diese tatsächliche Wahrheit kritisiert wird, bestünde ein Anlaß zu sagen, man hätte etwas von der Natur, der Natur der Natur und der Natur des Menschen verstanden.
Die Utopien haben sich in gen au diesem Sinne selbständig gemacht jenseits aller Programmatiken der Moderne, ob sie musikalisch ausgedrückt werden, bildendkünstlerisch, architektonisch, designerisch oder politisch. Die tatsächliche Logik des utopischen Denkens manifestiert sich, wo sich der Utopos, das Nirgendwo, in sich also nicht verortbar, als das Überall demonstriert, etwa im Sinne der Modernität, Entwicklung im Städtebau, Infrastrukturentwicklung, Kommunikationstrukturentwicklung, so daß heute an jedem Ort der Welt die gleichen kommunikativen Infrastrukturen, die gleichen kulturellen Verhaltensmuster, die gleichen Hoteldesigns, die gleichen Programme im Angebot von Hochund Subkultur vorgeführt werden. Das heißt, die Utopie erfüllt sich darin, daß das Nirgendwo des Utopos im Überall realisiert ist. Diese Feststellung machen Sie ja alle, wenn Sie herumreisen, überall dieselben Autos, überall dieselben Interieurs, überall dieselben Phrasenhaftigkeiten des Diskurses, und erst die Kritik an diesem Sachverhalt würde die Utopie im eigentlichen Sinne, nämlich als Potential der Kritik an der Wahrheit, aktivieren. Und es ist wahr, daß sich die Utopie erfüllt hat, daß wir heute die Moderne zusammenbrechen sehen durch den Erfolg, den sie hat, und nicht weil der dumme Pöbel sie abgelehnt hat, nicht weil es immer noch zuviel Unverständnis bei Industrie und Politik, bei den Medien für die Programme der Moderne gibt. Ganz handfest etwa insofern, als das Centre Pompidou mit achtundzwanzigtausend Besuchern pro Tag innerhalb von zwölf Jahren so heruntergewirtschaftet wurde, daß man mit dem Dreifachen der Entstehungskosten von 1977 den Bau jetzt überhaupt erst wieder begehbar machen muß. Wir müssen uns aus dieser larmoyanten Vorgabe des Andersseins, des radikalen Widersprechens gegenüber dem Durchschnittsbewußtsein der Bevölkerung verabschieden; denn eben genau die, gegen die wir angeblich antraten, die Traditionalisten, die Konservativen et cetera, haben, wie wir sehen, die Avantgarde bis in die letzte programmatische Einzelheit erfüllt. Und damit brach diese Programmatik auch für diejenigen zusammen, die immer noch nicht kapiert hatten, daß sie eigentlich ihre Programmatiken selbst einer solchen Kritik der Wahrheit unterziehen mußten, und das etwa hieße, nicht länger diese völlig blödsinnige, leere, phrasenhafte Unterscheidung von Avantgarde und Tradition, von !inks und rechts, von oben und unten, weiter durchzuhalten. Denn wo man im einzelnen nachprüft, wie Avantgarden wirklich funktionieren, wenn es ernstlich heißt, Avantgarden seien diejenigen programmatisch durchgesetzten Bewegungen, die das Neue erzwingen, dann ist das Neue neu und damit bestimmungslos. Von der Natur des Menschen her sind wir aber gezwungen, vor dem Neuen entweder reißaus zu nehmen, es aggressiv zu zerstören - Bilderkampf oder Bilderkrieg - es zu verdrängen oder aber uns tatsächlich von diesem Neuen leiten zu lassen, gerade wenn es bestimmungslos neu ist. Und das ist die Crux für jeden, der heute als Avantgardist komponiert und herausfordernd gefragt wird: Na und, was haben Sie denn damit erreicht, was haben Sie denn da gesagt, was machen Sie denn da? Und er nur sagen kann: Ich mache etwas Neues, und als solches ist es bestimmungslos. Also die vernünftige Art, das zu begründen ist dann, von Altem zu sprechen. Das heißt, wenn jemand auf das Neue abhebt, kann er sich ausschließlich auf das Alte konzentrieren, und das sehen Sie auch bei diesen Avantgarden als tatsächliche Leistung, wo sie neu waren. Bei Adolf Loos in der Architektur, da wurde der Blick von diesem Neuen zurück in das vermeintliche Bekannte, schon bis zum Erbrechen Vertraute zurückgelenkt, etwa zu Brunellesco oder Palladio, und plötzlich entdeckte man die Bestände der Tradition mit völlig neuen Augen, eben unter dem Druck des Neuen, und man entdeckte sie als Geschichtliches in der Aktualität dieser Lawine von heute, nämlich als Bestandteil der gegenwärtigen Diskussion. Darin haben die Avantgarden ihre Orientierung im Sinne einer Kritik der Wahrheit gefunden, nämlich die Behauptung, die Vergangenheit sei das Vergangene, zu widerlegen. Denn wenn wir eine Vergangenheit haben, dann ist sie eben nicht das, was vergangen ist, sondern das, was als Vergangenheit - unsere beispielsweise, die wir jetzt leben - heute wirksam ist. Und das heißt, die Vergangenheit wird vergegenwärtigt, das vermeintlich Vertraute, Bekannte wird unter dem Druck der Neuigkeiten aktualisiert, aber nicht in einem Sinne bloß, "was haben uns die Alten noch zu sagen", sondern in einem Wieder-fremd-Werden, ferner in der Formulierung eines Anspruchsniveaus, das sich darin ausdrückt, daß von diesem vergegenwärtigten historischen Alten das bestimmungslos Neue seinerseits eine Bestimmung bekommt, nämlich traditionell zu sein.
Jedem Avantgardisten geht es so. Nehmen sie einen Maler wie Polke: er bringt es durch sein Werk fertig, wenn es bestimmungslos neu war, den Blick - wenn wir es denn nicht zerstörend verdrängen - auf das vermeintlich Bekannte, Vertraute zu lenken. Dabei stoßen wir per Analogiebildung, der wir von Natur aus unterliegen, auf so ein Werk wie das von Picabia. Und plötzlich erweist sich dieses längst abgehalfterte Werk von Picabia in seiner künstlerischen Programmatik als absolut zeitgemäß, sozusagen in der Formulierung von Polke; die höheren Geister, die ihm befahlen, jetzt rechts Quadrat oder Rechteck oben links rot anmalen, haben sich eingestellt, indem sie das eigentliche Ziel seiner künstlerischen Operation verwirklichten, die Vergegenwärtigung des vermeintlich abgestandenen Traditionellen als Bestandteil der Gegenwart vor Augen zu stellen und dadurch selbst eine Bestimmung seines Werkes zu erfahren - er wurde selbst Großmeister von Picabia her -, und dann unterliegt er natürlich demselben Schicksal wie alle Großmeister: jetzt wird sein Werk langsam redundant, jetzt wird das aufgefüllt mit Bestimmungen von uns, die wir alle Unterscheidungen leisten, die wir alles schon zu kennen glauben, und Papa und Mama sprechen dann vom Veralten der Avantgarde, hämisch vorwurfsvoll, anstatt zu sagen: Donnerwetter, da hat endlich mal jemand kapiert. Das gibt es reihenweise in diesem Jahrhundert. Ich will nicht sagen, daß wir nicht glücklich sein sollten in diesem Jahrhundert mit der Kunst, der Architektur et cetera, wo sie diese Leistungen erbrachte, soweit gehend, daß wir sagen können, Avantgarde ist überhaupt nur das, was die Tradition auf vollkommen neue Weise zu bilden verpflichtet oder zwingt, das heißt im ganzen also die Gesamtheit künstlerischer oder architektonischer oder intelligenter technischer oder philosophischer, literarischer, musikalischer, historischer Ereignisse als in der Gegenwart bedeutsame virulente Kräfte darzustellen, denn nur dann, wenn sie in der Gegenwart kräftig sind, haben wir sie als Vergangenheit. Was nützt es, von einer Vergangenheit zu reden, die wirklich vergangen wäre? Warum sollten wir uns darum kümmern? Dann wäre das ganze bildungsbürgerliche Gefasel, etwa die Beschäftigung mit der Entstehung der Oper Anfang des siebzehnten Jahrhunderts, das wäre alles leeres Stroh. Der Logik der Sache nach ist diese Vergangenheit nur eine, wenn sie nicht vergangen ist.
Und nun kommt der entscheidende Sprung, da diese Veränderer, die nur verstehen wollen, um zu verändern, also eigentlich nichts verstehen wollen, das ganze Spiel jetzt auf die andere Zeitdimension, nämlich die Zukunft, übertragen, und auch da gibt es Beispiele für Leute, die sich dieser Kritik der Wahrheit gestellt haben, aber die Mehrzahl- die Missionare der Lebensreform, der Kraftdurch- Frevel-oder-Freude-Akrobaten - hat, programmatisch gesehen, die moderne Rationalität, die A vantgarde, das Ziel nicht erreicht. Denn es ist ganz einfach sich klarzumachen: Ist man auf eine Zukunft orientiert, dann kann sie nicht in einer bilderbuchfernen, ausgemalten, utopischen Dimension des Dermaleinst irgendwo angenommen werden. Haben wir eine Zukunft, dann werden wir jetzt mit ihr rechnen, sonst ist sie nicht unsere. Wenn wir aber jetzt mit der Zukunft rechnen, und das hat zuerst Giorgio Vasari, der erste große Künstlerpsychologie- und Werktheoretiker, an seinen Beispielen zur Planung von Werken gezeigt: dann werden wir jetzt die Zukunft realisieren. Denn eine Zukunft, die nicht jetzt ist, ist keine, ebensowenig wie eine Vergangenheit, die nicht jetzt gegenwärtig ist, keine Vergangenheit ist. Die Unternehmer haben das klarer und eindeutiger gesehen als die künstlerische Avantgarde. Wenn sie Kredite aufnahmen, dann realisierten sie die Zukunft als potentiale Handlungsmöglichkeit der Einwirkung, also auf das Erzeugen dieser Zukunft: Jetzt, wo sie Kredite aufnehmen, jetzt wo sie investieren, jetzt wo sie entscheiden. Und sie entdeckten dabei, daß eine Zukunft nur dann - in einem erheblichen Sinne, nicht in diesem utopischen Larifari - definierbar ist, wenn sie das gegenwärtige Handeln bestimmt. Gehen Sie von Vasari mit den Theoretikern des Werkschaffens bis zu den Großpathetikern aufwärts!' Heidegger ist wahrscheinlich der größte Meister der Werkplanung unter den Künstlern, Intellektuellen, Philosophen in diesem Jahrhundert. Im vorigen Jahrhundert war es Richard Wagner: bis 1848 das gesamte Werkgebäude gebaut, komplett abgeschlossen mit einer inneren Logik sondergleichen, bis "Parsifal" als Ende genau minuziös geplant. Daran müssen Sie sich orientieren, wenn Sie eine Zukunft haben und nicht zu den Leuten gehören wollen, die den Fehler begingen, sich hinauskatapultieren zu lassen in die Zukunft, als kämen sie von dort, mit ahnungsvollem Rauschen im Ohr, prophetischem, englischem Dröhnen, um allen anderen zu sagen, sie wü.ten schon etwas, das die anderen nicht wissen; lachhaft diese Rede von der künstlerischen Sensibilität in der Vorwegnahme der Zukunft, Erspüren von Tendenzen, alles Quatsch. Sie machen die Tendenzen, indem Sie jetzt diese Werkkonstruktionen und Planungen realisieren, und sie zu einer Logik der Fortführung, der Wiederholbarkeit zwingen. So ein Werk ist nichts anderes als eine ermöglichte Wiederholung der grundsätzlich schon mal vorgegebenen Akte schöpferischer, künstlerischer, unternehmerischer, intellektueller Setzungshandlungen. Und jeder, der komponiert oder malt, weiß, wie unglaublich stark diese Selbstsetzungen durch denjenigen, der da vor der Leinwand steht oder vor dem Papier sitzt, wirken, daß sich das nicht mehr auf seine private Willensentscheidung, auf seine Vorlieben reduzieren läßt, sondern tatsächlich der Logik der Produktion folgt. Ebenso wie sich die Logik des utopischen Denkens weit entfernt von den utopischen Bildchenmalern realisiert als Nirgendwo im Überall, so realisiert sich diese Orientierung der Zeitdimension, im sogenannten ukronischen Arbeiten, und für Komponisten ist ausschließlich die ukronische Dimension entscheidend, weil sie mit Zeitverlaufsformeln arbeiten. Daß auch im ukronischen Sinne diese Orientierung ausschließlich dann besprechbar, also wirklich aufweisbar ist, wenn sich dieses Niemals, Ukronos, die Nicht-Zeit, die nicht verzeitlichbaren Prozesse, die nicht zeitbestimmbaren Vorgänge, als Jederzeit erweisen, auch das ist inzwischen der Fall. Nämlich genauso, wie die Welt inzwischen total utopisch geworden ist, indem von Sydney bis Eskimonien, von Afrika bis Los Angeles dieselbe Kommunikation, dieselben Fernsehprogramme, dieselben Autos, dieselben Eisschränke, dieselben Arten zu denken, dieselbe journalistische oder künstlerische Arbeit anzutreffen sind, so verwirklicht sich unsere in raffinierten Werkschaffensformen erzeugte Konstruktion von Zeitlichkeit als Erzwingungsstrategie von Zukunft in der Ukronie, also im Niemals als Jederzeit. Die Avantgardisten, von denen wir in genereller Hinsicht sprechen, akzeptierten nie, daß die entscheidende Dimension von Ewigkeit, von Orientierung auf Kontinuität im Werkschaffen, von Schaffen der Zukunft selbst, im Augenblick liegt. Ein Mann wie Goethe als Theoretiker und Praktiker hat das gewußt. In unserem Jahrhundert ist das wenigen zuteil geworden, weswegen sie fälschlich erweise die Leute, die auf die Ewigkeit fixiert blieben, also auf den Augenblick, als ahistorische, abgestandene Fossilien behandelten. In Wahrheit gibt es keine andere Möglichkeit im Hinblick zeitstrukturellen Aufbauens von Kontinuitäten als die Erkenntnis, daß sich die Utopien jetzt im Überall, und die Ukronien im Jederzeit, in jedem Augenblick realisiert haben, dadurch wird es uns hoffentlich nicht mehr so leichtfertig möglich sein, uns selbst utopisches Denken im Sinne von Antizipation der Zukunft oder spintisierendem Herumhorchen im Kosmos oder an der Brust des lieben Gottes oder am Pulsschlag der Evolution auszugeben, sondern in Konkurrenz zu Unternehmern, zur Politik, zum Militär, die alles bewirkende Entscheidung auf den Augenblick zu orientieren.
Ich bin jetzt schon über fünfundsechzig Semester Hochschullehrer und habe das Vergnügen, jedes Jahr dasselbe wieder an Studenten zu bemerken. Sie haben studiert, wenn sie wissen, daß sie das Produzieren, das Formulieren nicht auf morgen verschieben können, nicht auf den Tag des besseren Einfalls, nicht auf die Grundinspiration, der sie nachhängen. Sondern jetzt ist der Augenblick, jetzt wird die Aufgabe angegangen, jetzt wird es geschaffen. Und wer das tut, wer nicht alle zwei Minuten das Ganze wieder in den Papierkorb schmeißt, spazieren geht und sich erstmal entlasten oder inspirieren muß, der erzeugt plötzlich diese in Zukunft erwartete große Imagination, und das verbindet den guten Utopisten und Ukronisten als Kritiker der Wahrheit mit dem Handwerker als der ältesten Form der Besorgung des Menschen im Sinne der Verortung beziehungsweise Toposbildung, ob das nun mental oder weltlich gemeint ist, und mit der Ukronie. Schlußendlich ist das die Tugend des Handwerks. Zwar gibt es auch da eine Dimension der Planung, der Antizipation, aber nur insofern, als sie augenblicklich, in jedem Augenblick und in jeder Zeit, an jedem Ort realisiert werden kann. Und das gilt auch für den Wissenschaftler, denn wenn Sie ein Experiment machen, etwas daraus ableiten, dann zählt das, was Sie daraus ableiten nur, wenn es an jedem Ort der Welt jederzeit beliebig wiederholbar ist und dasselbe Resultat dabei herauskommt. Das tut unserem großem Anspruch, in intellektueller Hinsicht anderen Kalibers zu sein als der Handwerker, gar keinen Abbruch, und das haben in diesem Jahrhundert die besagten fähigen Kritiker ihrer eigenen Wahrheit auch bewiesen, darunter sehr viele Mathematiker. Soviel zum zweiten Satz der rhetorischen Oper zur Erzwingung des Gefühls von Zeitgenossenschaft.
Irritatio
Dritter Satz - Irritatio. Die entscheidene Irritation stellt sich ein nach der Einsicht, daß wir als Avantgardisten nicht durch Mißachtung, Verfolgung, KZ, entartete Kunstkampagnen niedergeschmettert wurden, sondern durch unseren Erfolg, und daß wir das Klassenziel verfehlt haben, uns als Werkschaffende selbst zum Gegenstand der Kritik zu machen, der wir die gesamte Restwelt unterwerfen wollten, also die Industrie und den Verkehr und die Politik und das Soziale; überall wissen wir, wie grandios man in diesen Bereichen versagt hat. Nur an unserem eigenen Schaffen unterziehen wir uns dieser Kritik nicht, und solange wir das nicht tun, ist das nichts wert, was wir machen. Die entscheidene Irritatio über den Zustand der künstlerischen Zeitgenossenschaft liegt, glaube ich, für jeden, der praktisch arbeitet, in dem Verschwinden des Adressaten. Wie unter anderem schon einmal historisch vorher im Verschwinden des Auftraggebers eine entscheidene Irritation lag, als die Niederländer im siebzehnten Jahrhundert begannen, nicht mehr für einen Hof, nicht mehr für einen persönlich bekannten Auftraggeber zu arbeiten, sondern für einen blinden Mark, und die Erfahrung machten, daß sie sich bestenfalls als Bilderhändler im Sinne der röhrenden Hirsche für das aufstrebende Bürgertum betätigen konnten, denn als Genien - Vermeer hat in seinem Leben beispielsweise nicht ein einziges eigenes Bild verkauft, sondern war Kunsthändler, erfolgreich im Absatz eben der röhrenden Hirsche -, so ist jetzt die Irritation über das Verschwinden des Adressaten zu bemerken.
Nun hat es natürlich vor der Entwicklung der Künste durch die großen Mäzene, durch die großen Planer - Mäzen ist eigentlich niemand anderes als jemand, der darauf besteht, selber an der Entwicklung eines planerischen Werkes beteiligt zu sein - schon einmal eine Orientierung gegeben, die sowohl auf den irdischen Adressaten wie auf den Auftraggeber verzichtete. Es ist glaubhaft, daß gotische Künstler nur zum Ruhme Gottes arbeiteten. Und es sieht so aus, als ob gegenwärtig viele Künstler - sagen wir mal noch schwache Modernisten, also Leute, die es noch nicht ganz kapiert haben, daß mit dieser Art von Kennzeichen kein Hund mehr hinter dem Ofen hervorzuholen ist - sich damit wieder anfreunden können. Aber vielleicht ist es nicht allein zum Ruhme Gottes, sondern solo mea gloria, eine Art von Nihilismus, der den Nihilismus ablöst. Das gibt es nun als soziologische Unterfütterung in der Behauptung einer individualistischen Gesellschaft, eines fortwährenden Drucks zur Individualisierung.
Uns reicht die Feststellung, daß offensichtlich viele händeringend darum bemüht sind, endlich wieder ihren Adressaten zu finden, so wie wir im Politischen ums Ganze bemüht sind, nachdem wir unseren entscheidenden Adressaten, nämlich den Ostblock, verloren haben und damit die Stabilität in den Weltverhältnissen. Die Stabilität im Kunstmarkt, die Stabilität in der Avantgardebewegung ist zusammengebrochen, weil wir auf der anderen Seite nicht mehr die haben, die wir als reaktionäre Traditionalisten, bürgerliche Trottel, bourgeoise Idioten beschimpfen können, um uns in diesem Mechanismus von ihnen abzusetzen, und das ist peinlich. Diejenigen, die selber wissen, daß sie immer vertrottelte Reaktionäre sein mü.ten - jeder Mensch muß das in gewisser Hinsicht sein - oder privatistische, also römisch gesagt, idiotische Helden der Selbstinszenierung, die haben wenigstens einen hinreichenden Anlaß, mit sich selbst in Konflikt zu geraten, ein Grundmotiv, das man bei Künstlern sehr häufig findet. Aber aufs Ganze gesehen krankt die Formulierung des Aussageanspruchs der Moderne und ihrer Vertreter gegenwärtig daran, daß kein Adressat mehr da ist: weder als Käufer noch als Publikum, was besonders gravierend ist. Und Sie sehen, daß sich immer mehr etwas einstellt, was beispielsweise ein Repräsentant der Kunstakademie in Düsseldorf bei seinen allwöchentlichen Zeremonien in der Paris bar in Berlin betreibt, nämlich daß die Künstler auf der ledergepolsterten Bank mit dem Sektglas in der Hand sitzen, über das Elend der Welt philosophieren und dann in schneller Folge Verwünschungen dieses dämlichen Publikums ausstoßen, von dem sie aber gleichzeitig mit Empörung feststellen, daß es nicht in der Lage ist, ihnen zu huldigen. Eigentlich eine merkwürdige Figur, man sagt, da sind gar keine äquivalenten Köpfe, für wen musiziere ich, denke ich, male ich denn da eigentlich? Die Leute, die dahin kommen, sind ja gar nicht in der Lage zu kapieren, was ich mache. Ich habe acht Monate, zweiundzwanzig Monate, weiß der Teufel was, an diesem einen Werk gefeilt, und jetzt kommen diese Trottel, diese unterhaltungssüchtigen Idioten, und wollen in fünfundzwanzig Minuten oder zwei Stunden Theateraufführung, Musikvorführung kapieren, was ich da Großartiges gemacht habe. Und gleichzeitig ist alles, was diese Künstler vortragen, im Hinblick auf ihre Durchsetzungsfähigkeit damit begründet, die Anerkennung eben dieser Idioten zu finden. Also der besagte Repräsentant der Düsseldorfer Akademie hat das inzwischen kapiert und klärt nun durch sein Verhalten die um ihn sitzenden Junghuldiger auf, denn er hat ja das Programm an der Akademie: Kunst wird nur daraufhin gelehrt, daß die Schüler lernen, ihren Meister zu verehren. Das ist eigentlich ein vormodernes Programm sagen wir mal gotischer Kunstgemeinschaftsbildung.
Wer hat denn bisher den Künstlern garantiert, daß sie Adressaten hatten? Es waren eben diese bescheuerten bürgerlichen Kunstvereine, es waren diese bis zur Selbstaufopferung arbeitenden, schuftenden Frauen von Mittelständlern, Oberschichtangehörigen, Zahnärzten, Architekten, die seit den achtzehnhundertzwanziger Jahren selbst in der kleinsten deutschen Stadt noch einen Kunstverein aufbauten, da irgendwo am gelegenen oder ungelegenen Ort noch eine kleine Ausstellungshalle einrichteten und sich mit großer Mühe darum kümmerten, ab den siebziger Jahren auch die Arbeiterschaft noch zu bilden, damit sie sich als Adressat auf diese großen Leistungen der Künstler ausrichten konnte. Es war ferner die seit Mitte des achtzehnten Jahrhunderts entwickelte Kunstkritik, die den Küntlern ihr Publikum schuf - wenngleich sich die Künstlerschaft stets verächtlich auf diese journalistische Abfallverwertung orientierte. Es waren auch der Kaiser von Österreich bei der Eröffnung des Wiener Kunstgewerbeinstituts 1870, die etwas vertrottelten Herren aus dem Gewerkschaftsoder Lassalle-Umkreis, die so etwas wie Arbeiterkulturprogramme entwickelten, und so alte Herren wie ich jetzt aus der Universität, die plötzlich Volkshochschulen in den achtziger Jahren gründeten und den Ereignissen so ein Publikum boten. Und das war auch für die wirtschaftliche Entwicklung entscheidend. Der Kaiser war nicht nur feingeistig orientiert, sondern er sah, daß er der Konkurrenz gegenüber England, Frankreich und Deutschland nur einen entscheidenden Vorteil erlangen konnte, wenn in Österreich nicht die Produzenten gefördert und erzogen wurden, sondern die Rezipienten. Er sah, daß die Entwicklung der Wirtschaft abhing, von der Professionalisierung, von der Geschmacksbildung, von der Unterscheidungsfähigkeit der Käufer. Schulen für angewandte Künste, angewandte Gewerbe et cetera wurden bezogen auf die Ausbildung der potentiellen Adressaten als Musikhörer, Bilderbetrachter, aber eben auch als Produktkäufer, gegründet. Geschmacksbildung hieß das, was für die Avantgardisten bloß wieder eine zu Ekel führende Mottenkugel war. In Wahrheit ist es das A und 0, denn Geschmack hat jemand, der unterscheidungsfähig ist. Der kann ein monochromes Bild von einem anderen unterscheiden, das ist die höchste Qualifikation einer Unterscheidung. Oder denken Sie an Ihre Musikentwicklung der letzten Jahre, nicht wahr, so kleine Verlaufsfolgen, die man nur noch thematisieren kann, wenn man extrem geschult ist.
Wenn wir heute sagen, daß die historische Avantgarde dieses Jahrhunderts zerstört wurde durch Erfolg, dann werden ihre Nachfolger, die sich jetzt auf sie berufen, gegenwärtig zerstört durch die Unfähigkeit, sich auf die Bedingungen einer Kommunikationsgesellschaft einzulassen, in der es eben nicht selbstverständlich ist, wie in einer ständischen Gesellschaft, etwa am Hofe, daß man laut Programm schon zu Gehör kommt, und sei es beim barocken Essen, sondern daß die entscheidende Rolle darin besteht, überhaupt jemanden zu finden, der bereit ist zuzuhören. Ich selber habe das erst durch Joseph Beuys gelernt. Beuys zog - ähnlich wie ich jetzt - jede Woche auf -zig Veranstaltungen, und man fragte ihn, ob der große Meister nichts Besseres zu tun habe, als da mit fünfzehn oder zwanzig Hausfrauen in Kassel zu tagen. Vor allem seine Käufer und Galeristen sagten: Mensch Joseph, bleib zuhause, male was, ist egal was, wir nehmen es dir ab, mach noch ein bißchen hier und da, aber nicht immer rumreisen, die Zeit verplempern, und der Beuys sagte dann: "Hört mal, ihr Idioten, wenn ihr noch nicht kapiert habt, daß das, was ich mache, ausschließlich davon abhängt, daß ich die Gnade habe, daß mir jemand zuhört, dann habt Ihr von dem ganzen Geschäft, das ich betreibe, überhaupt nichts verstanden." Das ist grundlegend für die Haltung von jemandem, der unter diesen Bedingungen utopischen, ukronischen Planens, des Erzeugens der Zukunft, arbeitet. Produkte herzustellen, Werke zu verfassen, Leinwände zu bemalen, das kann doch jeder Trottel mit ein bißchen Verstand oder ein bißchen Kapital, ein bißchen Ausbildung, und wir sehen das, kriegen das ja vorgesetzt nach dem Motto: "Ich war vier Jahre auf der Kunstschule, also gucken Sie hin, was da hängt, ist Kunst." Aber es fertigzubringen, andere Menschen in einer kommunikativen Beziehung auf so subtile Unterscheidungskriterien einzulassen, wie sie notwendig sind, um monochrome Malerei zum Thema zu machen, das ist ein Meisterstück.
Große Meister sind heute diejenigen, die nicht mehr nur die Seite des Produzenten mit Brutalität zur Geltung bringen, sondern die es schaffen, ihre Zuhörer, ihre Zuschauer zu professionalisieren, und die dann in der Tat unter Gleichen arbeiten; das heißt, die Rezeption, die Rezeptionszeiten und -modi gleichen sich immer mehr den Produktionszeiten an. Es ist keine Marotte, acht Stunden in einem Konzert zu sitzen oder sechs bis achtzehn Stunden Aufführungen von Werken der Bühne beizuwohnen, auch wenn das häufig so aussieht, als ob das nur kuriose, anmaßliche Handlungen von Meisterregisseuren wie Peymann und Stein seien. Wagner wußte, warum er die Leute zwang, vier Stunden auf dem Stuhl zu sitzen und zuzuhören. Bei vier Stunden Zuhören an einem Stück wandeln sich die Rezeptionsverhaltensweisen komplett. Da ist es eben nicht mehr möglich, mit einem kleinen beiläufigen Aha-, Oh-je-, Kenne-ich-schonNicken, freundlichem Beifall davonzukommen. Da merkt man, daß das Rezipieren, allein schon diese Form des qualhaften Sitzens, eine geistige Anstrengung, eine Leistung ist, da merkt man plötzlich, daß wir in unserem Bereich, wie in jedem unter Menschen, nur Erfolg haben zu kommunizieren, wenn wir sehen, daß wir parallel produzieren, die Aussagenden und die Zuhörenden, die Malenden und die Betrachter, die Komponierenden und die Zuhörer. Und erst dann, wenn es zur parallelen Prozessierung in den Köpfen der Beteiligten kommt, wird der Gegenstand der Erörterung, das Thema, das Werk im alten Sinne, überhaupt sichtbar. Deswegen sollte man nicht zu heikel, zu leichtfertig davon sprechen, daß uns heute das Publikum von der Stange geht. Denn der Gutteil der Aufgaben, die wir haben, liegt nicht mehr darin, irgendjemandem irgendwas vorzusetzen, was wir uns ausgedacht haben, sondern andere dazu zu bringen, sich mit uns gemeinsam auf Themen, auf Probleme einzulassen, und die mit Distinktionskriterien abzuhandeln, die eben nicht jeden Tag in der Straßenbahn oder bei einer Party oder sonst irgendwo verwendet werden.
Mediale Artefakte
Vierter Satz - Mediale Artefakte. Die gesamte Problematik - zum Beispiel im Hinblick auf diese Distinktionslogik: "ich gut, du böse, ich Humanist, du Faschist" - wird heute von Naturwissenschaftlern über weite Strecken viel intelligenter gehandhabt als von Künstlern, Architekten, Musikern, indem sie, angestoßen durch die Revolutionstheoretiker, Biologen der Erkenntnis, Soziobiologen und so fort, kapiert haben, was es im Sinne dieses Großprogrammatikers und der großen Humanisierungsprogramme der Moderne nur zu verändern gilt, indem man versteht: nämlich sich selbst, die Natur des Menschen, das heißt die Tatsache, daß wir zu neunundneunzig Komma neun Prozent ausschließlich mithilfe der völlig von uns losgelösten Mechanik unseres Weltbild apparates operieren. Man muß sich mal wieder klar machen: unser nächster Verwandte in der Primatenreihe ist der Bonobo, und der unterscheidet sich von uns bei ganz gro.zügiger Schätzung um eins Komma sieben Prozent des genetischen Materials. Diese grandiose Überschätzung des Menschen, der Willensfreiheit, des Bewußtseins, des einzigartigen Werkzeug- und Sprachgebrauchs: alles Tinnef. Werkzeuggebrauch gibt es in der Tierwelt wie Sand am Meer, sogar reflexiven Werkzeuggebrauch, das heißt, das Herstellen des Werkzeugs wird selbst mit Werkzeugen betrieben. Es ist völlig unbestreitbar, daß es in der Tierwelt, von der wir uns durch diese Distinktion unterscheiden wollen, Sprache, Be-' wußtsein, Werkzeuge, in jedem heute gültigen oder überhaupt diskutierbaren Sinne, sprachliches Verhalten und Bewußtsein gibt. Ja sogar die spezifische Adaptation der Kommunikationsformen anderer Spezies für sich selbst. Vögel werden in ihrem kommunikativen Verhalten, nämlich Ortung von Feinden, die sich auf dem Boden bewegen, von Affen oder Meerkatzen oder was auch immer, genau verstanden, und sie können unterscheiden, ob es sich jetzt um eine Warnung vor einer Schlange oder einem Raubtier anderer Art handelt. Wir können nur sehr wenig anführen im Hinblick auf diese Unterscheidung von uns selbst gegenüber der Natur, deren Produkt wir - auch in unserer alltäglichen Kommunikation - sind und noch bis zu einem unglaublich hohen Grade bleiben werden, denn der allerüberwiegende Teil dessen, was wir so als großartige schöpferische gedankliche Produktion betreiben, ist nichts anderes als genetische Vorgabe und neurophysiologische Mechanik. Mechanik des Denkens, Denkfallen, optische Täuschung kennt heute jeder, begriffliche Täuschung ist immer noch schwer zu thematisieren; es gibt sie aus der Logik der neurophysiologischen Operationen unseres Neuronen- Gewebes notwendigerweise. Aus dieser Tatsache haben die Erkenntnisbiologen, die Soziobiologen, die Kulturgenetiker geschlossen, daß wir uns füglich zunächst mal auf das Verstehen orientieren sollten, indem wir unsere eigene Natur, und das Programm heißt Hominisierung, erkennen und damit, was denn nun den Homo sapiens sapiens ausmacht, nämlich daß er sich selbst als ein Produkt der Natur erkennt und sich seiner eigenen Wahrheit bewußt ist, in diesen neurophysiologischen, hormonellen Mechaniken oder im Immunsystem zu arbeiten und nicht irgendwe1che krausen Phantasien über Gott und die Welt, die Zukunft und die Vergangenheit losläßt, sondern sich kennt als etwas so natürlich Beschreibbares, bevor er wieder anfängt, die große mißverstandene Utopie im Sinne grandioser Humanisierungsphantasien in die Welt zu lassen. Bevor jemand aus einem Werk in irgendeiner Hinsicht begründbar den großen Entwurf eines zukünftigen paradiesischen Daseins der Menschen auf Erden, den herrschaftsfreien Dialog und Kommunikation erkennen will, soll der mal gefälligst sehen, was ein Werk auf seiner materiellen Ebene der Konstruktion eigentlich ausmacht, Note für Note, Punkt für Punkt, Wort für Wort, was das überhaupt heißt, ein Werk zu produzieren und nicht einfach sozusagen aus dem Mechanismus, der unser Illustrationsverlangen in der Programmusik etwa realisiert, heraus zu glauben, das Werk bestünde darin, bei uns schöne Gefühle oder Vorstellungen zu erzeugen - es geht also um Hominisierung statt Humanisierung - oder darum, sich endlich einzulassen auf die Natur der Sache, bevor man glaubt, sie wieder überw.ltigen zu können.
Das Auffälligste aller Resultate dieser Forschung der letzten zwanzig Jahre ist, daß die Kultur inklusive Philosophie und Malerei et cetera keineswegs die Überwindung der Natur ist oder das ihr Übergewölbte, sondern ausschließlich die andere Seite. Denn wir werden von Natur aus zu kulturellem Verhalten gezwungen. Wir sind von Natur aus Kulturwesen, und was wir uns einbilden als großartige schöpferische Leistung unseres gottähnlichen Vermögens anzusprechen, ist nichts als hundsgemeiner Zwang, wie Odo Marquardt als Antwort auf Gehlen und andere formulierte: die Kultur ist das, wozu uns die Natur zwingt, das, was also die Anthropologen oder die Naturwissenschaftler untersuchen. Die Kultur ist die Natur des Sozialen, und wenn man lernt, musikalisches, bildnerisches, architektonisches, politisches, Stadtentwicklungs- oder Werkschaffen als Natur des Sozialen zu sehen, dann wird man kritikfähig im Hinblick auf das, was da tatsächlich abläuft. Ich habe die Jungs da alle noch erlebt, wie sie da saßen an ihrem Planungstischchen, ganz berühmte Geister, und auf dem Tisch ein paar Klötze hin- und herschoben. Diese Klötze symbolisierten spätere zu bauende große Blöcke in städtischem Ambiente. Und dann wurde hin- und hergerückt, nein, das ist noch nicht ganz stimmig, etwas weiter nach links, noch ein bißchen drehen, und sie philosophierten darüber herum, was sie da für grandiose Konzepte in der Architektur zur Förderung der sozialen Kommunikation empfanden. Und was ist dabei herausgekommen? Wie immer, wenn man nicht kapierte, daß es die Natur des Sozialen ist, ist das, was wir kulturell produzieren, ein KZ, bestenfalls etwas, was man als Gefängnis benutzen konnte, oder als Kaserne. Seit Vincenzo Scamozzis Zeiten, dem ersten Großutopiker in dieser Art in der Kunst im sechzehnten Jahrhundert, ist das bekannt gewesen. Wer sich auf die Absetzung von der Natur des Sozialen, von der Natur des Menschen, von der Art unserer Weltbildlogiken einläßt, landet bei dann sehr leicht totalitär werdenden Operationen - nicht, weil böse Menschen das in Dienst nehmen, sondern weil diese Operationen aus sich heraus totalitär werden. So mußten diese großen Stadtplaner vom Reißbrett herunter erleben, daß ihre besten Absichten in dieser Art von Enthobenheit der Natur gegenüber schließlich bei der Planung von KZs landeten, und jetzt schreien sie darüber, "das müssen wir abreißen", was vor zwanzig Jahren noch die Eröffnung der größten Sozialutopie gewesen ist, was sie glaubten, als Befreiungstat gegenüber diesem selbstvergessenen, inhumanen neunzehnten Jahrhundert und seinen Städtebaublöcken in Berlin oder wo auch immer hervorheben zu können.
Chorweiler in Köln etwa erwies sich in diesem Sinne, in der Logik dieser Abgehobenheit von der Natur als totalitärer, tödlicher als jede Berliner Blockbebauung des neunzehnten Jahrhunderts, und das nicht, weil die Menschen oder die Vermieter böse sind. Das gilt auch für die Musik, beispielsweise für die Berieselungsmusik in Fahrstühlen, Restaurants, auf Bahnhöfen, wie gerade erlebt. Man muß den Leuten gar nicht unterstellen, verkaufsfördernde Absichten zu haben, obwohl die ja ganz ehrenwert sind, wenn wir heute dem Terror dieser Dauerberieselung unterliegen. Es sind die tatsächlich auch von Experten gestützten Behauptungen, uns würde da jenseits unserer natürlichen Beschränktheiten, Abhängigkeiten durch diese kulturelle Zutat eine Orientierung, etwas ganz anderes ermöglicht als unsere Natur es selber bietet. Die Zahnärzte sind ja begeistert, wenn man ihnen sagt: "Schalten Sie das bitte aus, wenn ich bei Ihnen sitze, besteht das größte Erlebnis in meiner Angst vorm Zahnarzt oder dem Schmerz, den Sie mir da zu produzieren drohen, und meiner Fähigkeit, damit umzugehen, mit meiner eigenen Natur zu rechnen, anstatt von Ihnen hier voll gedudelt zu werden."
Anderes Beispiel: auf Amrum, dieser wunderbaren kleinen Insel für Menschen wie mich, gibt es seit dreißig Jahren kein einziges Restaurant mehr, bei dem man essen kann im Sinne des Erfahrens seiner eigenen Natur gegenüber Nahrungsquellen, Kommunikation und so weiter. Es wird einem eine wunderbare Wohltat verpaßt, indem aus den Lautsprechern diese kulturell wohlmeinenden, hochrneinenden, hochmögenden Angebote gemacht werden, und ich meine: wirklich nicht aus Böswilligkeit. Die Leute, die man da befragt, die sagen, ja das tun wir doch hier nur Ihretwegen. In Kaufhäusern in Wuppertal kommt man bei Peek & Cloppenburg in so ein Areal, da gibt es vier verschiedene boutiquenähnliche Ecken, und aus allen vier Ecken tönt irgend was aus dem Lautsprecher und nicht etwa Volksmusik oder so etwas, nein, wie gesagt, wie heute gehört, Furtwängler, Wiener Philharmoniker I952, Brahms' Erste Sinfonie. Sie können derartig Anspruchsvolles hören, und zwar mit dem Hinweis darauf, was denn nun wirklich bis heute diese Aufführung zu einer der größten, je reproduzierbaren Aufführungen von Brahms' Erster Sinfonie macht, Sie können das auf allen Ebenen erleben innerhalb der Universitätsprogramme, der Kliniken, der Kaufhäuser et cetera. Und das liegt daran, daß diesen humanistischen Beglückungsakrobaten jede Einschätzung der Natur unserer Rezeptionsweise et cetera fehlt. Immer noch Humanismus statt der Hominisierung, die notwendig wäre.
Meritatio
Fünfter und letzter Satz in dieser kleinen rhetorischen Oper zur Erzwingung des Gefühls von Zeitgenossenschaft: die Meritatio, also deutsch: die Danksagung. Wenn ich mich selber - und zwar auf der persönlichsten Ebene - befrage, was ich eigentlich den Avantgarden dieses Jahrhunderts oder denen, die in diesem Jahrhundert überhaupt etwas taten, verdanke, dann zum Beispiel, daß ich, obwohl noch als Kriegskind mit Panzerfaust hinter russischen Tanks her, und trotz vier Jahren Lagerlebens mit Lindenblatt- und Rindenfressen noch nicht im Gefängnis gesessen habe. Aber auch nicht als Willens- oder besser als Konsumfreiheit feiern mußte oder tarnen mußte, was es mir erlaubte, mit sozialen Gratifikationen Selbstzerstörung zu treiben und mir dabei applaudieren zu lassen. Dankbarkeit dafür, daß ich noch Zeit hatte und vielleicht auch noch Zeit habe - nicht wegen der individuellen Lebens-, sondern wegen der Epochenzeit - unsere Natur, vor allem die Natur des Werkschaffens, also die Natur der Kultur, kennenzulernen, und nicht mehr in so viele Denkfallen, ideologische Fallen zu rennen, wie sie im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert aufgestellt wurden, und nicht zuletzt von Künstlern aller Sparten. Ich verdanke und schulde Dank den Künstlern, die die Kritik der Wahrheit sich selbst gegenüber tatsächlich durchgehalten haben, und die kapierten, daß dieses Jahrhundert nicht mehr wie die naiven Geniekultler früherer Zeiten darauf warten muß, von Künstlern, ausgerechnet Musikern, Literaten, bildenden Künstlern, die Sensationen des Außerordentlichen zu erhalten, des noch nie Dagewesenen im Sinne der Überwältigung, des Überraschens durch etwas noch nie Gesehenes, sondern daß sie mir und anderen klar gemacht haben, welche außerordentliche Sensation das Alltägliche, das Selbstverständliche, die Normalität bildet. Individuell war das für mich leicht, denn ich hatte als Kriegskind erfahren, daß eigentlich nichts weniger selbstverständlich ist als das Selbstverständliche. Daß es eine Sensation darstellt, morgens in den Supermarkt zu gehen und die Milch auf dem Regal mit der Aufschrift "Milch" und das Brot in dem Regal mit der Aufschrift "Brot" zu finden, daß die Straßenbahnen fahren und die Bundesbahn mehr oder weniger pünktlich ist.
Sie werden es noch erleben, die jungen Leute, daß auch hier das Verstehen vor dem Verändern, das Verstehen dieser Sensation garantierter zivilisatorischer Standards alles überbietet, was irgendwelche kulturellen Höchstleistungen je fertig brächten. Bisher sah das anders aus: Bisher programmierten die Karl-Heinz Bohrers die Mainzelmännchenmentalität der kleinen Leute, sie langweilten sich in dieser Welt, weil sie nicht genügend Gehirn haben, um aus ihrer Phantasie und ihren Gedanken zu leben. Sie mußten provozieren, mußten schockieren, mußten mal ein bißchen Blut verspritzen, mal die Därme entleeren, den Schwanz raushängen lassen, und das wurde als künstlerische Besonderheit gefeiert. Für Leute, die keinen Kopf haben, eben leibarme Stubenhocker, ist das in der Tat notwendig, und das sind die Herrschaften, die auch heute noch die Ästhetik des Schreckens propagieren und sich politpornographisch suhlen, wenn sie jeden Tag in der Fernsehnachricht sehen, wie tatsächlich das Blut spritzt, und sich hier sich auf die Bühne stellen, um auf sich einen matten Abglanz dieser Radikalität in den Handlungen herunterzuholen. Und natürlich auch Dank für die Möglichkeit, wie Thomas Mann oder in diesem Zusammenhang ein wirklich anspruchsvoller Wirker der schlechten Avantgarde, nämlich Botho Strauß, die Wonnen der Gewöhnlichkeit tatsächlich erfahren zu haben, und nicht nur mal pausenweise zwischen der Beendigung des einen und dem Anfang des nächsten Werkes.
Also kurz: Dank dafür, wirklich durch Künstler, Architekten, Musiker zum Zeitgenossen gemacht worden zu sein durch die Befreiung von der Wahnhaftigkeit kultureller Fiktionen, die einen daran hindern zu verstehen, was in der Welt und mit einem selbst vor sich geht, weil man ständig darauf abonniert wurde, mit Omnipotenzphantastereien als Mercedes-Chef oder wie andere beispielhaft Genannte so zu tun, als unterliege es unserem Belieben, in der Welt zu schalten und zu walten, wie wir wollen, und der höchste Ausdruck dafür sei die Kunst. Auf dieser Ebene schafft es die Kunst nicht mit einem einzigen Realereignis, über das wir in den Medien unterrichtet werden. Das verbietet sich eigentlich als lächerlich für jemanden, der die Intelligenz hat, heute noch einen Fahrkartenautomaten zu bedienen, geschweige denn mehr zu leisten in der Lage ist. Und ich wollte den Jungen unter Ihnen bei Anlaß dieser Förderung sagen, daß sie nur Zeitgenossen werden können, wenn sie sich von dieser Absetzstrategie der falschen Moderne, die nur im Ich und Ihr, Humanist und Faschist, werkschaffendes Genie und durchschnittlicher idiotischer Arbeiter oder Fließbandroboter et cetera besteht, verabschieden, und sich selbst in ihrem Werkschaffen zum Prototypen, gerade zum Untersuchungsgegenstand selbst machen. Im Sinne einer Unterwerfung unter die Kritik gilt das Programm des Selbstfesselungskünstlers' statt des Selbstentfesselungskünstlers oder des herostratischen Genies. Man wird doch - wenn man etwa die Verlautbarungen bei der Beerdigung von Heiner Müller (Hermlin in der FAZ) liest - schamrot über die Unverschämtheit, mit der solche Leute sich da zu Ausnahmeerscheinungen stilisieren, unter Verweis auf die Legitimation, Künstler zu sein.
Ich wünsche den Förderungsmaßnahmen einen Erfolg im Sinne des Eingeständnisses, daß wir nicht förderbar sind. Denn wir müssen uns wirklich mal fragen: Wie kommen wir dazu, einer Gesellschaft abzuverlangen, sie mü.te unser Musizieren und Malen fördern? Auf dem Niveau, auf dem jeder Arbeiter heute fordert, ihr mü.t meine Familie, meine zwölf Kinder fördern, fördern, fördern, auf der Ebene können wir uns verstehen. Jetzt wird bei der Schließung von Theatern et ce te ra herumgeschrien: Skandal, Kulturskandale et cetera, diese Kultur ist immer ein Skandal. Kultur ist Kampfgemeinschaft, da fließt das Blut, das ist das Wesen der Kultur als Natur des Sozialen. Wenn Sie diese Auseinandersetzung - ewiger Bürgerkrieg, ewig wiederholte Religionskriege, ewig den gleichen Krempel seit Jahrhunderten - verlassen wollen, dann müssen Sie aus der Kultur aussteigen und sich auf das nächste Niveau begeben, das seit dem achtzehnten Jahrhundert formuliert wird, das der Zivilisation. Und dann müssen Sie sich fragen, welche Bedeutung Ihre medialen Artefakte überhaupt noch im Zivilisationsprozeß spielen. Im Kulturprozeß heißt es: wir Kroaten, wir Serben, im Verweis auf unsere Werk traditionen seit dem Amselfeld und der Eposlyrik, kämpfen im Namen dieser grandiosen Werke. Im Kulturkampf ist jeder Künstler willkommen, ein gutes Werk - zehntausend Tote, das kann man so ungefähr als grobe Rechnung in diesem Jahrhundert machen. Das ist ganz einfach, da kriegen Sie Geld und werden vereinnahmt, Huldigungsvereine treten Ihnen entgegen, et cetera. Komponieren Sie Musiken für jedes historische Ereignis, Nationalhymnen beispielsweise, seit dem neunzehnten Jahrhundert die Geldquelle. Es hat übrigens ein findiger Kopf neulich noch eine Nationalhymne, nämlich die japanische, für sich reklamiert, und der kassiert jetzt, ganz genial gemacht.
Aber erst auf der nächsten Ebene: interkulturell, transkulturell, beziehungsweise erst auf der zivilisatorischen Ebene, da stellen sich die entscheidenden Fragen. Die universalen Medien, Computer et cetera, stehen zur Verfügung. Jetzt gilt es als Künstler, als Architekt, als Wissenschaftler, Literat mal zu zeigen, was man wirklich auf dem Kasten hat, nämlich auf der zivilisatorischen Ebene Problemfindungen, Thematisierungen auszuarbeiten, die so faszinieren, daß Sie mit anderen Menschen darüber kommunizieren können. Und erst recht, wenn die Probleme, die Sie formulieren, wie die ökologischen, prinzipiell unlösbar sind, wenn es also wirklich um das geht, worum es immer in der Kunst gegangen ist, wenn die Meister Bedeutung haben für alle Zeiten und ihre Thematisierungen durch niemanden anderen einholbar, durch den Schüler nicht überbietbar sind, sondern die Perugino, Raffael, Michelangelo, Caravaggio, stehenbleiben als prinzipiell unlösbare Probleme. Die Größe dieser Künstler besteht darin, etwas formuliert zu haben, woran man sich die Zähne ausbeißt, und zwar aus dem Wesen solcher Schöpfungen. Arbeiten Sie mal auf dieser Ebene, als Künstler, Architekt, etwas aus, was als Thematisierung, Problematisierung so wichtig ist, daß Sie Menschen finden, die sich darauf mit Ihnen konzentrieren, und die ihre bisherige Bindung, Kulturgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, Bekenntnisgemeinschaft aufgeben und zur Gemeinschaft derer werden, die zusammenhalten, weil sie sich den gleichen unlösbaren Problemen stellen. Eigentlich ist das das Vorbild der Künstlergemeinschaft des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts. Denn der Kunst war klar: Der Zusammenhalt aller besteht darin, daß niemand einen anderen übertreffen kann. Man kann nicht Raffael viel größer als Perugino halten, Michelangelo größer als Raffael oder Caravaggio größer als wen auch immer, sondern sie sind darin groß, daß sie sich in dieser Hinsicht nicht überwinden, überw.ltigen, überbieten lassen, weil sie etwas gefunden haben, das als Thematisierung sogar jahrhundertelang Bestand hat. Und das ist die Aufgabe, um die es geht, nicht um individualistischen Ausdruck von Seelentiefe oder Weltschmerz und Verzweiflung, das ist etwas für die höheren Etagen, die damit ihre Fehlentscheidungen rechtfertigen müssen. Die Küchenm.dchen wissen seit langem, das so etwas anders geht. Und wir sollten uns nun endlich bequemen, uns auch dieser Weisheit anzuschließen. Vielen Dank. Vergleiche hierzu Nicole Stratmann, Bazan Brack. Der Selbstfesselungskünstler. Einführung in eine Ästhetik des Unterlassens, Weimar 1995, sowie Bazon Brack, "Selbstfesselungskünstler zwischen Gottsucherbanden und Unterhaltungs- Idioten", in: Bazon Brack, Die Re-Dekade. Kunst und Kultur der 80er Jahre, München 1990, 127-152.